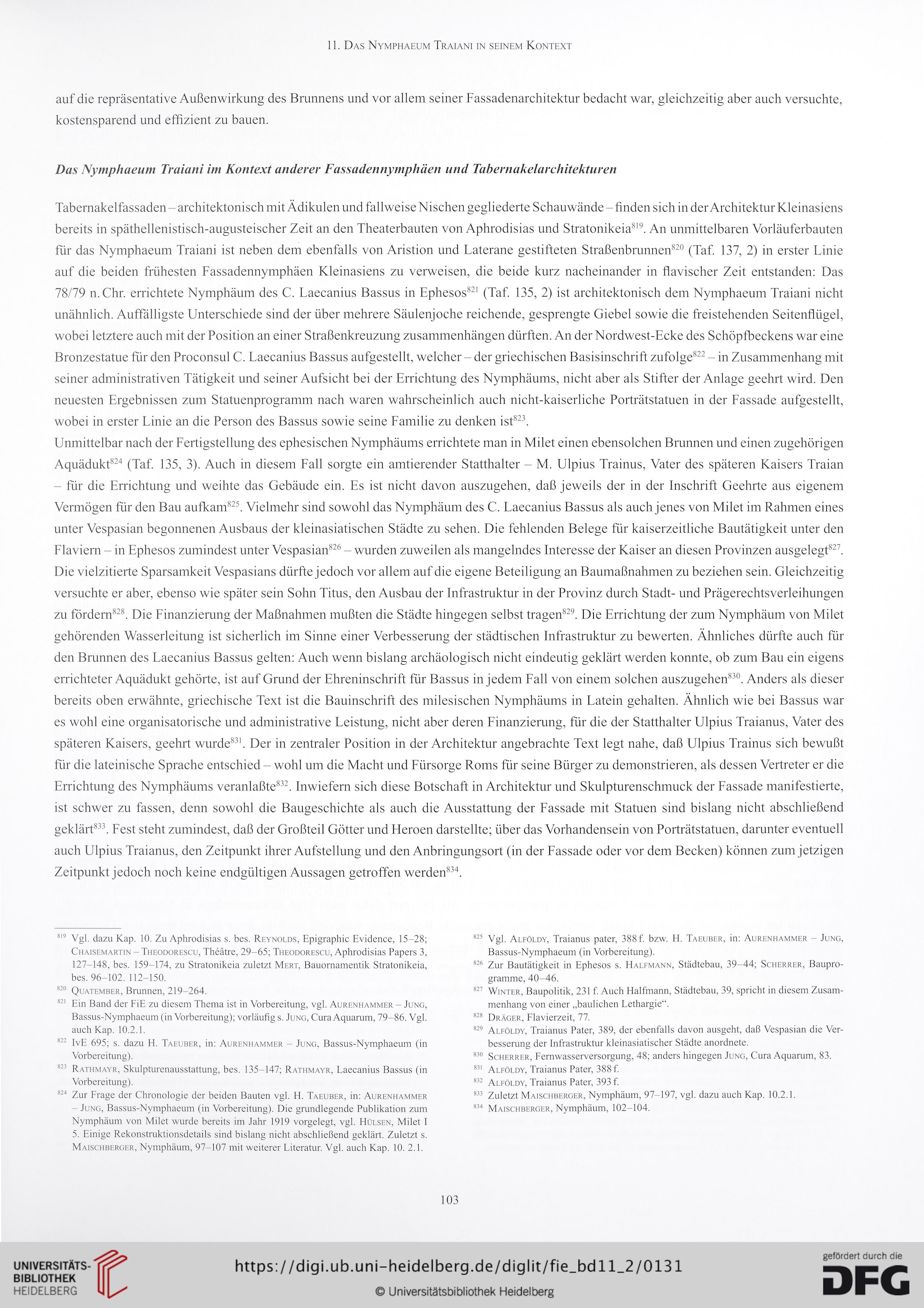11. Das Nymphaeum Traiani in seinem Kontext
auf die repräsentative Außenwirkung des Brunnens und vor allem seiner Fassadenarchitektur bedacht war, gleichzeitig aber auch versuchte,
kostensparend und effizient zu bauen.
Das Nymphaeum Traiani im Kontext anderer Fassadennymphäen und Tabernakelarchitekturen
Tabemakelfassaden - architektonisch mit Ädikulen und fallweise Nischen gegliederte Schauwände -finden sich in der Architektur Kleinasiens
bereits in späthellenistisch-augusteischer Zeit an den Theaterbauten von Aphrodisias und Stratonikeia819. An unmittelbaren Vorläuferbauten
für das Nymphaeum Traiani ist neben dem ebenfalls von Aristion und Laterane gestifteten Straßenbrunnen820 (Taf. 137, 2) in erster Linie
auf die beiden frühesten Fassadennymphäen Kleinasiens zu verweisen, die beide kurz nacheinander in flavischer Zeit entstanden: Das
78/79 n.Chr. errichtete Nymphäum des C. Laecanius Bassus in Ephesos821 (Taf. 135, 2) ist architektonisch dem Nymphaeum Traiani nicht
unähnlich. Auffälligste Unterschiede sind der über mehrere Säulenjoche reichende, gesprengte Giebel sowie die freistehenden Seitenflügel,
wobei letztere auch mit der Position an einer Straßenkreuzung Zusammenhängen dürften. An der Nordwest-Ecke des Schöpfbeckens war eine
Bronzestatue für den Proconsul C. Laecanius Bassus aufgestellt, welcher - der griechischen Basisinschrift zufolge822 - in Zusammenhang mit
seiner administrativen Tätigkeit und seiner Aufsicht bei der Errichtung des Nymphäums, nicht aber als Stifter der Anlage geehrt wird. Den
neuesten Ergebnissen zum Statuenprogramm nach waren wahrscheinlich auch nicht-kaiserliche Porträtstatuen in der Fassade aufgestellt,
wobei in erster Linie an die Person des Bassus sowie seine Familie zu denken ist823.
Unmittelbar nach der Fertigstellung des ephesischen Nymphäums errichtete man in Milet einen ebensolchen Brunnen und einen zugehörigen
Aquädukt824 (Taf. 135, 3). Auch in diesem Fall sorgte ein amtierender Statthalter - M. Ulpius Trainus, Vater des späteren Kaisers Traian
- für die Errichtung und weihte das Gebäude ein. Es ist nicht davon auszugehen, daß jeweils der in der Inschrift Geehrte aus eigenem
Vermögen für den Bau aufkam825. Vielmehr sind sowohl das Nymphäum des C. Laecanius Bassus als auch jenes von Milet im Rahmen eines
unter Vespasian begonnenen Ausbaus der kleinasiatischen Städte zu sehen. Die fehlenden Belege für kaiserzeitliche Bautätigkeit unter den
Flaviern - in Ephesos zumindest unter Vespasian826 - wurden zuweilen als mangelndes Interesse der Kaiser an diesen Provinzen ausgelegt827.
Die vielzitierte Sparsamkeit Vespasians dürfte jedoch vor allem auf die eigene Beteiligung an Baumaßnahmen zu beziehen sein. Gleichzeitig
versuchte er aber, ebenso wie später sein Sohn Titus, den Ausbau der Infrastruktur in der Provinz durch Stadt- und Prägerechtsverleihungen
zu fördern828. Die Finanzierung der Maßnahmen mußten die Städte hingegen selbst tragen829. Die Errichtung der zum Nymphäum von Milet
gehörenden Wasserleitung ist sicherlich im Sinne einer Verbesserung der städtischen Infrastruktur zu bewerten. Ähnliches dürfte auch für
den Brunnen des Laecanius Bassus gelten: Auch wenn bislang archäologisch nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob zum Bau ein eigens
errichteter Aquädukt gehörte, ist auf Grund der Ehreninschrift für Bassus in jedem Fall von einem solchen auszugehen830. Anders als dieser
bereits oben erwähnte, griechische Text ist die Bauinschrift des milesischen Nymphäums in Latein gehalten. Ähnlich wie bei Bassus war
es wohl eine organisatorische und administrative Leistung, nicht aber deren Finanzierung, für die der Statthalter Ulpius Traianus, Vater des
späteren Kaisers, geehrt wurde831. Der in zentraler Position in der Architektur angebrachte Text legt nahe, daß Ulpius Trainus sich bewußt
für die lateinische Sprache entschied - wohl um die Macht und Fürsorge Roms für seine Bürger zu demonstrieren, als dessen Vertreter er die
Errichtung des Nymphäums veranlaßte832. Inwiefern sich diese Botschaft in Architektur und Skulpturenschmuck der Fassade manifestierte,
ist schwer zu fassen, denn sowohl die Baugeschichte als auch die Ausstattung der Fassade mit Statuen sind bislang nicht abschließend
geklärt833. Fest steht zumindest, daß der Großteil Götter und Heroen darstellte; über das Vorhandensein von Porträtstatuen, darunter eventuell
auch Ulpius Traianus, den Zeitpunkt ihrer Aufstellung und den Anbringungsort (in der Fassade oder vor dem Becken) können zum jetzigen
Zeitpunkt jedoch noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden834.
819 Vgl. dazu Kap. 10. Zu Aphrodisias s. bes. Reynolds, Epigraphic Evidence, 15-28;
Chaisemartin - Theodorescu, Theätre, 29-65; Theodorescu, Aphrodisias Papers 3,
127-148, bes. 159-174, zu Stratonikeia zuletzt Mert, Bauomamentik Stratonikeia,
bes. 96-102. 112-150.
820 Quatember, Brunnen, 219-264.
821 Ein Band der FiE zu diesem Thema ist in Vorbereitung, vgl. Aurenhammer - Jung,
Bassus-Nymphaeum (in Vorbereitung); vorläufig s. Jung, Cura Aquarum, 79-86. Vgl.
auch Kap. 10.2.1.
822 IvE 695; s. dazu H. Taeuber, in: Aurenhammer - Jung, Bassus-Nymphaeum (in
Vorbereitung).
823 Rathmayr, Skulpturenausstattung, bes. 135-147; Rathmayr, Laecanius Bassus (in
Vorbereitung).
824 Zur Frage der Chronologie der beiden Bauten vgl. H. Taeuber, in: Aurenhammer
- Jung, Bassus-Nymphaeum (in Vorbereitung). Die grundlegende Publikation zum
Nymphäum von Milet wurde bereits im Jahr 1919 vorgelegt, vgl. Hülsen, Milet I
5. Einige Rekonstruktionsdetails sind bislang nicht abschließend geklärt. Zuletzt s.
Maischberger, Nymphäum, 97-107 mit weiterer Literatur. Vgl. auch Kap. 10. 2.1.
825 Vgl. Alföldy, Traianus pater, 388 f. bzw. H. Taeuber, in: Aurenhammer - Jung,
Bassus-Nymphaeum (in Vorbereitung).
826 Zur Bautätigkeit in Ephesos s. Halfmann, Städtebau, 39—44; Scherrer, Baupro-
gramme, 40-46.
827 Winter, Baupolitik, 231 f. Auch Halfmann, Städtebau, 39, spricht in diesem Zusam-
menhang von einer „baulichen Lethargie“.
828 Dräger, Flavierzeit, 77.
829 Alföldy, Traianus Pater, 389, der ebenfalls davon ausgeht, daß Vespasian die Ver-
besserung der Infrastruktur kleinasiatischer Städte anordnete.
830 Scherrer, Femwasserversorgung, 48; anders hingegen Jung, Cura Aquarum, 83.
831 Alföldy, Traianus Pater, 388 f.
832 Alföldy, Traianus Pater, 393 f.
833 Zuletzt Maischberger, Nymphäum, 97-197, vgl. dazu auch Kap. 10.2.1.
834 Maischberger, Nymphäum, 102-104.
103
auf die repräsentative Außenwirkung des Brunnens und vor allem seiner Fassadenarchitektur bedacht war, gleichzeitig aber auch versuchte,
kostensparend und effizient zu bauen.
Das Nymphaeum Traiani im Kontext anderer Fassadennymphäen und Tabernakelarchitekturen
Tabemakelfassaden - architektonisch mit Ädikulen und fallweise Nischen gegliederte Schauwände -finden sich in der Architektur Kleinasiens
bereits in späthellenistisch-augusteischer Zeit an den Theaterbauten von Aphrodisias und Stratonikeia819. An unmittelbaren Vorläuferbauten
für das Nymphaeum Traiani ist neben dem ebenfalls von Aristion und Laterane gestifteten Straßenbrunnen820 (Taf. 137, 2) in erster Linie
auf die beiden frühesten Fassadennymphäen Kleinasiens zu verweisen, die beide kurz nacheinander in flavischer Zeit entstanden: Das
78/79 n.Chr. errichtete Nymphäum des C. Laecanius Bassus in Ephesos821 (Taf. 135, 2) ist architektonisch dem Nymphaeum Traiani nicht
unähnlich. Auffälligste Unterschiede sind der über mehrere Säulenjoche reichende, gesprengte Giebel sowie die freistehenden Seitenflügel,
wobei letztere auch mit der Position an einer Straßenkreuzung Zusammenhängen dürften. An der Nordwest-Ecke des Schöpfbeckens war eine
Bronzestatue für den Proconsul C. Laecanius Bassus aufgestellt, welcher - der griechischen Basisinschrift zufolge822 - in Zusammenhang mit
seiner administrativen Tätigkeit und seiner Aufsicht bei der Errichtung des Nymphäums, nicht aber als Stifter der Anlage geehrt wird. Den
neuesten Ergebnissen zum Statuenprogramm nach waren wahrscheinlich auch nicht-kaiserliche Porträtstatuen in der Fassade aufgestellt,
wobei in erster Linie an die Person des Bassus sowie seine Familie zu denken ist823.
Unmittelbar nach der Fertigstellung des ephesischen Nymphäums errichtete man in Milet einen ebensolchen Brunnen und einen zugehörigen
Aquädukt824 (Taf. 135, 3). Auch in diesem Fall sorgte ein amtierender Statthalter - M. Ulpius Trainus, Vater des späteren Kaisers Traian
- für die Errichtung und weihte das Gebäude ein. Es ist nicht davon auszugehen, daß jeweils der in der Inschrift Geehrte aus eigenem
Vermögen für den Bau aufkam825. Vielmehr sind sowohl das Nymphäum des C. Laecanius Bassus als auch jenes von Milet im Rahmen eines
unter Vespasian begonnenen Ausbaus der kleinasiatischen Städte zu sehen. Die fehlenden Belege für kaiserzeitliche Bautätigkeit unter den
Flaviern - in Ephesos zumindest unter Vespasian826 - wurden zuweilen als mangelndes Interesse der Kaiser an diesen Provinzen ausgelegt827.
Die vielzitierte Sparsamkeit Vespasians dürfte jedoch vor allem auf die eigene Beteiligung an Baumaßnahmen zu beziehen sein. Gleichzeitig
versuchte er aber, ebenso wie später sein Sohn Titus, den Ausbau der Infrastruktur in der Provinz durch Stadt- und Prägerechtsverleihungen
zu fördern828. Die Finanzierung der Maßnahmen mußten die Städte hingegen selbst tragen829. Die Errichtung der zum Nymphäum von Milet
gehörenden Wasserleitung ist sicherlich im Sinne einer Verbesserung der städtischen Infrastruktur zu bewerten. Ähnliches dürfte auch für
den Brunnen des Laecanius Bassus gelten: Auch wenn bislang archäologisch nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob zum Bau ein eigens
errichteter Aquädukt gehörte, ist auf Grund der Ehreninschrift für Bassus in jedem Fall von einem solchen auszugehen830. Anders als dieser
bereits oben erwähnte, griechische Text ist die Bauinschrift des milesischen Nymphäums in Latein gehalten. Ähnlich wie bei Bassus war
es wohl eine organisatorische und administrative Leistung, nicht aber deren Finanzierung, für die der Statthalter Ulpius Traianus, Vater des
späteren Kaisers, geehrt wurde831. Der in zentraler Position in der Architektur angebrachte Text legt nahe, daß Ulpius Trainus sich bewußt
für die lateinische Sprache entschied - wohl um die Macht und Fürsorge Roms für seine Bürger zu demonstrieren, als dessen Vertreter er die
Errichtung des Nymphäums veranlaßte832. Inwiefern sich diese Botschaft in Architektur und Skulpturenschmuck der Fassade manifestierte,
ist schwer zu fassen, denn sowohl die Baugeschichte als auch die Ausstattung der Fassade mit Statuen sind bislang nicht abschließend
geklärt833. Fest steht zumindest, daß der Großteil Götter und Heroen darstellte; über das Vorhandensein von Porträtstatuen, darunter eventuell
auch Ulpius Traianus, den Zeitpunkt ihrer Aufstellung und den Anbringungsort (in der Fassade oder vor dem Becken) können zum jetzigen
Zeitpunkt jedoch noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden834.
819 Vgl. dazu Kap. 10. Zu Aphrodisias s. bes. Reynolds, Epigraphic Evidence, 15-28;
Chaisemartin - Theodorescu, Theätre, 29-65; Theodorescu, Aphrodisias Papers 3,
127-148, bes. 159-174, zu Stratonikeia zuletzt Mert, Bauomamentik Stratonikeia,
bes. 96-102. 112-150.
820 Quatember, Brunnen, 219-264.
821 Ein Band der FiE zu diesem Thema ist in Vorbereitung, vgl. Aurenhammer - Jung,
Bassus-Nymphaeum (in Vorbereitung); vorläufig s. Jung, Cura Aquarum, 79-86. Vgl.
auch Kap. 10.2.1.
822 IvE 695; s. dazu H. Taeuber, in: Aurenhammer - Jung, Bassus-Nymphaeum (in
Vorbereitung).
823 Rathmayr, Skulpturenausstattung, bes. 135-147; Rathmayr, Laecanius Bassus (in
Vorbereitung).
824 Zur Frage der Chronologie der beiden Bauten vgl. H. Taeuber, in: Aurenhammer
- Jung, Bassus-Nymphaeum (in Vorbereitung). Die grundlegende Publikation zum
Nymphäum von Milet wurde bereits im Jahr 1919 vorgelegt, vgl. Hülsen, Milet I
5. Einige Rekonstruktionsdetails sind bislang nicht abschließend geklärt. Zuletzt s.
Maischberger, Nymphäum, 97-107 mit weiterer Literatur. Vgl. auch Kap. 10. 2.1.
825 Vgl. Alföldy, Traianus pater, 388 f. bzw. H. Taeuber, in: Aurenhammer - Jung,
Bassus-Nymphaeum (in Vorbereitung).
826 Zur Bautätigkeit in Ephesos s. Halfmann, Städtebau, 39—44; Scherrer, Baupro-
gramme, 40-46.
827 Winter, Baupolitik, 231 f. Auch Halfmann, Städtebau, 39, spricht in diesem Zusam-
menhang von einer „baulichen Lethargie“.
828 Dräger, Flavierzeit, 77.
829 Alföldy, Traianus Pater, 389, der ebenfalls davon ausgeht, daß Vespasian die Ver-
besserung der Infrastruktur kleinasiatischer Städte anordnete.
830 Scherrer, Femwasserversorgung, 48; anders hingegen Jung, Cura Aquarum, 83.
831 Alföldy, Traianus Pater, 388 f.
832 Alföldy, Traianus Pater, 393 f.
833 Zuletzt Maischberger, Nymphäum, 97-197, vgl. dazu auch Kap. 10.2.1.
834 Maischberger, Nymphäum, 102-104.
103