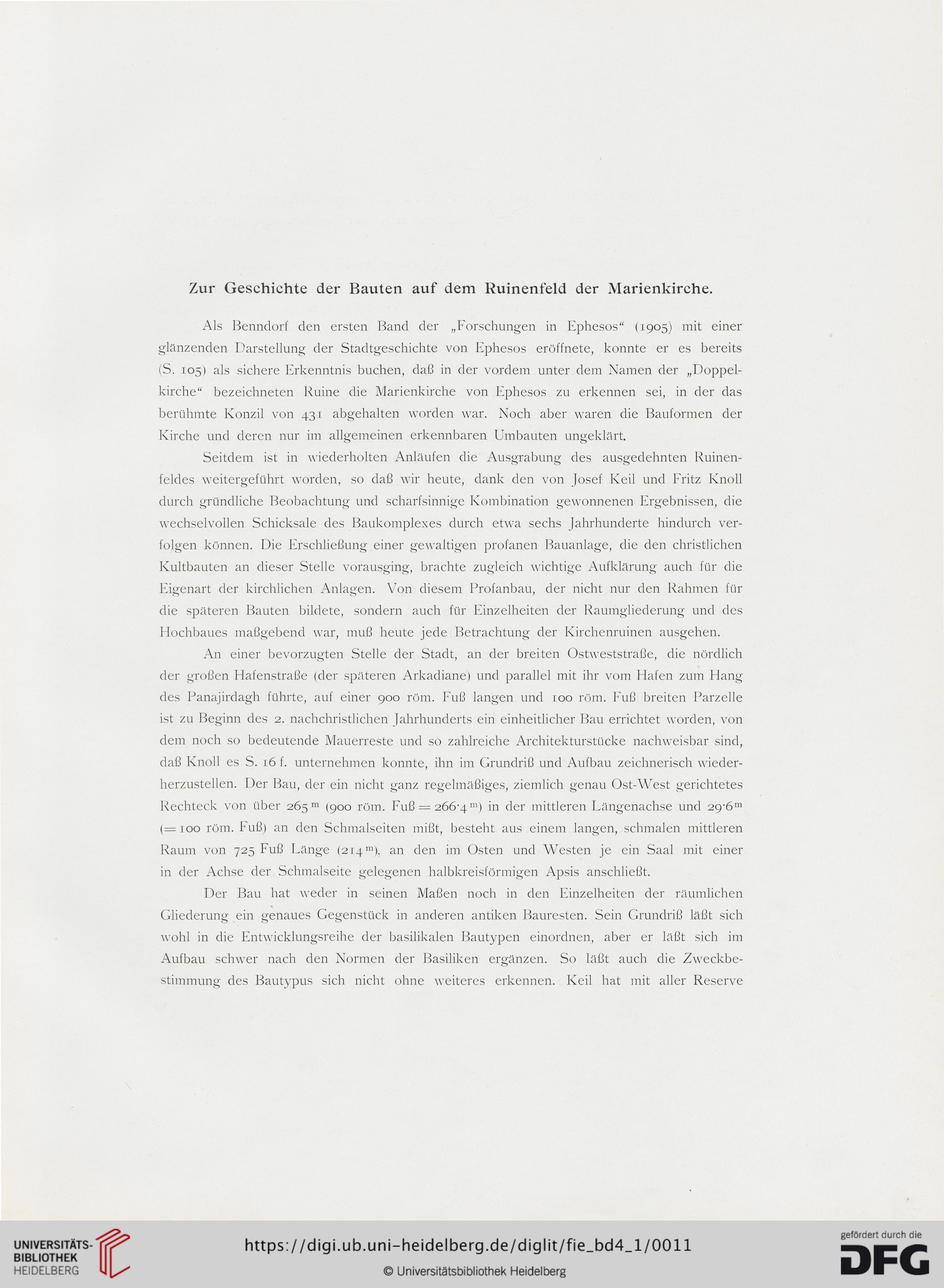Zur Geschichte der Bauten auf dem Ruinenfeld der Marienkirche.
Als Benndorf den ersten Band der „Forschungen in Ephesos“ (1905) mit einer
glänzenden Darstellung der Stadtgeschichte von Ephesos eröffnete, konnte er es bereits
(S. 105) als sichere Erkenntnis buchen, daß in der vordem unter dem Namen der „Doppel-
kirche“ bezeichneten Ruine die Marienkirche von Ephesos zu erkennen sei, in der das
berühmte Konzil von 431 abgehalten worden war. Noch aber waren die Bauformen der
Kirche und deren nur im allgemeinen erkennbaren Umbauten ungeklärt.
Seitdem ist in wiederholten Anläufen die Ausgrabung des ausgedehnten Ruinen-
feldes weitergeführt worden, so daß wir heute, dank den von Josef Keil und Fritz Knoll
durch gründliche Beobachtung und scharfsinnige Kombination gewonnenen Ergebnissen, die
wechselvollen Schicksale des Baukomplexes durch etwa sechs Jahrhunderte hindurch ver-
folgen können. Die Erschließung einer gewaltigen profanen Bauanlage, die den christlichen
Kultbauten an dieser Stelle vorausging, brachte zugleich wichtige Aufklärung auch für die
Eigenart der kirchlichen Anlagen. Von diesem Frofanbau, der nicht nur den Rahmen für
die spateren Bauten bildete, sondern auch für Einzelheiten der Raumgliederung und des
Hochbaues maßgebend war, muß heute jede Betrachtung der Kirchenruinen ausgehen.
An einer bevorzugten Stelle der Stadt, an der breiten Ostweststraße, die nördlich
der großen Hafenstraße (der späteren Arkadiane) und parallel mit ihr vom Hafen zum Hang
des Panajirdagh führte, auf einer 900 röm. Fuß langen und 100 röm. Fuß breiten Parzelle
ist zu Beginn des 2. nachchristlichen Jahrhunderts ein einheitlicher Bau errichtet worden, von
dem noch so bedeutende Mauerreste und so zahlreiche Architekturstücke nachweisbar sind,
daß Knoll es S. 16 f. unternehmen konnte, ihn im Grundriß und Aufbau zeichnerisch wieder-
herzustellen. Der Bau, der ein nicht ganz regelmäßiges, ziemlich genau Ost-West gerichtetes
Rechteck von über 265 m (900 röm. Fuß = 266-4m) in der mittleren Längenachse und 29-6“
(—100 röm. fuß) an den Schmalseiten mißt, besteht aus einem langen, schmalen mittleren
Raum von 725 Fuß Länge (214“), an den im Osten und Westen je ein Saal mit einer
in der Achse der Schmalseite gelegenen halbkreisförmigen Apsis anschließt.
Der Bau hat weder in seinen Maßen noch in den Einzelheiten der räumlichen
Gliederung ein genaues Gegenstück in anderen antiken Bauresten. Sein Grundriß läßt sich
wohl in die Entwicklungsreihe der basilikalen Bautypen einordnen, aber er läßt sich im
Aufbau schwer nach den Normen der Basiliken ergänzen. So laßt auch die Zweckbe-
stimmung des Bautypus sich nicht ohne weiteres erkennen. Keil hat mit aller Reserve
Als Benndorf den ersten Band der „Forschungen in Ephesos“ (1905) mit einer
glänzenden Darstellung der Stadtgeschichte von Ephesos eröffnete, konnte er es bereits
(S. 105) als sichere Erkenntnis buchen, daß in der vordem unter dem Namen der „Doppel-
kirche“ bezeichneten Ruine die Marienkirche von Ephesos zu erkennen sei, in der das
berühmte Konzil von 431 abgehalten worden war. Noch aber waren die Bauformen der
Kirche und deren nur im allgemeinen erkennbaren Umbauten ungeklärt.
Seitdem ist in wiederholten Anläufen die Ausgrabung des ausgedehnten Ruinen-
feldes weitergeführt worden, so daß wir heute, dank den von Josef Keil und Fritz Knoll
durch gründliche Beobachtung und scharfsinnige Kombination gewonnenen Ergebnissen, die
wechselvollen Schicksale des Baukomplexes durch etwa sechs Jahrhunderte hindurch ver-
folgen können. Die Erschließung einer gewaltigen profanen Bauanlage, die den christlichen
Kultbauten an dieser Stelle vorausging, brachte zugleich wichtige Aufklärung auch für die
Eigenart der kirchlichen Anlagen. Von diesem Frofanbau, der nicht nur den Rahmen für
die spateren Bauten bildete, sondern auch für Einzelheiten der Raumgliederung und des
Hochbaues maßgebend war, muß heute jede Betrachtung der Kirchenruinen ausgehen.
An einer bevorzugten Stelle der Stadt, an der breiten Ostweststraße, die nördlich
der großen Hafenstraße (der späteren Arkadiane) und parallel mit ihr vom Hafen zum Hang
des Panajirdagh führte, auf einer 900 röm. Fuß langen und 100 röm. Fuß breiten Parzelle
ist zu Beginn des 2. nachchristlichen Jahrhunderts ein einheitlicher Bau errichtet worden, von
dem noch so bedeutende Mauerreste und so zahlreiche Architekturstücke nachweisbar sind,
daß Knoll es S. 16 f. unternehmen konnte, ihn im Grundriß und Aufbau zeichnerisch wieder-
herzustellen. Der Bau, der ein nicht ganz regelmäßiges, ziemlich genau Ost-West gerichtetes
Rechteck von über 265 m (900 röm. Fuß = 266-4m) in der mittleren Längenachse und 29-6“
(—100 röm. fuß) an den Schmalseiten mißt, besteht aus einem langen, schmalen mittleren
Raum von 725 Fuß Länge (214“), an den im Osten und Westen je ein Saal mit einer
in der Achse der Schmalseite gelegenen halbkreisförmigen Apsis anschließt.
Der Bau hat weder in seinen Maßen noch in den Einzelheiten der räumlichen
Gliederung ein genaues Gegenstück in anderen antiken Bauresten. Sein Grundriß läßt sich
wohl in die Entwicklungsreihe der basilikalen Bautypen einordnen, aber er läßt sich im
Aufbau schwer nach den Normen der Basiliken ergänzen. So laßt auch die Zweckbe-
stimmung des Bautypus sich nicht ohne weiteres erkennen. Keil hat mit aller Reserve