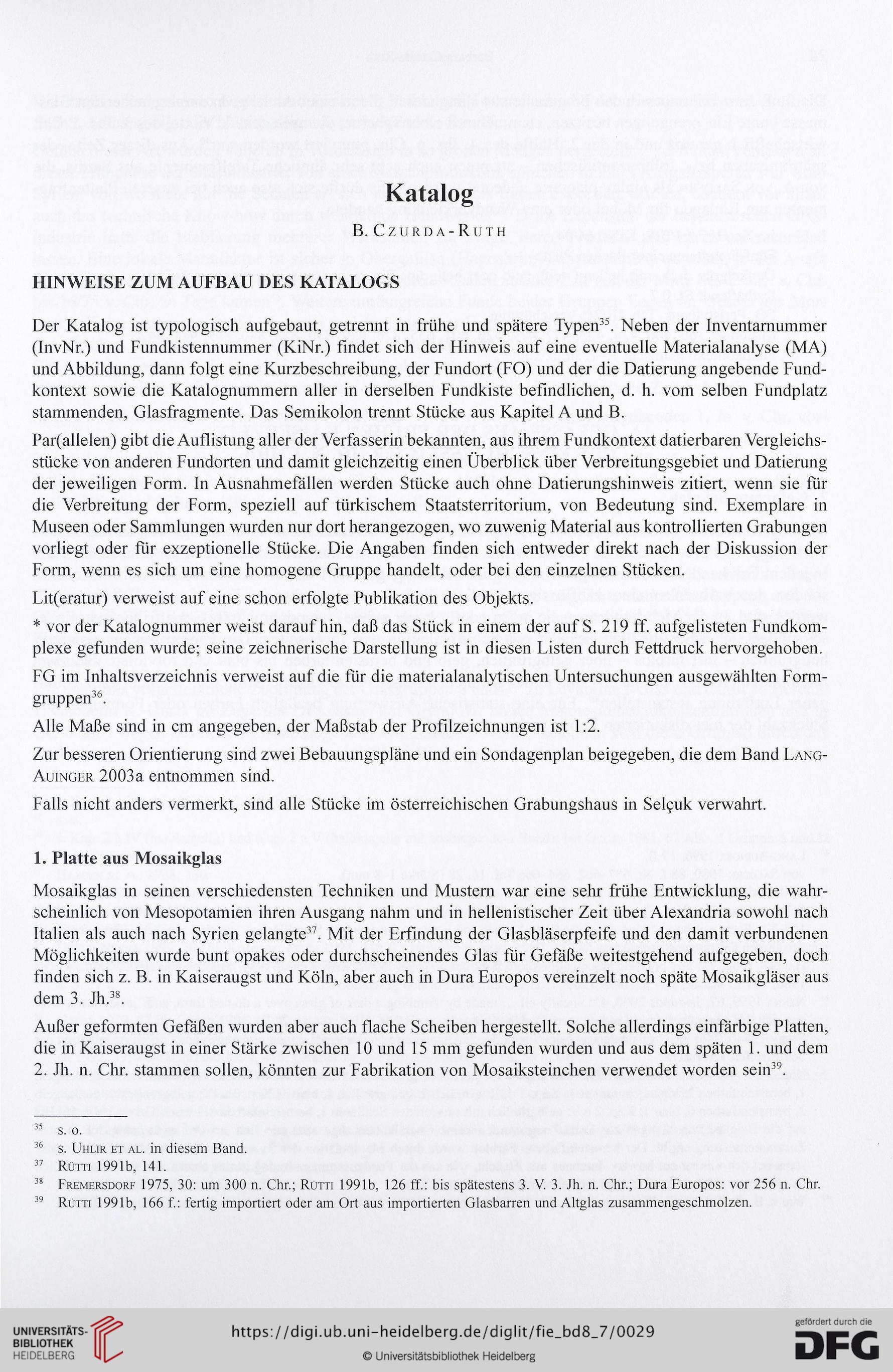Katalog
B. Czurda-Ruth
HINWEISE ZUM AUFBAU DES KATALOGS
Der Katalog ist typologisch aufgebaut, getrennt in frühe und spätere Typen35. Neben der Inventamummer
(InvNr.) und Fundkistennummer (KiNr.) findet sich der Hinweis auf eine eventuelle Materialanalyse (MA)
und Abbildung, dann folgt eine Kurzbeschreibung, der Fundort (FO) und der die Datierung angebende Fund-
kontext sowie die Katalognummern aller in derselben Fundkiste befindlichen, d. h. vom selben Fundplatz
stammenden, Glasfragmente. Das Semikolon trennt Stücke aus Kapitel A und B.
Par(allelen) gibt die Auflistung aller der Verfasserin bekannten, aus ihrem Fundkontext datierbaren Vergleichs-
stücke von anderen Fundorten und damit gleichzeitig einen Überblick über Verbreitungsgebiet und Datierung
der jeweiligen Form. In Ausnahmefällen werden Stücke auch ohne Datierungshinweis zitiert, wenn sie für
die Verbreitung der Form, speziell auf türkischem Staatsterritorium, von Bedeutung sind. Exemplare in
Museen oder Sammlungen wurden nur dort herangezogen, wo zuwenig Material aus kontrollierten Grabungen
vorliegt oder für exzeptionelle Stücke. Die Angaben finden sich entweder direkt nach der Diskussion der
Form, wenn es sich um eine homogene Gruppe handelt, oder bei den einzelnen Stücken.
Lit(eratur) verweist auf eine schon erfolgte Publikation des Objekts.
* vor der Katalognummer weist daraufhin, daß das Stück in einem der auf S. 219 ff. aufgelisteten Fundkom-
plexe gefunden wurde; seine zeichnerische Darstellung ist in diesen Listen durch Fettdruck hervorgehoben.
FG im Inhaltsverzeichnis verweist auf die für die materialanalytischen Untersuchungen ausgewählten Form-
gruppen36.
Alle Maße sind in cm angegeben, der Maßstab der Profilzeichnungen ist 1:2.
Zur besseren Orientierung sind zwei Bebauungspläne und ein Sondagenplan beigegeben, die dem Band Lang-
Auinger 2003 a entnommen sind.
Falls nicht anders vermerkt, sind alle Stücke im österreichischen Grabungshaus in SelQuk verwahrt.
1. Platte aus Mosaikglas
Mosaikglas in seinen verschiedensten Techniken und Mustern war eine sehr frühe Entwicklung, die wahr-
scheinlich von Mesopotamien ihren Ausgang nahm und in hellenistischer Zeit über Alexandria sowohl nach
Italien als auch nach Syrien gelangte37. Mit der Erfindung der Glasbläserpfeife und den damit verbundenen
Möglichkeiten wurde bunt opakes oder durchscheinendes Glas für Gefäße weitestgehend aufgegeben, doch
finden sich z. B. in Kaiseraugst und Köln, aber auch in Dura Europos vereinzelt noch späte Mosaikgläser aus
dem 3. Jh.38.
Außer geformten Gefäßen wurden aber auch flache Scheiben hergestellt. Solche allerdings einfärbige Platten,
die in Kaiseraugst in einer Stärke zwischen 10 und 15 mm gefunden wurden und aus dem späten 1. und dem
2. Jh. n. Chr. stammen sollen, könnten zur Fabrikation von Mosaiksteinchen verwendet worden sein39.
35 S. 0.
36 s. Uhlir et al. in diesem Band.
37 Rütti 1991b, 141.
38 Fremersdorf 1975, 30: um 300 n. Chr.; Rütti 1991b, 126 ff.: bis spätestens 3. V. 3. Jh. n. Chr.; Dura Europos: vor 256 n. Chr.
39 Rütti 1991b, 166 f.: fertig importiert oder am Ort aus importierten Glasbarren und Altglas zusammengeschmolzen.
B. Czurda-Ruth
HINWEISE ZUM AUFBAU DES KATALOGS
Der Katalog ist typologisch aufgebaut, getrennt in frühe und spätere Typen35. Neben der Inventamummer
(InvNr.) und Fundkistennummer (KiNr.) findet sich der Hinweis auf eine eventuelle Materialanalyse (MA)
und Abbildung, dann folgt eine Kurzbeschreibung, der Fundort (FO) und der die Datierung angebende Fund-
kontext sowie die Katalognummern aller in derselben Fundkiste befindlichen, d. h. vom selben Fundplatz
stammenden, Glasfragmente. Das Semikolon trennt Stücke aus Kapitel A und B.
Par(allelen) gibt die Auflistung aller der Verfasserin bekannten, aus ihrem Fundkontext datierbaren Vergleichs-
stücke von anderen Fundorten und damit gleichzeitig einen Überblick über Verbreitungsgebiet und Datierung
der jeweiligen Form. In Ausnahmefällen werden Stücke auch ohne Datierungshinweis zitiert, wenn sie für
die Verbreitung der Form, speziell auf türkischem Staatsterritorium, von Bedeutung sind. Exemplare in
Museen oder Sammlungen wurden nur dort herangezogen, wo zuwenig Material aus kontrollierten Grabungen
vorliegt oder für exzeptionelle Stücke. Die Angaben finden sich entweder direkt nach der Diskussion der
Form, wenn es sich um eine homogene Gruppe handelt, oder bei den einzelnen Stücken.
Lit(eratur) verweist auf eine schon erfolgte Publikation des Objekts.
* vor der Katalognummer weist daraufhin, daß das Stück in einem der auf S. 219 ff. aufgelisteten Fundkom-
plexe gefunden wurde; seine zeichnerische Darstellung ist in diesen Listen durch Fettdruck hervorgehoben.
FG im Inhaltsverzeichnis verweist auf die für die materialanalytischen Untersuchungen ausgewählten Form-
gruppen36.
Alle Maße sind in cm angegeben, der Maßstab der Profilzeichnungen ist 1:2.
Zur besseren Orientierung sind zwei Bebauungspläne und ein Sondagenplan beigegeben, die dem Band Lang-
Auinger 2003 a entnommen sind.
Falls nicht anders vermerkt, sind alle Stücke im österreichischen Grabungshaus in SelQuk verwahrt.
1. Platte aus Mosaikglas
Mosaikglas in seinen verschiedensten Techniken und Mustern war eine sehr frühe Entwicklung, die wahr-
scheinlich von Mesopotamien ihren Ausgang nahm und in hellenistischer Zeit über Alexandria sowohl nach
Italien als auch nach Syrien gelangte37. Mit der Erfindung der Glasbläserpfeife und den damit verbundenen
Möglichkeiten wurde bunt opakes oder durchscheinendes Glas für Gefäße weitestgehend aufgegeben, doch
finden sich z. B. in Kaiseraugst und Köln, aber auch in Dura Europos vereinzelt noch späte Mosaikgläser aus
dem 3. Jh.38.
Außer geformten Gefäßen wurden aber auch flache Scheiben hergestellt. Solche allerdings einfärbige Platten,
die in Kaiseraugst in einer Stärke zwischen 10 und 15 mm gefunden wurden und aus dem späten 1. und dem
2. Jh. n. Chr. stammen sollen, könnten zur Fabrikation von Mosaiksteinchen verwendet worden sein39.
35 S. 0.
36 s. Uhlir et al. in diesem Band.
37 Rütti 1991b, 141.
38 Fremersdorf 1975, 30: um 300 n. Chr.; Rütti 1991b, 126 ff.: bis spätestens 3. V. 3. Jh. n. Chr.; Dura Europos: vor 256 n. Chr.
39 Rütti 1991b, 166 f.: fertig importiert oder am Ort aus importierten Glasbarren und Altglas zusammengeschmolzen.