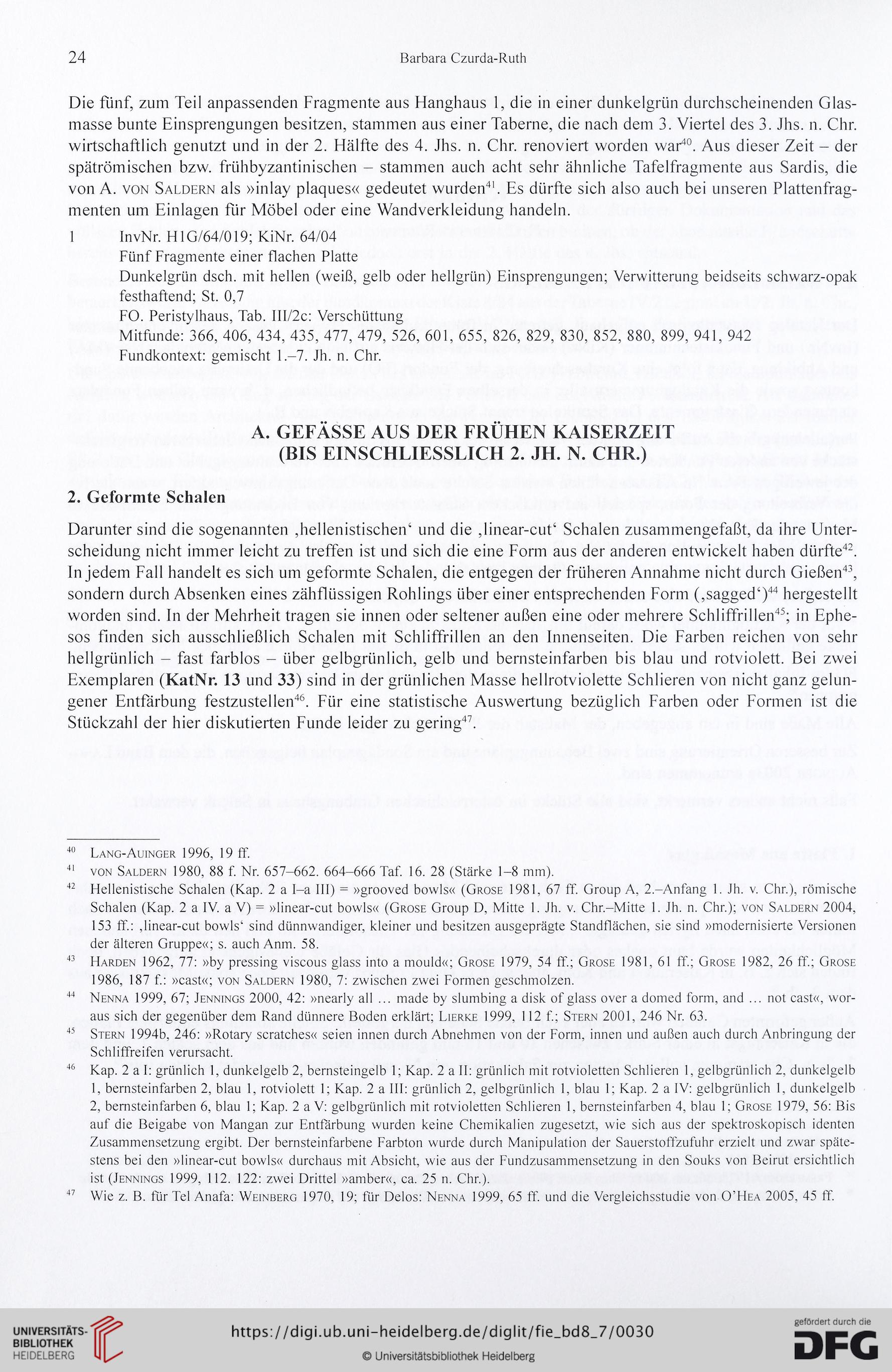24
Barbara Czurda-Ruth
Die fünf, zum Teil anpassenden Fragmente aus Hanghaus 1, die in einer dunkelgrün durchscheinenden Glas-
masse bunte Einsprengungen besitzen, stammen aus einer Taberne, die nach dem 3. Viertel des 3. Jhs. n. Chr.
wirtschaftlich genutzt und in der 2. Hälfte des 4. Jhs. n. Chr. renoviert worden war40. Aus dieser Zeit - der
spätrömischen bzw. frühbyzantinischen - stammen auch acht sehr ähnliche Tafelfragmente aus Sardis, die
von A. von Saldern als »inlay plaques« gedeutet wurden41. Es dürfte sich also auch bei unseren Plattenfrag-
menten um Einlagen für Möbel oder eine Wandverkleidung handeln.
1 InvNr. H1G/64/019; KiNr. 64/04
Fünf Fragmente einer flachen Platte
Dunkelgrün dsch. mit hellen (weiß, gelb oder hellgrün) Einsprengungen; Verwitterung beidseits schwarz-opak
festhaftend; St. 0,7
FO. Peristylhaus, Tab. III/2c: Verschüttung
Mitfunde: 366, 406, 434, 435, 477, 479, 526, 601, 655, 826, 829, 830, 852, 880, 899, 941, 942
Fundkontext: gemischt 1.-7. Jh. n. Chr.
A. GEFÄSSE AUS DER FRÜHEN KAISERZEIT
(BIS EINSCHLIESSLICH 2. JH. N. CHR.)
2. Geformte Schalen
Darunter sind die sogenannten ,hellenistischen4 und die ,linear-cuf Schalen zusammengefaßt, da ihre Unter-
scheidung nicht immer leicht zu treffen ist und sich die eine Form aus der anderen entwickelt haben dürfte42.
In jedem Fall handelt es sich um geformte Schalen, die entgegen der früheren Annahme nicht durch Gießen43,
sondern durch Absenken eines zähflüssigen Rohlings über einer entsprechenden Form (,sagged‘)44 hergestellt
worden sind. In der Mehrheit tragen sie innen oder seltener außen eine oder mehrere Schliffrillen45; in Ephe-
sos finden sich ausschließlich Schalen mit Schliffrillen an den Innenseiten. Die Farben reichen von sehr
hellgrünlich - fast farblos - über gelbgrünlich, gelb und bernsteinfarben bis blau und rotviolett. Bei zwei
Exemplaren (KatNr. 13 und 33) sind in der grünlichen Masse hellrotviolette Schlieren von nicht ganz gelun-
gener Entfärbung festzustellen46. Für eine statistische Auswertung bezüglich Farben oder Formen ist die
Stückzahl der hier diskutierten Funde leider zu gering47.
40 Lang-Auinger 1996, 19 ff.
41 von Saldern 1980, 88 f. Nr. 657-662. 664-666 Taf. 16. 28 (Stärke 1-8 mm).
42 Hellenistische Schalen (Kap. 2 a 1-a III) = »grooved bowls« (Grose 1981, 67 ff. Group A, 2,-Anfang 1. Jh. v. Chr.), römische
Schalen (Kap. 2 a IV. a V) = »linear-cut bowls« (Grose Group D, Mitte 1. Jh. v. Chr.-Mitte 1. Jh. n. Chr.); von Saldern 2004,
153 ff: ,linear-cut bowls1 sind dünnwandiger, kleiner und besitzen ausgeprägte Standflächen, sie sind »modernisierte Versionen
der älteren Gruppe«; s. auch Anm. 58.
43 Harden 1962, 77: »by pressing viscous glass into a mould«; Grose 1979, 54 ff; Grose 1981, 61 ff.; Grose 1982, 26 ff; Grose
1986, 187 f.: »cast«; von Saldern 1980, 7: zwischen zwei Formen geschmolzen.
44 Nenna 1999, 67; Jennings 2000, 42: »nearly all ... made by slumbing a disk of glass over a domed form, and ... not cast«, wor-
aus sich der gegenüber dem Rand dünnere Boden erklärt; Lierke 1999, 112 f.; Stern 2001, 246 Nr. 63.
45 Stern 1994b, 246: »Rotary scratches« seien innen durch Abnehmen von der Form, innen und außen auch durch Anbringung der
Schliffreifen verursacht.
46 Kap. 2 a 1: grünlich 1, dunkelgelb 2, bernsteingelb 1; Kap. 2 a II: grünlich mit rotvioletten Schlieren 1, gelbgrünlich 2, dunkelgelb
1, bernsteinfarben 2, blau 1, rotviolett 1; Kap. 2 a III: grünlich 2, gelbgrünlich 1, blau I; Kap. 2 a IV: gelbgrünlich 1. dunkelgelb
2, bernsteinfarben 6, blau 1; Kap. 2 a V: gelbgrünlich mit rotvioletten Schlieren 1, bernsteinfarben 4, blau 1; Grose 1979, 56: Bis
auf die Beigabe von Mangan zur Entfärbung wurden keine Chemikalien zugesetzt, wie sich aus der spektroskopisch identen
Zusammensetzung ergibt. Der bernsteinfarbene Farbton wurde durch Manipulation der Sauerstoffzufuhr erzielt und zwar späte-
stens bei den »linear-cut bowls« durchaus mit Absicht, wie aus der Fundzusammensetzung in den Souks von Beirut ersichtlich
ist (Jennings 1999, 112. 122: zwei Drittel »amber«, ca. 25 n. Chr.).
47 Wie z. B. für Tel Anafa: Weinberg 1970, 19; für Delos: Nenna 1999, 65 ff. und die Vergleichsstudie von O’Hea 2005, 45 ff.
Barbara Czurda-Ruth
Die fünf, zum Teil anpassenden Fragmente aus Hanghaus 1, die in einer dunkelgrün durchscheinenden Glas-
masse bunte Einsprengungen besitzen, stammen aus einer Taberne, die nach dem 3. Viertel des 3. Jhs. n. Chr.
wirtschaftlich genutzt und in der 2. Hälfte des 4. Jhs. n. Chr. renoviert worden war40. Aus dieser Zeit - der
spätrömischen bzw. frühbyzantinischen - stammen auch acht sehr ähnliche Tafelfragmente aus Sardis, die
von A. von Saldern als »inlay plaques« gedeutet wurden41. Es dürfte sich also auch bei unseren Plattenfrag-
menten um Einlagen für Möbel oder eine Wandverkleidung handeln.
1 InvNr. H1G/64/019; KiNr. 64/04
Fünf Fragmente einer flachen Platte
Dunkelgrün dsch. mit hellen (weiß, gelb oder hellgrün) Einsprengungen; Verwitterung beidseits schwarz-opak
festhaftend; St. 0,7
FO. Peristylhaus, Tab. III/2c: Verschüttung
Mitfunde: 366, 406, 434, 435, 477, 479, 526, 601, 655, 826, 829, 830, 852, 880, 899, 941, 942
Fundkontext: gemischt 1.-7. Jh. n. Chr.
A. GEFÄSSE AUS DER FRÜHEN KAISERZEIT
(BIS EINSCHLIESSLICH 2. JH. N. CHR.)
2. Geformte Schalen
Darunter sind die sogenannten ,hellenistischen4 und die ,linear-cuf Schalen zusammengefaßt, da ihre Unter-
scheidung nicht immer leicht zu treffen ist und sich die eine Form aus der anderen entwickelt haben dürfte42.
In jedem Fall handelt es sich um geformte Schalen, die entgegen der früheren Annahme nicht durch Gießen43,
sondern durch Absenken eines zähflüssigen Rohlings über einer entsprechenden Form (,sagged‘)44 hergestellt
worden sind. In der Mehrheit tragen sie innen oder seltener außen eine oder mehrere Schliffrillen45; in Ephe-
sos finden sich ausschließlich Schalen mit Schliffrillen an den Innenseiten. Die Farben reichen von sehr
hellgrünlich - fast farblos - über gelbgrünlich, gelb und bernsteinfarben bis blau und rotviolett. Bei zwei
Exemplaren (KatNr. 13 und 33) sind in der grünlichen Masse hellrotviolette Schlieren von nicht ganz gelun-
gener Entfärbung festzustellen46. Für eine statistische Auswertung bezüglich Farben oder Formen ist die
Stückzahl der hier diskutierten Funde leider zu gering47.
40 Lang-Auinger 1996, 19 ff.
41 von Saldern 1980, 88 f. Nr. 657-662. 664-666 Taf. 16. 28 (Stärke 1-8 mm).
42 Hellenistische Schalen (Kap. 2 a 1-a III) = »grooved bowls« (Grose 1981, 67 ff. Group A, 2,-Anfang 1. Jh. v. Chr.), römische
Schalen (Kap. 2 a IV. a V) = »linear-cut bowls« (Grose Group D, Mitte 1. Jh. v. Chr.-Mitte 1. Jh. n. Chr.); von Saldern 2004,
153 ff: ,linear-cut bowls1 sind dünnwandiger, kleiner und besitzen ausgeprägte Standflächen, sie sind »modernisierte Versionen
der älteren Gruppe«; s. auch Anm. 58.
43 Harden 1962, 77: »by pressing viscous glass into a mould«; Grose 1979, 54 ff; Grose 1981, 61 ff.; Grose 1982, 26 ff; Grose
1986, 187 f.: »cast«; von Saldern 1980, 7: zwischen zwei Formen geschmolzen.
44 Nenna 1999, 67; Jennings 2000, 42: »nearly all ... made by slumbing a disk of glass over a domed form, and ... not cast«, wor-
aus sich der gegenüber dem Rand dünnere Boden erklärt; Lierke 1999, 112 f.; Stern 2001, 246 Nr. 63.
45 Stern 1994b, 246: »Rotary scratches« seien innen durch Abnehmen von der Form, innen und außen auch durch Anbringung der
Schliffreifen verursacht.
46 Kap. 2 a 1: grünlich 1, dunkelgelb 2, bernsteingelb 1; Kap. 2 a II: grünlich mit rotvioletten Schlieren 1, gelbgrünlich 2, dunkelgelb
1, bernsteinfarben 2, blau 1, rotviolett 1; Kap. 2 a III: grünlich 2, gelbgrünlich 1, blau I; Kap. 2 a IV: gelbgrünlich 1. dunkelgelb
2, bernsteinfarben 6, blau 1; Kap. 2 a V: gelbgrünlich mit rotvioletten Schlieren 1, bernsteinfarben 4, blau 1; Grose 1979, 56: Bis
auf die Beigabe von Mangan zur Entfärbung wurden keine Chemikalien zugesetzt, wie sich aus der spektroskopisch identen
Zusammensetzung ergibt. Der bernsteinfarbene Farbton wurde durch Manipulation der Sauerstoffzufuhr erzielt und zwar späte-
stens bei den »linear-cut bowls« durchaus mit Absicht, wie aus der Fundzusammensetzung in den Souks von Beirut ersichtlich
ist (Jennings 1999, 112. 122: zwei Drittel »amber«, ca. 25 n. Chr.).
47 Wie z. B. für Tel Anafa: Weinberg 1970, 19; für Delos: Nenna 1999, 65 ff. und die Vergleichsstudie von O’Hea 2005, 45 ff.