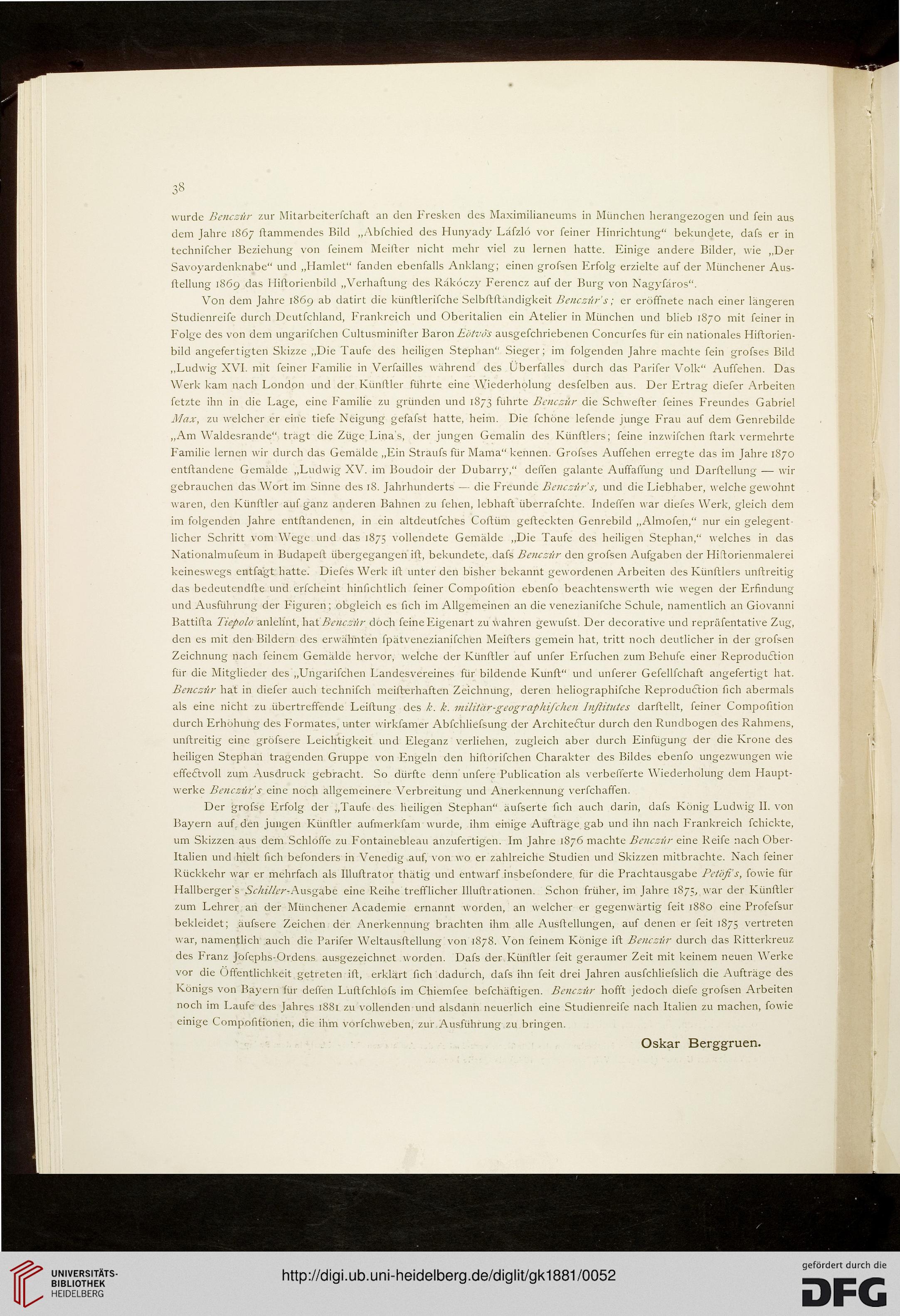wurde Benczür zur Mitarbeiterschaft an den Fresken des Maximilianeums in München herangezogen und sein aus
dem Jahre 1867 slammendes Bild „Abschied des Hunyady Läszlo vor seiner Hinrichtung" bekundete, dass er in
technischer Beziehung von seinem Meiller nicht mehr viel zu lernen hatte. Einige andere Bilder, wie „Der
Savoyardenknabe" und „Hamlet" fanden ebenfalls Anklang; einen grossen Erfolg erzielte auf der Münchener Aus-
slellung 1869 das Historienbild „Verhaftung des Räköczy Ferencz auf der Burg von Nagysäros".
Von dem Jahre 1869 ab datirt die künsllerische Selbstsländigkeit Benczür's; er eröfsnete nach einer längeren
Studienreise durch Dcutschland, Frankreich und Oberitalien ein Atelier in München und blieb 1870 mit seiner in
Folge des von dem ungarischen Cultusminister Baron Eötvö's ausgeschriebenen Concurses für ein nationales Historien-
bild angefertigten Skizze „Die Taufe des heiligen Stephan" Sieger; im folgenden Jahre machte sein grosses Bild
„Ludwig XVI. mit seiner Familie in Versailles wahrend des Überfalles durch das Pariser Volk" Auffehen. Das
Werk kam nach London und der Künsller führte eine Wiederholung desselben aus. Der Ertrag dieser Arbeiten
setzte ihn in die Lage, eine Familie zu gründen und 1873 führte Benczür die Schwester seines Freundes Gabriel
Max, zu welcher er eine tiefe Neigung gefasst hatte, heim. Die schöne lesende junge Frau auf dem Genrebilde
„Am Waldesrande" tragt die Züge Linas, der jungen Gemalin des Künstlers; seine inzwischen stark vermehrte
Familie lernen wir durch das Gemälde „Ein Strauss für Mama" kennen. Grosses Aufsehen erregte das im Jahre 1870
entstandene Gemälde „Ludwig XV. im Boudoir der Dubarry," dessen galante Ausfassung und Darslellung — wir
gebrauchen das Wort im Sinne des 18. Jahrhunderts — die Freunde Benczitr's, und die Liebhaber, welche gewohnt
waren, den Künsller auf ganz anderen Bahnen zu sehen, lebhaft überraschte. Indessen war dieses Werk, gleich dem
im folgenden Jahre entstandenen, in ein altdeutsehes Costüm gesleckten Genrebild „Almosen," nur ein gelegent-
licher Schritt vom Wege und das 1875 vollendete Gemälde „Die Taufe des heiligen Stephan," welches in das
Nationalmuseum in Budapeil übergegangen ist, bekundete, dass Benczür den grossen Aufgaben der Hislorienmalerei
keineswegs entsa'gt hatte. Dieses Werk ill unter den bisher bekannt gewordenen Arbeiten des Künstlers unstreitig
das bedeutendste und erscheint hinsichtlich seiner Composition ebenso beachtenswerth wie wegen der Erfindung
und Ausführung der Figuren; obgleich es sich im Allgemeinen an die venezianische Schule, namentlich an Giovanni
Battista Tiepolo anlehnt, hat Benczür doch seine Eigenart zu wahren gewusst. Der decorative und repräsentative Zug,
den es mit den Bildern des erwähnten spätvenezianischen Meisters gemein hat, tritt noch deutlicher in der grossen
Zeichnung nach seinem Gemälde hervor, welche der Künsller auf unser Ersuchen zum Behuse einer Reproduclion
für die Mitglieder des „Ungarischen Landesvereines für bildende Kunst" und unserer Gesellschaft angefertigt hat.
Benczür hat in dieser auch technisch meisterhaften Zeichnung, deren heliographische Reproduclion sich abermals
als eine nicht zu übertresfende Leislung des k. k. militär-geograpliifchen Inflitutes darstellt, seiner Composition
durch Erhöhung des Formates, unter wirksamer Abschliessung der Architeclur durch den Rundbogen des Rahmens,
unstreitig eine grössere Leichtigkeit und Eleganz verliehen, zugleich aber durch Einfügung der die Krone des
heiligen Stephan tragenden Gruppe von Engeln den historischen Charakter des Bildes ebenso ungezwungen wie
effeclvoll zum Ausdruck gebracht. So dürfte denn unsere Publication als verbesserte Wiederholung dem Haupt-
werke Benczür's eine noch allgemeinere Verbreitung und Anerkennung verschasfen.
Der grosse Erfolg der „Taufe des heiligen Stephan" äusserte sich auch darin, dass König Ludwig II. von
Bayern auf den jungen Künsller aufmerksam wurde, ihm einige Aufträge gab und ihn nach Frankreich schickte,
um Skizzen aus dem Schlösse zu Fontainebleau anzufertigen. Im Jahre 1876 machte Benczitr eine Reise nach Ober-
Italien und hielt sich besonders in Venedig auf, von wo er zahlreiche Studien und Skizzen mitbrachte. Nach seiner
Rückkehr war er mehrfach als Illustrator thätig und entwarf insbesondere für die Prachtausgabe Petöß's, sowie für
Hallberger's Schiller-Ausgsbt eine Reihe tresflicher Ulustrationen. Schon früher, im Jahre 1875, war der Künstler
zum Lehrer an der Münchener Academie ernannt worden, an welcher er gegenwärtig seit 1880 eine Professur
bekleidet; äussere Zeichen der Anerkennung brachten ihm alle Ausstellungen, auf denen er seit 1875 vertreten
war, namentlich auch die Pariser Weltausstellung von 1878. Von seinem Könige ist Benczür durch das Ritterkreuz
des Franz Josephs-Ordens ausgezeichnet worden. Dass der Künstler seit geraumer Zeit mit keinem neuen Werke
vor die Öfsentlichkeit getreten ist, erklärt sich dadurch, dass ihn seit drei Jahren ausschliesslich die Aufträge des
Königs von Bayern für dessen Lustschloss im Chiemsee beschäftigen. Benczür hofft jedoch diese grossen Arbeiten
noch im Laufe des Jahres 1881 zu vollenden-und alsdann neuerlich eine Studienreise nach Italien zu machen, sowie
einige Compositionen, die ihm vorschweben, zur Ausführung zu bringen.
Oskar Berggruen.
dem Jahre 1867 slammendes Bild „Abschied des Hunyady Läszlo vor seiner Hinrichtung" bekundete, dass er in
technischer Beziehung von seinem Meiller nicht mehr viel zu lernen hatte. Einige andere Bilder, wie „Der
Savoyardenknabe" und „Hamlet" fanden ebenfalls Anklang; einen grossen Erfolg erzielte auf der Münchener Aus-
slellung 1869 das Historienbild „Verhaftung des Räköczy Ferencz auf der Burg von Nagysäros".
Von dem Jahre 1869 ab datirt die künsllerische Selbstsländigkeit Benczür's; er eröfsnete nach einer längeren
Studienreise durch Dcutschland, Frankreich und Oberitalien ein Atelier in München und blieb 1870 mit seiner in
Folge des von dem ungarischen Cultusminister Baron Eötvö's ausgeschriebenen Concurses für ein nationales Historien-
bild angefertigten Skizze „Die Taufe des heiligen Stephan" Sieger; im folgenden Jahre machte sein grosses Bild
„Ludwig XVI. mit seiner Familie in Versailles wahrend des Überfalles durch das Pariser Volk" Auffehen. Das
Werk kam nach London und der Künsller führte eine Wiederholung desselben aus. Der Ertrag dieser Arbeiten
setzte ihn in die Lage, eine Familie zu gründen und 1873 führte Benczür die Schwester seines Freundes Gabriel
Max, zu welcher er eine tiefe Neigung gefasst hatte, heim. Die schöne lesende junge Frau auf dem Genrebilde
„Am Waldesrande" tragt die Züge Linas, der jungen Gemalin des Künstlers; seine inzwischen stark vermehrte
Familie lernen wir durch das Gemälde „Ein Strauss für Mama" kennen. Grosses Aufsehen erregte das im Jahre 1870
entstandene Gemälde „Ludwig XV. im Boudoir der Dubarry," dessen galante Ausfassung und Darslellung — wir
gebrauchen das Wort im Sinne des 18. Jahrhunderts — die Freunde Benczitr's, und die Liebhaber, welche gewohnt
waren, den Künsller auf ganz anderen Bahnen zu sehen, lebhaft überraschte. Indessen war dieses Werk, gleich dem
im folgenden Jahre entstandenen, in ein altdeutsehes Costüm gesleckten Genrebild „Almosen," nur ein gelegent-
licher Schritt vom Wege und das 1875 vollendete Gemälde „Die Taufe des heiligen Stephan," welches in das
Nationalmuseum in Budapeil übergegangen ist, bekundete, dass Benczür den grossen Aufgaben der Hislorienmalerei
keineswegs entsa'gt hatte. Dieses Werk ill unter den bisher bekannt gewordenen Arbeiten des Künstlers unstreitig
das bedeutendste und erscheint hinsichtlich seiner Composition ebenso beachtenswerth wie wegen der Erfindung
und Ausführung der Figuren; obgleich es sich im Allgemeinen an die venezianische Schule, namentlich an Giovanni
Battista Tiepolo anlehnt, hat Benczür doch seine Eigenart zu wahren gewusst. Der decorative und repräsentative Zug,
den es mit den Bildern des erwähnten spätvenezianischen Meisters gemein hat, tritt noch deutlicher in der grossen
Zeichnung nach seinem Gemälde hervor, welche der Künsller auf unser Ersuchen zum Behuse einer Reproduclion
für die Mitglieder des „Ungarischen Landesvereines für bildende Kunst" und unserer Gesellschaft angefertigt hat.
Benczür hat in dieser auch technisch meisterhaften Zeichnung, deren heliographische Reproduclion sich abermals
als eine nicht zu übertresfende Leislung des k. k. militär-geograpliifchen Inflitutes darstellt, seiner Composition
durch Erhöhung des Formates, unter wirksamer Abschliessung der Architeclur durch den Rundbogen des Rahmens,
unstreitig eine grössere Leichtigkeit und Eleganz verliehen, zugleich aber durch Einfügung der die Krone des
heiligen Stephan tragenden Gruppe von Engeln den historischen Charakter des Bildes ebenso ungezwungen wie
effeclvoll zum Ausdruck gebracht. So dürfte denn unsere Publication als verbesserte Wiederholung dem Haupt-
werke Benczür's eine noch allgemeinere Verbreitung und Anerkennung verschasfen.
Der grosse Erfolg der „Taufe des heiligen Stephan" äusserte sich auch darin, dass König Ludwig II. von
Bayern auf den jungen Künsller aufmerksam wurde, ihm einige Aufträge gab und ihn nach Frankreich schickte,
um Skizzen aus dem Schlösse zu Fontainebleau anzufertigen. Im Jahre 1876 machte Benczitr eine Reise nach Ober-
Italien und hielt sich besonders in Venedig auf, von wo er zahlreiche Studien und Skizzen mitbrachte. Nach seiner
Rückkehr war er mehrfach als Illustrator thätig und entwarf insbesondere für die Prachtausgabe Petöß's, sowie für
Hallberger's Schiller-Ausgsbt eine Reihe tresflicher Ulustrationen. Schon früher, im Jahre 1875, war der Künstler
zum Lehrer an der Münchener Academie ernannt worden, an welcher er gegenwärtig seit 1880 eine Professur
bekleidet; äussere Zeichen der Anerkennung brachten ihm alle Ausstellungen, auf denen er seit 1875 vertreten
war, namentlich auch die Pariser Weltausstellung von 1878. Von seinem Könige ist Benczür durch das Ritterkreuz
des Franz Josephs-Ordens ausgezeichnet worden. Dass der Künstler seit geraumer Zeit mit keinem neuen Werke
vor die Öfsentlichkeit getreten ist, erklärt sich dadurch, dass ihn seit drei Jahren ausschliesslich die Aufträge des
Königs von Bayern für dessen Lustschloss im Chiemsee beschäftigen. Benczür hofft jedoch diese grossen Arbeiten
noch im Laufe des Jahres 1881 zu vollenden-und alsdann neuerlich eine Studienreise nach Italien zu machen, sowie
einige Compositionen, die ihm vorschweben, zur Ausführung zu bringen.
Oskar Berggruen.