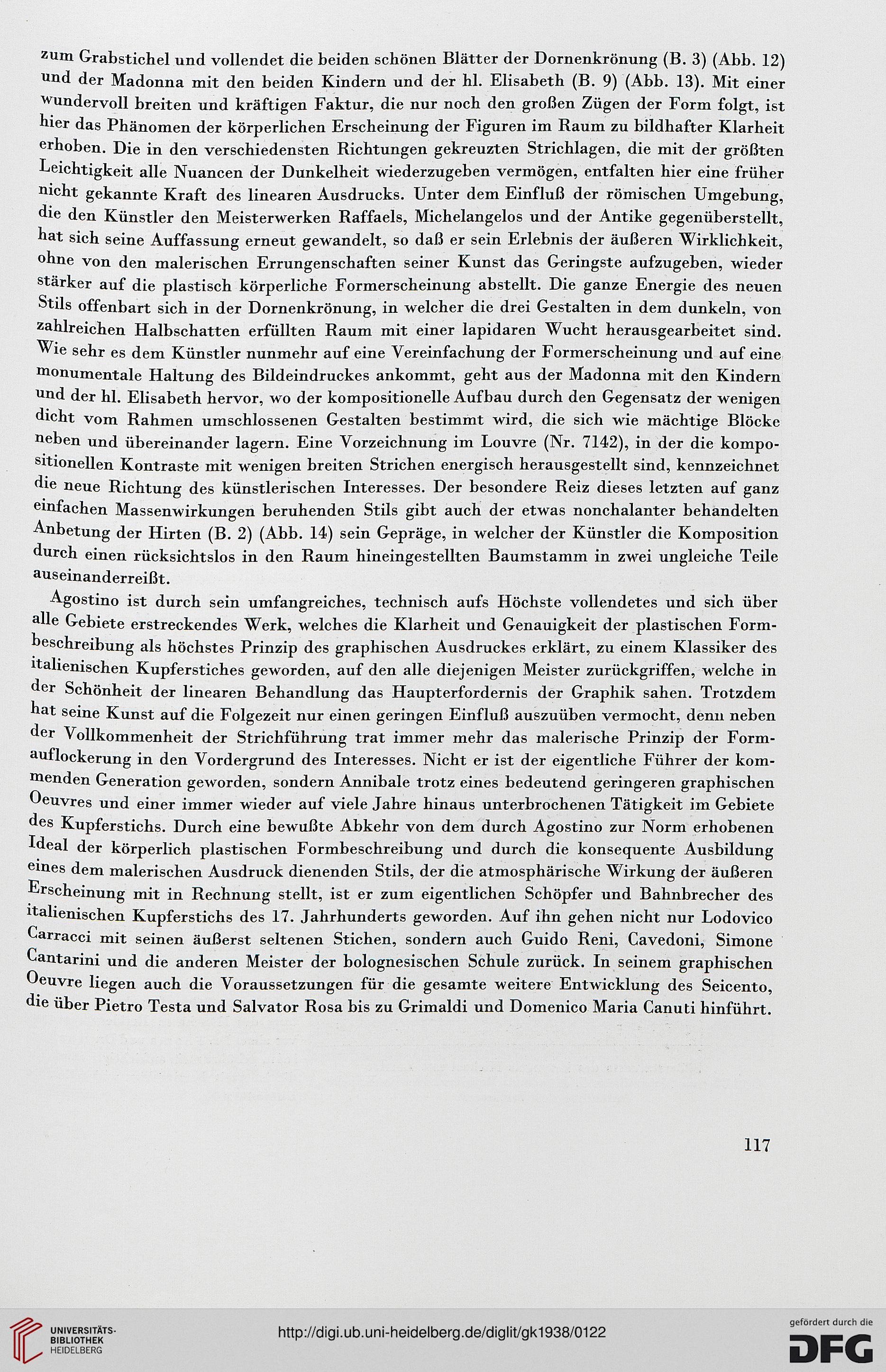zum Grabstichel und vollendet die beiden schönen Blätter der Dornenkrönung (B. 3) (Abb. 12)
und der Madonna mit den beiden Kindern und der hl. Elisabeth (B. 9) (Abb. 13). Mit einer
wundervoll breiten und kräftigen Faktur, die nur noch den großen Zügen der Form folgt, ist
hier das Phänomen der körperlichen Erscheinung der Figuren im Raum zu bildhafter Klarheit
erhoben. Die in den verschiedensten Richtungen gekreuzten Strichlagen, die mit der größten
Leichtigkeit alle Nuancen der Dunkelheit wiederzugeben vermögen, entfalten hier eine früher
nicht gekannte Kraft des linearen Ausdrucks. Unter dem Einfluß der römischen Umgebung,
die den Künstler den Meisterwerken Raffaels, Michelangelos und der Antike gegenüberstellt,
hat sich seine Auffassung erneut gewandelt, so daß er sein Erlebnis der äußeren Wirklichkeit,
ohne von den malerischen Errungenschaften seiner Kunst das Geringste aufzugeben, wieder
stärker auf die plastisch körperliche Formerscheinung abstellt. Die ganze Energie des neuen
Stils offenbart sich in der Dornenkrönung, in welcher die drei Gestalten in dem dunkeln, von
zahlreichen Halbschatten erfüllten Raum mit einer lapidaren Wucht herausgearbeitet sind.
Wie sehr es dem Künstler nunmehr auf eine Vereinfachung der Formerscheinung und auf eine
monumentale Haltung des Bildeindruckes ankommt, geht aus der Madonna mit den Kindern
und der hl. Elisabeth hervor, wo der kompositionelle Aufbau durch den Gegensatz der wenigen
dicht vom Rahmen umschlossenen Gestalten bestimmt wird, die sich wie mächtige Blöcke
neben und übereinander lagern. Eine Vorzeichnung im Louvre (Nr. 7142), in der die kompo-
sitionellen Kontraste mit wenigen breiten Strichen energisch herausgestellt sind, kennzeichnet
die neue Richtung des künstlerischen Interesses. Der besondere Reiz dieses letzten auf ganz
einfachen Massenwirkungen beruhenden Stils gibt auch der etwas nonchalanter behandelten
Anbetung der Hirten (B. 2) (Abb. 14) sein Gepräge, in welcher der Künstler die Komposition
durch einen rücksichtslos in den Raum hineingestellten Baumstamm in zwei ungleiche Teile
auseinanderreißt.
Agostino ist durch sein umfangreiches, technisch aufs Höchste vollendetes und sich über
alle Gebiete erstreckendes Werk, welches die Klarheit und Genauigkeit der plastischen Form-
heschreibung als höchstes Prinzip des graphischen Ausdruckes erklärt, zu einem Klassiker des
italienischen Kupferstiches geworden, auf den alle diejenigen Meister zurückgriffen, welche in
der Schönheit der linearen Behandlung das Haupterfordernis der Graphik sahen. Trotzdem
hat seine Kunst auf die Folgezeit nur einen geringen Einfluß auszuüben vermocht, denn neben
der Vollkommenheit der Strichführung trat immer mehr das malerische Prinzip der Form-
auflockerung in den Vordergrund des Interesses. Nicht er ist der eigentliche Führer der kom-
menden Generation geworden, sondern Annibale trotz eines bedeutend geringeren graphischen
Oeuvres und einer immer wieder auf viele Jahre hinaus unterbrochenen Tätigkeit im Gebiete
des Kupferstichs. Durch eine bewußte Abkehr von dem durch Agostino zur Norm erhobenen
Ideal der körperlich plastischen Formbeschreibung und durch die konsequente Ausbildung
eines dem malerischen Ausdruck dienenden Stils, der die atmosphärische Wirkung der äußeren
Erscheinung mit in Rechnung stellt, ist er zum eigentlichen Schöpfer und Bahnbrecher des
italienischen Kupferstichs des 17. Jahrhunderts geworden. Auf ihn gehen nicht nur Lodovico
Carracci mit seinen äußerst seltenen Stichen, sondern auch Guido Reni, Cavedoni, Simone
Cantarini und die anderen Meister der bolognesischen Schule zurück. In seinem graphischen
Oeuvre liegen auch die Voraussetzungen für die gesamte weitere Entwicklung des Seicento,
die über Pietro Testa und Salvator Rosa bis zu Grimaldi und Domenico Maria Canuti hinführt.
117
und der Madonna mit den beiden Kindern und der hl. Elisabeth (B. 9) (Abb. 13). Mit einer
wundervoll breiten und kräftigen Faktur, die nur noch den großen Zügen der Form folgt, ist
hier das Phänomen der körperlichen Erscheinung der Figuren im Raum zu bildhafter Klarheit
erhoben. Die in den verschiedensten Richtungen gekreuzten Strichlagen, die mit der größten
Leichtigkeit alle Nuancen der Dunkelheit wiederzugeben vermögen, entfalten hier eine früher
nicht gekannte Kraft des linearen Ausdrucks. Unter dem Einfluß der römischen Umgebung,
die den Künstler den Meisterwerken Raffaels, Michelangelos und der Antike gegenüberstellt,
hat sich seine Auffassung erneut gewandelt, so daß er sein Erlebnis der äußeren Wirklichkeit,
ohne von den malerischen Errungenschaften seiner Kunst das Geringste aufzugeben, wieder
stärker auf die plastisch körperliche Formerscheinung abstellt. Die ganze Energie des neuen
Stils offenbart sich in der Dornenkrönung, in welcher die drei Gestalten in dem dunkeln, von
zahlreichen Halbschatten erfüllten Raum mit einer lapidaren Wucht herausgearbeitet sind.
Wie sehr es dem Künstler nunmehr auf eine Vereinfachung der Formerscheinung und auf eine
monumentale Haltung des Bildeindruckes ankommt, geht aus der Madonna mit den Kindern
und der hl. Elisabeth hervor, wo der kompositionelle Aufbau durch den Gegensatz der wenigen
dicht vom Rahmen umschlossenen Gestalten bestimmt wird, die sich wie mächtige Blöcke
neben und übereinander lagern. Eine Vorzeichnung im Louvre (Nr. 7142), in der die kompo-
sitionellen Kontraste mit wenigen breiten Strichen energisch herausgestellt sind, kennzeichnet
die neue Richtung des künstlerischen Interesses. Der besondere Reiz dieses letzten auf ganz
einfachen Massenwirkungen beruhenden Stils gibt auch der etwas nonchalanter behandelten
Anbetung der Hirten (B. 2) (Abb. 14) sein Gepräge, in welcher der Künstler die Komposition
durch einen rücksichtslos in den Raum hineingestellten Baumstamm in zwei ungleiche Teile
auseinanderreißt.
Agostino ist durch sein umfangreiches, technisch aufs Höchste vollendetes und sich über
alle Gebiete erstreckendes Werk, welches die Klarheit und Genauigkeit der plastischen Form-
heschreibung als höchstes Prinzip des graphischen Ausdruckes erklärt, zu einem Klassiker des
italienischen Kupferstiches geworden, auf den alle diejenigen Meister zurückgriffen, welche in
der Schönheit der linearen Behandlung das Haupterfordernis der Graphik sahen. Trotzdem
hat seine Kunst auf die Folgezeit nur einen geringen Einfluß auszuüben vermocht, denn neben
der Vollkommenheit der Strichführung trat immer mehr das malerische Prinzip der Form-
auflockerung in den Vordergrund des Interesses. Nicht er ist der eigentliche Führer der kom-
menden Generation geworden, sondern Annibale trotz eines bedeutend geringeren graphischen
Oeuvres und einer immer wieder auf viele Jahre hinaus unterbrochenen Tätigkeit im Gebiete
des Kupferstichs. Durch eine bewußte Abkehr von dem durch Agostino zur Norm erhobenen
Ideal der körperlich plastischen Formbeschreibung und durch die konsequente Ausbildung
eines dem malerischen Ausdruck dienenden Stils, der die atmosphärische Wirkung der äußeren
Erscheinung mit in Rechnung stellt, ist er zum eigentlichen Schöpfer und Bahnbrecher des
italienischen Kupferstichs des 17. Jahrhunderts geworden. Auf ihn gehen nicht nur Lodovico
Carracci mit seinen äußerst seltenen Stichen, sondern auch Guido Reni, Cavedoni, Simone
Cantarini und die anderen Meister der bolognesischen Schule zurück. In seinem graphischen
Oeuvre liegen auch die Voraussetzungen für die gesamte weitere Entwicklung des Seicento,
die über Pietro Testa und Salvator Rosa bis zu Grimaldi und Domenico Maria Canuti hinführt.
117