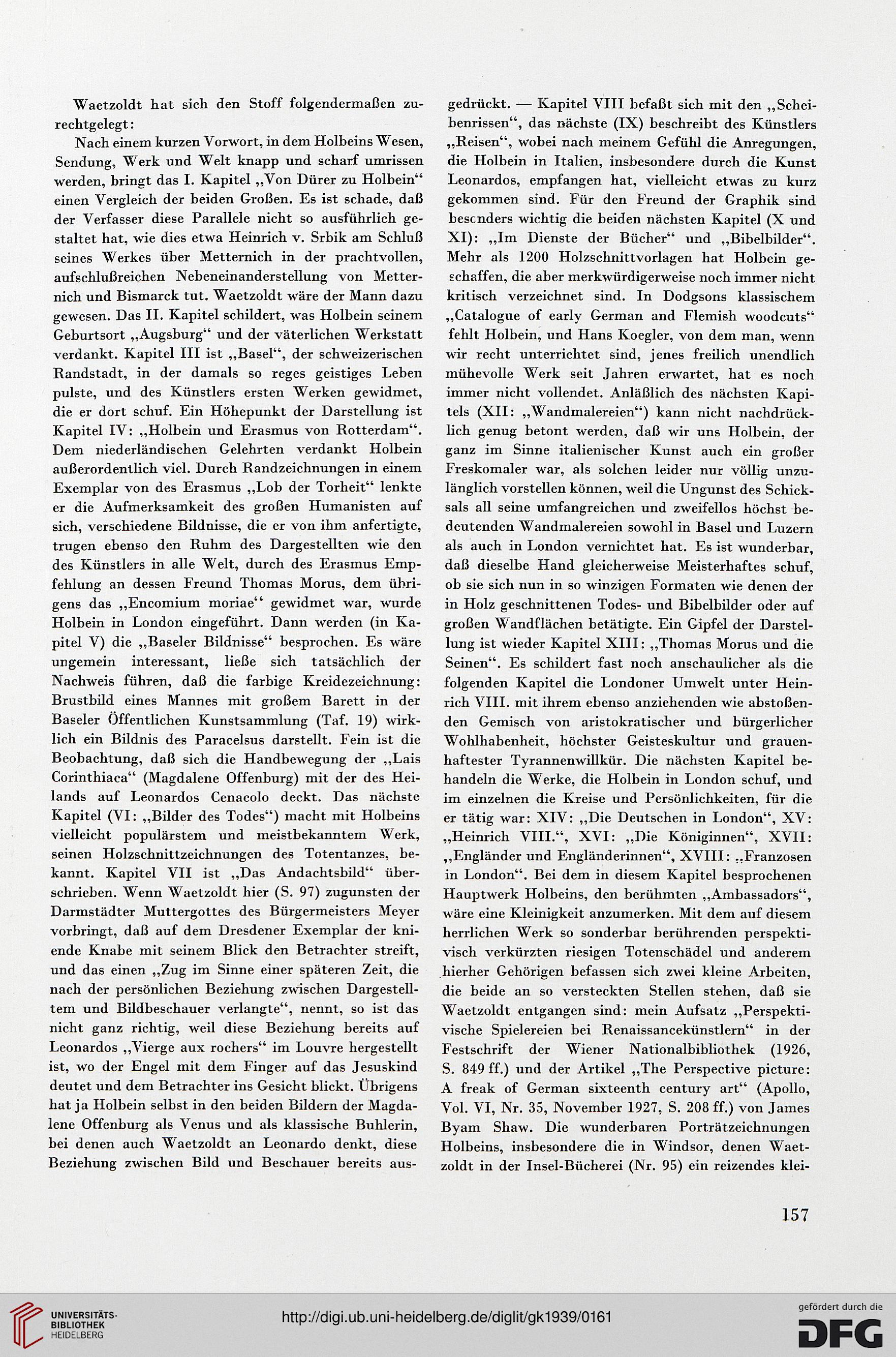Waetzoldt hat sich den Stoff folgendermaßen zu-
rechtgelegt :
Nach einem kurzen Vorwort, in dem Holbeins Wesen,
Sendung, Werk und Welt knapp und scharf umrissen
werden, bringt das I. Kapitel „Von Dürer zu Holbein"
einen Vergleich der beiden Großen. Es ist schade, daß
der Verfasser diese Parallele nicht so ausführlich ge-
staltet hat, wie dies etwa Heinrich v. Srbik am Schluß
seines Werkes über Metternich in der prachtvollen,
aufschlußreichen Nebeneinanderstellung von Metter-
nich und Bismarck tut. Waetzoldt wäre der Mann dazu
gewesen. Das II. Kapitel schildert, was Holbein seinem
Geburtsort „Augsburg" und der väterlichen Werkstatt
verdankt. Kapitel III ist „Basel", der schweizerischen
Randstadt, in der damals so reges geistiges Leben
pulste, und des Künstlers ersten Werken gewidmet,
die er dort schuf. Ein Höhepunkt der Darstellung ist
Kapitel IV: „Holbein und Erasmus von Rotterdam".
Dem niederländischen Gelehrten verdankt Holbein
außerordentlich viel. Durch Randzeichnungen in einem
Exemplar von des Erasmus „Lob der Torheit" lenkte
er die Aufmerksamkeit des großen Humanisten auf
sich, verschiedene Bildnisse, die er von ihm anfertigte,
trugen ebenso den Ruhm des Dargestellten wie den
des Künstlers in alle Welt, durch des Erasmus Emp-
fehlung an dessen Freund Thomas Morus, dem übri-
gens das „Encomium moriae" gewidmet war, wurde
Holbein in London eingeführt. Dann werden (in Ka-
pitel V) die „Baseler Bildnisse" besprochen. Es wäre
ungemein interessant, ließe sich tatsächlich der
Nachweis führen, daß die farbige Kreidezeichnung:
Brustbild eines Mannes mit großem Barett in der
Baseler Öffentlichen Kunstsammlung (Taf. 19) wirk-
lich ein Bildnis des Paracelsus darstellt. Fein ist die
Beobachtung, daß sich die Handbewegung der „Lais
Corinthiaca" (Magdalene Offenburg) mit der des Hei-
lands auf Leonardos Cenacolo deckt. Das nächste
Kapitel (VI: „Bilder des Todes") macht mit Holbeins
vielleicht populärstem und meistbekanntem Werk,
seinen Holzschnittzeichnungen des Totentanzes, be-
kannt. Kapitel VII ist „Das Andachtsbild" über-
schrieben. Wenn Waetzoldt hier (S. 97) zugunsten der
Darmstädter Muttergottes des Bürgermeisters Meyer
vorbringt, daß auf dem Dresdener Exemplar der kni-
ende Knabe mit seinem Blick den Betrachter streift,
und das einen „Zug im Sinne einer späteren Zeit, die
nach der persönlichen Beziehung zwischen Dargestell-
tem und Bildbeschauer verlangte", nennt, so ist das
nicht ganz richtig, weil diese Beziehung bereits auf
Leonardos „Vierge aux rochers" im Louvre hergestellt
ist, wo der Engel mit dem Finger auf das Jesuskind
deutet und dem Betrachter ins Gesicht blickt. Übrigens
hat ja Holbein selbst in den beiden Bildern der Magda-
lene Offenburg als Venus und als klassische Buhlerin,
bei denen auch Waetzoldt an Leonardo denkt, diese
Beziehung zwischen Bild und Beschauer bereits aus-
gedrückt. — Kapitel VIII befaßt sich mit den „Schei-
benrissen", das nächste (IX) beschreibt des Künstlers
„Reisen", wobei nach meinem Gefühl die Anregungen,
die Holbein in Italien, insbesondere durch die Kunst
Leonardos, empfangen hat, vielleicht etwas zu kurz
gekommen sind. Für den Freund der Graphik sind
besenders wichtig die beiden nächsten Kapitel (X und
XI): „Im Dienste der Bücher" und „Bibelbilder".
Mehr als 1200 Holzschnittvorlagen hat Holbein ge-
schaffen, die aber merkwürdigerweise noch immer nicht
kritisch verzeichnet sind. In Dodgsons klassischem
„Catalogue of early German and Flemish woodeuts"
fehlt Holbein, und Hans Koegler, von dem man, wenn
wir recht unterrichtet sind, jenes freilich unendlich
mühevolle Werk seit Jahren erwartet, hat es noch
immer nicht vollendet. Anläßlich des nächsten Kapi-
tels (XII: „Wandmalereien") kann nicht nachdrück-
lich genug betont werden, daß wir uns Holbein, der
ganz im Sinne italienischer Kunst auch ein großer
Freskomaler war, als solchen leider nur völlig unzu-
länglich vorstellen können, weil die Ungunst des Schick-
sals all seine umfangreichen und zweifellos höchst be-
deutenden Wandmalereien sowohl in Basel und Luzern
als auch in London vernichtet hat. Es ist wunderbar,
daß dieselbe Hand gleicherweise Meisterhaftes schuf,
ob sie sich nun in so winzigen Formaten wie denen der
in Holz geschnittenen Todes- und Bibelbilder oder auf
großen Wandflächen betätigte. Ein Gipfel der Darstel-
lung ist wieder Kapitel XIII: „Thomas Morus und die
Seinen". Es schildert fast noch anschaulicher als die
folgenden Kapitel die Londoner Umwelt unter Hein-
rich VIII. mit ihrem ebenso anziehenden wie abstoßen-
den Gemisch von aristokratischer und bürgerlicher
Wohlhabenheit, höchster Geisteskultur und grauen-
haftester Tyrannenwillkür. Die nächsten Kapitel be-
handeln die Werke, die Holbein in London schuf, und
im einzelnen die Kreise und Persönlichkeiten, für die
er tätig war: XIV: „Die Deutschen in London", XV:
„Heinrich VIII.", XVI: „Die Königinnen", XVII:
,,Engländer und Engländerinnen", XVIII: „Franzosen
in London". Bei dem in diesem Kapitel besprochenen
Hauptwerk Holbeins, den berühmten „Ambassadors",
wäre eine Kleinigkeit anzumerken. Mit dem auf diesem
herrlichen Werk so sonderbar berührenden perspekti-
visch verkürzten riesigen Totenschädel und anderem
hierher Gehörigen befassen sich zwei kleine Arbeiten,
die beide an so versteckten Stellen stehen, daß sie
Waetzoldt entgangen sind: mein Aufsatz „Perspekti-
vische Spielereien bei Renaissancekünstlern" in der
Festschrift der Wiener Nationalbibliothek (1926,
S. 849 ff.) und der Artikel „The Perspective picture:
A freak of German sixteenth Century art" (Apollo,
Vol. VI, Nr. 35, November 1927, S. 208 ff.) von James
Byam Shaw. Die wunderbaren Porträtzeichnungen
Holbeins, insbesondere die in Windsor, denen Waet-
zoldt in der Insel-Bücherei (Nr. 95) ein reizendes klei-
157
rechtgelegt :
Nach einem kurzen Vorwort, in dem Holbeins Wesen,
Sendung, Werk und Welt knapp und scharf umrissen
werden, bringt das I. Kapitel „Von Dürer zu Holbein"
einen Vergleich der beiden Großen. Es ist schade, daß
der Verfasser diese Parallele nicht so ausführlich ge-
staltet hat, wie dies etwa Heinrich v. Srbik am Schluß
seines Werkes über Metternich in der prachtvollen,
aufschlußreichen Nebeneinanderstellung von Metter-
nich und Bismarck tut. Waetzoldt wäre der Mann dazu
gewesen. Das II. Kapitel schildert, was Holbein seinem
Geburtsort „Augsburg" und der väterlichen Werkstatt
verdankt. Kapitel III ist „Basel", der schweizerischen
Randstadt, in der damals so reges geistiges Leben
pulste, und des Künstlers ersten Werken gewidmet,
die er dort schuf. Ein Höhepunkt der Darstellung ist
Kapitel IV: „Holbein und Erasmus von Rotterdam".
Dem niederländischen Gelehrten verdankt Holbein
außerordentlich viel. Durch Randzeichnungen in einem
Exemplar von des Erasmus „Lob der Torheit" lenkte
er die Aufmerksamkeit des großen Humanisten auf
sich, verschiedene Bildnisse, die er von ihm anfertigte,
trugen ebenso den Ruhm des Dargestellten wie den
des Künstlers in alle Welt, durch des Erasmus Emp-
fehlung an dessen Freund Thomas Morus, dem übri-
gens das „Encomium moriae" gewidmet war, wurde
Holbein in London eingeführt. Dann werden (in Ka-
pitel V) die „Baseler Bildnisse" besprochen. Es wäre
ungemein interessant, ließe sich tatsächlich der
Nachweis führen, daß die farbige Kreidezeichnung:
Brustbild eines Mannes mit großem Barett in der
Baseler Öffentlichen Kunstsammlung (Taf. 19) wirk-
lich ein Bildnis des Paracelsus darstellt. Fein ist die
Beobachtung, daß sich die Handbewegung der „Lais
Corinthiaca" (Magdalene Offenburg) mit der des Hei-
lands auf Leonardos Cenacolo deckt. Das nächste
Kapitel (VI: „Bilder des Todes") macht mit Holbeins
vielleicht populärstem und meistbekanntem Werk,
seinen Holzschnittzeichnungen des Totentanzes, be-
kannt. Kapitel VII ist „Das Andachtsbild" über-
schrieben. Wenn Waetzoldt hier (S. 97) zugunsten der
Darmstädter Muttergottes des Bürgermeisters Meyer
vorbringt, daß auf dem Dresdener Exemplar der kni-
ende Knabe mit seinem Blick den Betrachter streift,
und das einen „Zug im Sinne einer späteren Zeit, die
nach der persönlichen Beziehung zwischen Dargestell-
tem und Bildbeschauer verlangte", nennt, so ist das
nicht ganz richtig, weil diese Beziehung bereits auf
Leonardos „Vierge aux rochers" im Louvre hergestellt
ist, wo der Engel mit dem Finger auf das Jesuskind
deutet und dem Betrachter ins Gesicht blickt. Übrigens
hat ja Holbein selbst in den beiden Bildern der Magda-
lene Offenburg als Venus und als klassische Buhlerin,
bei denen auch Waetzoldt an Leonardo denkt, diese
Beziehung zwischen Bild und Beschauer bereits aus-
gedrückt. — Kapitel VIII befaßt sich mit den „Schei-
benrissen", das nächste (IX) beschreibt des Künstlers
„Reisen", wobei nach meinem Gefühl die Anregungen,
die Holbein in Italien, insbesondere durch die Kunst
Leonardos, empfangen hat, vielleicht etwas zu kurz
gekommen sind. Für den Freund der Graphik sind
besenders wichtig die beiden nächsten Kapitel (X und
XI): „Im Dienste der Bücher" und „Bibelbilder".
Mehr als 1200 Holzschnittvorlagen hat Holbein ge-
schaffen, die aber merkwürdigerweise noch immer nicht
kritisch verzeichnet sind. In Dodgsons klassischem
„Catalogue of early German and Flemish woodeuts"
fehlt Holbein, und Hans Koegler, von dem man, wenn
wir recht unterrichtet sind, jenes freilich unendlich
mühevolle Werk seit Jahren erwartet, hat es noch
immer nicht vollendet. Anläßlich des nächsten Kapi-
tels (XII: „Wandmalereien") kann nicht nachdrück-
lich genug betont werden, daß wir uns Holbein, der
ganz im Sinne italienischer Kunst auch ein großer
Freskomaler war, als solchen leider nur völlig unzu-
länglich vorstellen können, weil die Ungunst des Schick-
sals all seine umfangreichen und zweifellos höchst be-
deutenden Wandmalereien sowohl in Basel und Luzern
als auch in London vernichtet hat. Es ist wunderbar,
daß dieselbe Hand gleicherweise Meisterhaftes schuf,
ob sie sich nun in so winzigen Formaten wie denen der
in Holz geschnittenen Todes- und Bibelbilder oder auf
großen Wandflächen betätigte. Ein Gipfel der Darstel-
lung ist wieder Kapitel XIII: „Thomas Morus und die
Seinen". Es schildert fast noch anschaulicher als die
folgenden Kapitel die Londoner Umwelt unter Hein-
rich VIII. mit ihrem ebenso anziehenden wie abstoßen-
den Gemisch von aristokratischer und bürgerlicher
Wohlhabenheit, höchster Geisteskultur und grauen-
haftester Tyrannenwillkür. Die nächsten Kapitel be-
handeln die Werke, die Holbein in London schuf, und
im einzelnen die Kreise und Persönlichkeiten, für die
er tätig war: XIV: „Die Deutschen in London", XV:
„Heinrich VIII.", XVI: „Die Königinnen", XVII:
,,Engländer und Engländerinnen", XVIII: „Franzosen
in London". Bei dem in diesem Kapitel besprochenen
Hauptwerk Holbeins, den berühmten „Ambassadors",
wäre eine Kleinigkeit anzumerken. Mit dem auf diesem
herrlichen Werk so sonderbar berührenden perspekti-
visch verkürzten riesigen Totenschädel und anderem
hierher Gehörigen befassen sich zwei kleine Arbeiten,
die beide an so versteckten Stellen stehen, daß sie
Waetzoldt entgangen sind: mein Aufsatz „Perspekti-
vische Spielereien bei Renaissancekünstlern" in der
Festschrift der Wiener Nationalbibliothek (1926,
S. 849 ff.) und der Artikel „The Perspective picture:
A freak of German sixteenth Century art" (Apollo,
Vol. VI, Nr. 35, November 1927, S. 208 ff.) von James
Byam Shaw. Die wunderbaren Porträtzeichnungen
Holbeins, insbesondere die in Windsor, denen Waet-
zoldt in der Insel-Bücherei (Nr. 95) ein reizendes klei-
157