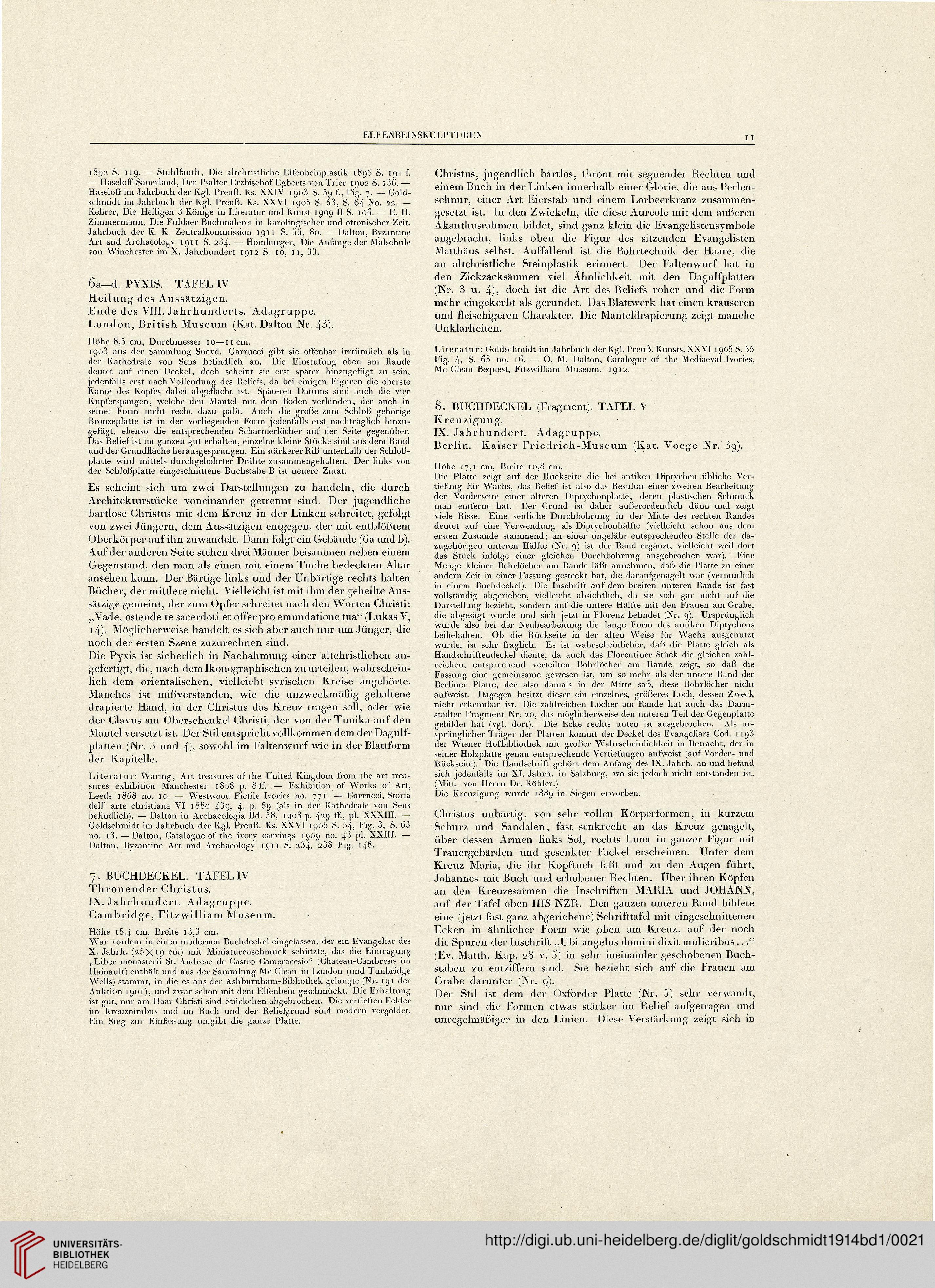ELFENBEINSKULPTUREN
1892 S. 119. — Stuhlfauth, Die altchristliche Elfenbeinplastik 1896 S. 191 f.
— Haseloff-Sauerland, Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier 1902 S. 136. —
Haseloff im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Ks. XXIV 19113 S. 59 f., Fig. 7. — Gold-
scbmidt im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Ks. XXVI igo5 S. 53, S. 64 No. 22. —
Kehrer, Die Heiligen 3 Könige in Literatur und Kunst 1909 II S. 106. — E. H.
Zimmermann. Die Fuldaer Buchmalerei in karolingischer und ottonischer Zeit.
Jahrbuch der K. K. Zentralkommission 1911 S. 55, 80. — Dalton, Byzantine
Art and Archaeology 1911 S. 234- — Homburger, Die Anfänge der Malschule
von Winchester im X. Jahrhundert 1912 S. 10, 11, 33.
6a—d. PYXIS. TAFEL IV
Heilung des Aussätzigen.
Ende des VIII. Jahrhunderts. Adagruppe.
London, British Museum (Kat. Dalton Nr. 43).
Höhe 8,5 cm, Durchmesser 10—11 cm.
1903 aus der Sammlung Sneyd. Garrucci gibt sie offenbar irrtümlich als in
der Kathedrale von Sens befindlich an. Die Einstufung oben am Rande
deutet auf einen Deckel, doch scheint sie erst später hinzugefügt zu sein,
jedenfalls erst nach Vollendung des Reliefs, da bei einigen Figuren die oberste
Kante des Kopfes dabei abgeflacht ist. Späteren Datums sind auch die vier
Kupferspangen, welche den Mantel mit dem Boden verbinden, der auch in
seiner Form nicht recht dazu paßt. Auch die große zum Schloß gehörige
Bronzeplatte ist in der vorliegenden Form jedenfalls erst nachträglich hinzu-
gefügt, ebenso die entsprechenden Scharnierlöcher auf der Seite gegenüber.
Das Belief ist im ganzen gut erhalten, einzelne kleine Stücke sind aus dem Rand
und der Grundfläche herausgesprungen. Ein stärkerer Riß unterhalb der Schloß-
platte wird mittels durchgebohrter Drähte zusammengehalten. Der links von
der Schloßplatte eingeschnittene Buchstabe B ist neuere Zutat.
Es scheint sich um zwei Darstellungen zu handeln, die durch
Architekturstücke voneinander getrennt sind. Der jugendliche
hartlose Christus mit dem Kreuz in der Linken schreitet, gefolgt
von zwei Jüngern, dem Aussätzigen entgegen, der mit entblößtem
Oberkörper auf ihn zuwandelt. Dann folgt ein Gebäude (6 a und b).
Auf der anderen Seite stehen drei Männer beisammen neben einem
Gegenstand, den man als einen mit einem Tuche bedeckten Altar
ansehen kann. Der Bärtige links und der Unbärtige rechts halten
Bücher, der mittlere nicht. Vielleicht ist mit ihm der geheilte Aus-
sätzige gemeint, der zum Opfer schreitet nach den Worten Christi:
„Vade, ostende te sacerdoti et offer pro emundatione tua" (Lukas V,
i4). Möglicherweise handelt es sich aber auch nur um Jünger, die
noch der ersten Szene zuzurechnen sind.
Die Pyxis ist sicherlich in Nachahmung einer altchristlichen an-
gefertigt, die, nach dem Ikonographischen zu urteilen, wahrschein-
lich dem orientalischen, vielleicht syrischen Kreise angehörte.
Manches ist mißverstanden, wie die unzweckmäßig gehaltene
drapierte Hand, in der Christus das Kreuz tragen soll, oder wie
der Clavus am Oberschenkel Christi, der von der Tunika auf den
Mantel versetzt ist. Der Stil entspricht vollkommen dem der Dagulf-
platten (Nr. 3 und 4), sowohl im Faltenwurf wie in der Blattform
der Kapitelle.
Literatur: Waring, Art treasures of tbe United Kingdom from the art trea-
sures exhibition Manchester 1858 p. 8 ff. — Exhibition of Works of Art,
Leeds 1868 no. 10. — Westwood Fictile Ivories 110. 771. — Garrucci, Storia
dell' arte christiana VI 1880 4^9, 4, p- 5g (als in der Kathedrale von Sens
befindlich). — Dalton in Archaeologia Bd. 58, 1903 p. 4?-9 ff-, pl- XXXIII. —
Goldschmidt im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Ks. XXVI 1905 S. 54, Fig. 3, S. 63
no. i3. — Dalton, Catalogue of the ivory carvings 1909 110. 43 pl- XXIII. —
Dalton, Byzantine Art and Archaeology 1911 S. 234, 2^8 Fig. 148.
7. BUCHDECKEL. TAFEL IV
Thronender Christus.
IX. Jahrhundert. Adagruppe.
Cambridge, Fitzwilliam Museum.
Höhe 15,4 cm, Breite 13,3 cm.
War vordem in einen modernen Buchdeckel eingelassen, der ein Evangeliar des
X. Jahrh. (2.5Xi9 cm) mit Miniaturenschmuck schützte, das die Eintragung
„Liber monasterii St. Andreae de Castro Cameracesio" (Chateau-Cambresis im
Hainault) enthält und aus der Sammlung Mc Clean in London (und Tunbridge
Wells) stammt, in die es aus der Ashburnham-Bibliothek gelangte (Nr. 191 der
Auktion 1901), und zwar schon mit dem Elfenbein geschmückt. Die Erhaltung
ist gut, nur am Haar Christi sind Stückchen abgebrochen. Die vertieften Felder
im Kreuznimbus und im Buch und der Reliefgrund sind modern vergoldet.
Ein Steg zur Einfassung umgibt die ganze Platte.
Christus, jugendlich bartlos, thront mit segnender Beeilten and
einem Buch in der Linken innerhalb einer Glorie, die aus Perlen-
schnur, einer Art Eierstab und einem Lorbeerkranz zusammen-
gesetzt ist. In den ZAvickeln, die diese Aureole mit dem äußeren
Akanthusrahmen bildet, sind ganz klein die Evangelistensymbole
angebracht, links oben die Figur des sitzenden Evangelisten
Matthäus selbst. Auffallend ist die Bohrtechnik der Haare, die
an altchristliche Steinplastik erinnert. Der Faltenwurf hat in
den Zickzacksäumen viel Ähnlichkeit mit den Dagulfplatten
(Nr. 3 u. 4)? doch ist die Art des Beliefs roher und die Form
mehr eingekerbt als gerundet. Das Blattwerk hat einen krauseren
und fleischigeren Charakter. Die Manteldrapierung zeigt manche
Unklarheiten.
Literatur: Goldschmidt im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Kunsts. XXVI 19öS S. 55
Fig. l\, S. 63 no. 16. — O. M. Dalton, Catalogue of the Mediaeval Ivories,
Mc Clean Bequest, Fitzwilliam Museum. 1912.
8. BUCHDECKEL (Fragment). TAFEL V
Kreuzigung.
IX. Jahrhundert. Adagruppe.
Berlin. Kaiser Friedrich-Museum (Kat. Voege Nr. 39).
Höhe 17,1 cm, Breite 10,8 cm.
Die Platte zeigt auf der Rückseite die bei antiken Diptychen übliche Ver-
tiefung für Wachs, das Relief ist also das Resultat einer zweiten Bearbeitung
der Vorderseite einer älteren Diptychonplatte, deren plastischen Schmuck
man entfernt hat. Der Grund ist daher außerordentlich dünn und zeigt
viele Bisse. Eine seitliche Durchbohrung in der Mitte des rechten Bandes
deutet auf eine Verwendung als Diptychonhälfte (vielleicht schon aus dem
ersten Zustande stammend; an einer ungefähr entsprechenden Stelle der da-
zugehörigen unteren Hälfte (Nr. 9) ist der Band ergänzt, vielleicht weil dort
das Stück infolge einer gleichen Durchbohrung ausgebrochen war). Eine
Menge kleiner Bohrlöcher am Bande läßt annehmen, daß die Platte zu einer
andern Zeit in einer Fassung gesteckt hat, die daraufgenagelt war (vermutlich
in einem Buchdeckel). Die Inschrift auf dem breiten unteren Rande ist fast
vollständig abgerieben, vielleicht absichtlich, da sie sich gar nicht auf die
Darstellung bezieht, sondern auf die untere Hälfte mit den Frauen am Grabe,
die abgesägt wurde und sich jetzt in Florenz befindet (Nr. 9). Ursprünglich
wurde also bei der Neubearbeitung die lange Form des antiken Diptychons
beibehalten. Ob die Rückseite in der alten Weise für Wachs ausgenutzt
wurde, ist sehr fraglich. Es ist wahrscheinlicher, daß die Platte gleich als
Handschriftendeckel diente, da auch das Florentiner Stück die gleichen zahl-
reichen, entsprechend verteilten Bohrlöcher am Rande zeigt, so daß die
Fassung eine gemeinsame gewesen ist, um so mehr als der untere Rand der
Berliner Platte, der also damals in der Mitte saß, diese Bohrlöcher nicht
aufweist. Dagegen besitzt dieser ein einzelnes, größeres Loch, dessen Zweck
nicht erkennbar ist. Die zahlreichen Löcher am Rande hat auch das Darm-
städter Fragment Nr. 20, das möglicherweise den unteren Teil der Gegenplatte
gebildet hat (vgl. dort). Die Ecke rechts unten ist ausgebrochen. Als ur-
sprünglicher Träger der Platten kommt der Deckel des Evangeliars Cod. Iig3
der Wiener Hofbibliothek mit großer Wahrscheinlichkeit in Betracht, der in
seiner Holzplatte genau entsprechende Vertiefungen aufweist (auf Vorder- und
Rückseite). Die Handschrift gehört dem Anfang des IX. Jahrh. an und befand
sich jedenfalls im XI. Jahrh. in Salzburg, wo sie jedoch nicht entstanden ist.
(Mitt. von Herrn Dr. Köhler.)
Die Kreuzigung wurde 1889 in Siegen erworben.
Christus unbärtig, von sehr vollen Körperformen, in kurzem
Schurz und Sandalen, fast senkrecht an das Kreuz genagelt,
über dessen Armen links Sol, rechts Luna in ganzer Figur mit
Trauergebärden und gesenkter Fackel erscheinen. Unter dem
Kreuz Maria, die ihr Kopftuch faßt und zu den Augen führt,
Johannes mit Buch und erhobener Hechten. Über ihren Köpfen
an den Kreuzesarmen die Inschriften MABIA und JOHANN,
auf der Tafel oben IHS NZR. Den ganzen unteren Rand bildete
eine (jetzt fast ganz abgeriebene) Schrifttafel mit eingeschnittenen
Ecken in ähnlicher Form wie .oben am Kreuz, auf der noch
die Spuren der Inschrift ,,Ubi angelus domini dixit mulieribus ..."
(Ev. Matth. Kap. 28 v. 5) in sehr ineinander geschobenen Buch-
staben zu entziffern sind. Sie bezieht sich auf die Frauen am
Grabe darunter (Nr. 9).
Der Stil ist dem der Oxforder Platte (Nr. 5) sehr verwandt,
nur sind die Formen etwas starker im Belief aufgetragen und
unregelmäßiger in den Linien. Diese Verstärkung zeigt sich in
1892 S. 119. — Stuhlfauth, Die altchristliche Elfenbeinplastik 1896 S. 191 f.
— Haseloff-Sauerland, Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier 1902 S. 136. —
Haseloff im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Ks. XXIV 19113 S. 59 f., Fig. 7. — Gold-
scbmidt im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Ks. XXVI igo5 S. 53, S. 64 No. 22. —
Kehrer, Die Heiligen 3 Könige in Literatur und Kunst 1909 II S. 106. — E. H.
Zimmermann. Die Fuldaer Buchmalerei in karolingischer und ottonischer Zeit.
Jahrbuch der K. K. Zentralkommission 1911 S. 55, 80. — Dalton, Byzantine
Art and Archaeology 1911 S. 234- — Homburger, Die Anfänge der Malschule
von Winchester im X. Jahrhundert 1912 S. 10, 11, 33.
6a—d. PYXIS. TAFEL IV
Heilung des Aussätzigen.
Ende des VIII. Jahrhunderts. Adagruppe.
London, British Museum (Kat. Dalton Nr. 43).
Höhe 8,5 cm, Durchmesser 10—11 cm.
1903 aus der Sammlung Sneyd. Garrucci gibt sie offenbar irrtümlich als in
der Kathedrale von Sens befindlich an. Die Einstufung oben am Rande
deutet auf einen Deckel, doch scheint sie erst später hinzugefügt zu sein,
jedenfalls erst nach Vollendung des Reliefs, da bei einigen Figuren die oberste
Kante des Kopfes dabei abgeflacht ist. Späteren Datums sind auch die vier
Kupferspangen, welche den Mantel mit dem Boden verbinden, der auch in
seiner Form nicht recht dazu paßt. Auch die große zum Schloß gehörige
Bronzeplatte ist in der vorliegenden Form jedenfalls erst nachträglich hinzu-
gefügt, ebenso die entsprechenden Scharnierlöcher auf der Seite gegenüber.
Das Belief ist im ganzen gut erhalten, einzelne kleine Stücke sind aus dem Rand
und der Grundfläche herausgesprungen. Ein stärkerer Riß unterhalb der Schloß-
platte wird mittels durchgebohrter Drähte zusammengehalten. Der links von
der Schloßplatte eingeschnittene Buchstabe B ist neuere Zutat.
Es scheint sich um zwei Darstellungen zu handeln, die durch
Architekturstücke voneinander getrennt sind. Der jugendliche
hartlose Christus mit dem Kreuz in der Linken schreitet, gefolgt
von zwei Jüngern, dem Aussätzigen entgegen, der mit entblößtem
Oberkörper auf ihn zuwandelt. Dann folgt ein Gebäude (6 a und b).
Auf der anderen Seite stehen drei Männer beisammen neben einem
Gegenstand, den man als einen mit einem Tuche bedeckten Altar
ansehen kann. Der Bärtige links und der Unbärtige rechts halten
Bücher, der mittlere nicht. Vielleicht ist mit ihm der geheilte Aus-
sätzige gemeint, der zum Opfer schreitet nach den Worten Christi:
„Vade, ostende te sacerdoti et offer pro emundatione tua" (Lukas V,
i4). Möglicherweise handelt es sich aber auch nur um Jünger, die
noch der ersten Szene zuzurechnen sind.
Die Pyxis ist sicherlich in Nachahmung einer altchristlichen an-
gefertigt, die, nach dem Ikonographischen zu urteilen, wahrschein-
lich dem orientalischen, vielleicht syrischen Kreise angehörte.
Manches ist mißverstanden, wie die unzweckmäßig gehaltene
drapierte Hand, in der Christus das Kreuz tragen soll, oder wie
der Clavus am Oberschenkel Christi, der von der Tunika auf den
Mantel versetzt ist. Der Stil entspricht vollkommen dem der Dagulf-
platten (Nr. 3 und 4), sowohl im Faltenwurf wie in der Blattform
der Kapitelle.
Literatur: Waring, Art treasures of tbe United Kingdom from the art trea-
sures exhibition Manchester 1858 p. 8 ff. — Exhibition of Works of Art,
Leeds 1868 no. 10. — Westwood Fictile Ivories 110. 771. — Garrucci, Storia
dell' arte christiana VI 1880 4^9, 4, p- 5g (als in der Kathedrale von Sens
befindlich). — Dalton in Archaeologia Bd. 58, 1903 p. 4?-9 ff-, pl- XXXIII. —
Goldschmidt im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Ks. XXVI 1905 S. 54, Fig. 3, S. 63
no. i3. — Dalton, Catalogue of the ivory carvings 1909 110. 43 pl- XXIII. —
Dalton, Byzantine Art and Archaeology 1911 S. 234, 2^8 Fig. 148.
7. BUCHDECKEL. TAFEL IV
Thronender Christus.
IX. Jahrhundert. Adagruppe.
Cambridge, Fitzwilliam Museum.
Höhe 15,4 cm, Breite 13,3 cm.
War vordem in einen modernen Buchdeckel eingelassen, der ein Evangeliar des
X. Jahrh. (2.5Xi9 cm) mit Miniaturenschmuck schützte, das die Eintragung
„Liber monasterii St. Andreae de Castro Cameracesio" (Chateau-Cambresis im
Hainault) enthält und aus der Sammlung Mc Clean in London (und Tunbridge
Wells) stammt, in die es aus der Ashburnham-Bibliothek gelangte (Nr. 191 der
Auktion 1901), und zwar schon mit dem Elfenbein geschmückt. Die Erhaltung
ist gut, nur am Haar Christi sind Stückchen abgebrochen. Die vertieften Felder
im Kreuznimbus und im Buch und der Reliefgrund sind modern vergoldet.
Ein Steg zur Einfassung umgibt die ganze Platte.
Christus, jugendlich bartlos, thront mit segnender Beeilten and
einem Buch in der Linken innerhalb einer Glorie, die aus Perlen-
schnur, einer Art Eierstab und einem Lorbeerkranz zusammen-
gesetzt ist. In den ZAvickeln, die diese Aureole mit dem äußeren
Akanthusrahmen bildet, sind ganz klein die Evangelistensymbole
angebracht, links oben die Figur des sitzenden Evangelisten
Matthäus selbst. Auffallend ist die Bohrtechnik der Haare, die
an altchristliche Steinplastik erinnert. Der Faltenwurf hat in
den Zickzacksäumen viel Ähnlichkeit mit den Dagulfplatten
(Nr. 3 u. 4)? doch ist die Art des Beliefs roher und die Form
mehr eingekerbt als gerundet. Das Blattwerk hat einen krauseren
und fleischigeren Charakter. Die Manteldrapierung zeigt manche
Unklarheiten.
Literatur: Goldschmidt im Jahrbuch der Kgl. Preuß. Kunsts. XXVI 19öS S. 55
Fig. l\, S. 63 no. 16. — O. M. Dalton, Catalogue of the Mediaeval Ivories,
Mc Clean Bequest, Fitzwilliam Museum. 1912.
8. BUCHDECKEL (Fragment). TAFEL V
Kreuzigung.
IX. Jahrhundert. Adagruppe.
Berlin. Kaiser Friedrich-Museum (Kat. Voege Nr. 39).
Höhe 17,1 cm, Breite 10,8 cm.
Die Platte zeigt auf der Rückseite die bei antiken Diptychen übliche Ver-
tiefung für Wachs, das Relief ist also das Resultat einer zweiten Bearbeitung
der Vorderseite einer älteren Diptychonplatte, deren plastischen Schmuck
man entfernt hat. Der Grund ist daher außerordentlich dünn und zeigt
viele Bisse. Eine seitliche Durchbohrung in der Mitte des rechten Bandes
deutet auf eine Verwendung als Diptychonhälfte (vielleicht schon aus dem
ersten Zustande stammend; an einer ungefähr entsprechenden Stelle der da-
zugehörigen unteren Hälfte (Nr. 9) ist der Band ergänzt, vielleicht weil dort
das Stück infolge einer gleichen Durchbohrung ausgebrochen war). Eine
Menge kleiner Bohrlöcher am Bande läßt annehmen, daß die Platte zu einer
andern Zeit in einer Fassung gesteckt hat, die daraufgenagelt war (vermutlich
in einem Buchdeckel). Die Inschrift auf dem breiten unteren Rande ist fast
vollständig abgerieben, vielleicht absichtlich, da sie sich gar nicht auf die
Darstellung bezieht, sondern auf die untere Hälfte mit den Frauen am Grabe,
die abgesägt wurde und sich jetzt in Florenz befindet (Nr. 9). Ursprünglich
wurde also bei der Neubearbeitung die lange Form des antiken Diptychons
beibehalten. Ob die Rückseite in der alten Weise für Wachs ausgenutzt
wurde, ist sehr fraglich. Es ist wahrscheinlicher, daß die Platte gleich als
Handschriftendeckel diente, da auch das Florentiner Stück die gleichen zahl-
reichen, entsprechend verteilten Bohrlöcher am Rande zeigt, so daß die
Fassung eine gemeinsame gewesen ist, um so mehr als der untere Rand der
Berliner Platte, der also damals in der Mitte saß, diese Bohrlöcher nicht
aufweist. Dagegen besitzt dieser ein einzelnes, größeres Loch, dessen Zweck
nicht erkennbar ist. Die zahlreichen Löcher am Rande hat auch das Darm-
städter Fragment Nr. 20, das möglicherweise den unteren Teil der Gegenplatte
gebildet hat (vgl. dort). Die Ecke rechts unten ist ausgebrochen. Als ur-
sprünglicher Träger der Platten kommt der Deckel des Evangeliars Cod. Iig3
der Wiener Hofbibliothek mit großer Wahrscheinlichkeit in Betracht, der in
seiner Holzplatte genau entsprechende Vertiefungen aufweist (auf Vorder- und
Rückseite). Die Handschrift gehört dem Anfang des IX. Jahrh. an und befand
sich jedenfalls im XI. Jahrh. in Salzburg, wo sie jedoch nicht entstanden ist.
(Mitt. von Herrn Dr. Köhler.)
Die Kreuzigung wurde 1889 in Siegen erworben.
Christus unbärtig, von sehr vollen Körperformen, in kurzem
Schurz und Sandalen, fast senkrecht an das Kreuz genagelt,
über dessen Armen links Sol, rechts Luna in ganzer Figur mit
Trauergebärden und gesenkter Fackel erscheinen. Unter dem
Kreuz Maria, die ihr Kopftuch faßt und zu den Augen führt,
Johannes mit Buch und erhobener Hechten. Über ihren Köpfen
an den Kreuzesarmen die Inschriften MABIA und JOHANN,
auf der Tafel oben IHS NZR. Den ganzen unteren Rand bildete
eine (jetzt fast ganz abgeriebene) Schrifttafel mit eingeschnittenen
Ecken in ähnlicher Form wie .oben am Kreuz, auf der noch
die Spuren der Inschrift ,,Ubi angelus domini dixit mulieribus ..."
(Ev. Matth. Kap. 28 v. 5) in sehr ineinander geschobenen Buch-
staben zu entziffern sind. Sie bezieht sich auf die Frauen am
Grabe darunter (Nr. 9).
Der Stil ist dem der Oxforder Platte (Nr. 5) sehr verwandt,
nur sind die Formen etwas starker im Belief aufgetragen und
unregelmäßiger in den Linien. Diese Verstärkung zeigt sich in