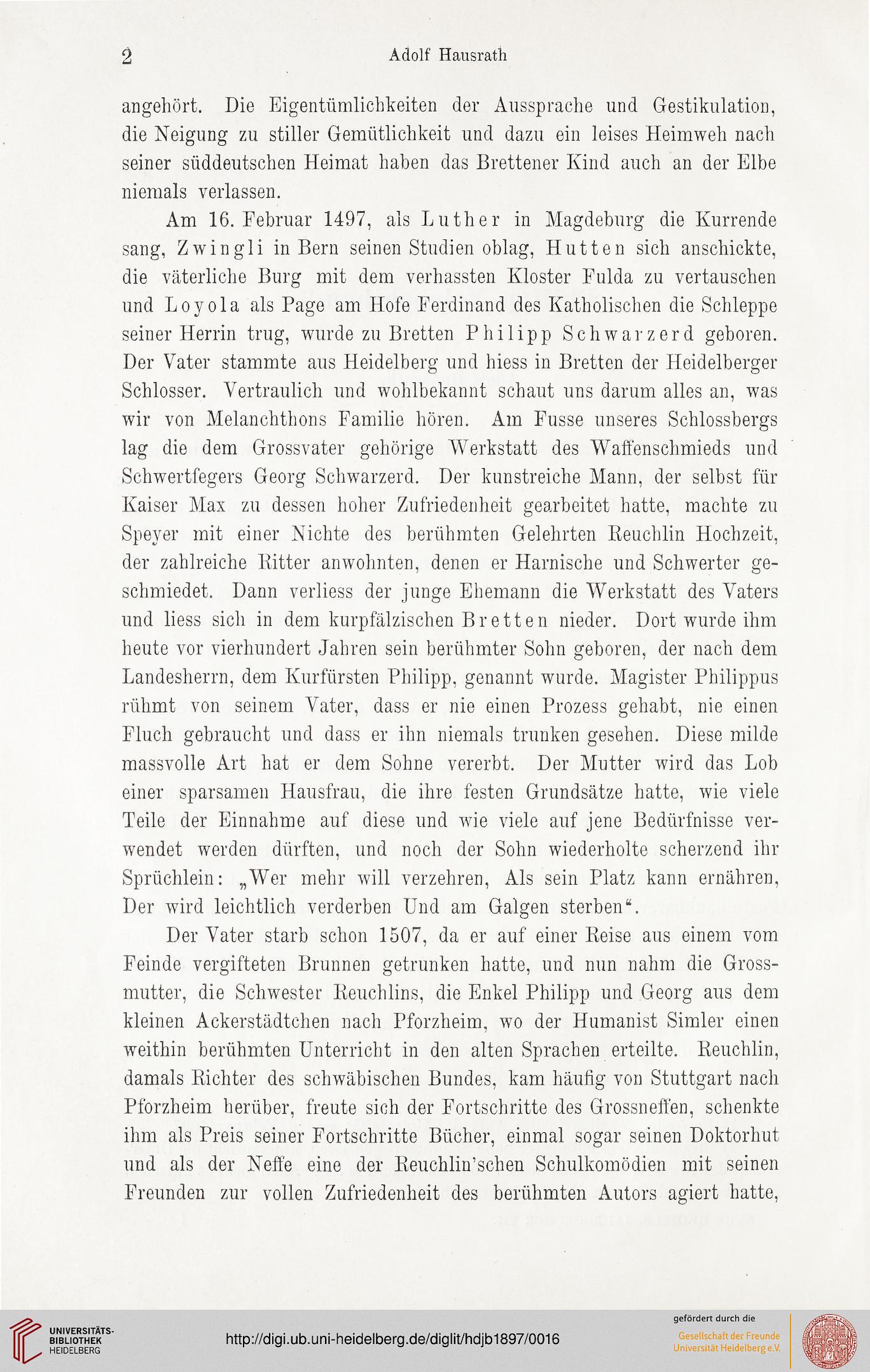2
Adolf Hausrath
angehört. Die Eigentümlichkeiten der Aussprache und Gestikulation,
die Neigung zu stiller Gemütlichkeit und dazu ein leises Heimweh nach
seiner süddeutschen Heimat haben das Brettener Kind auch an der Elbe
niemals verlassen.
Am 16. Februar 1497, als Luther in Magdeburg die Kurrende
sang, Zwingli in Bern seinen Studien oblag, Hutten sich anschickte,
die väterliche Burg mit dem verhassten Kloster Fulda zu vertauschen
und Loyola als Page am Hofe Ferdinand des Katholischen die Schleppe
seiner Herrin trug, wurde zu Bretten Philipp Schwarz erd geboren.
Der Vater stammte aus Heidelberg und hiess in Bretten der Heidelberger
Schlosser. Vertraulich und wohlbekannt schaut uns darum alles an, was
wir von Melanchthons Familie hören. Am Fusse unseres Schlossbergs
lag die dem Grossvater gehörige Werkstatt des Waffenschmieds und
Schwertfegers Georg Schwarzerd. Der kunstreiche Mann, der selbst für
Kaiser Max zu dessen hoher Zufriedenheit gearbeitet hatte, machte zu
Speyer mit einer Nichte des berühmten Gelehrten Keuchlin Hochzeit,
der zahlreiche Kitter anwohnten, denen er Harnische und Schwerter ge-
schmiedet. Dann verliess der junge Ehemann die Werkstatt des Vaters
und liess sich in dem kurpfälzischen Bretten nieder. Dort wurde ihm
heute vor vierhundert Jahren sein berühmter Sohn geboren, der nach dem
Landesherrn, dem Kurfürsten Philipp, genannt wurde. Magister Philippus
rühmt von seinem Vater, dass er nie einen Prozess gehabt, nie einen
Fluch gebraucht und dass er ihn niemals trunken gesehen. Diese milde
massvolle Art hat er dem Sohne vererbt. Der Mutter wird das Lob
einer sparsamen Hausfrau, die ihre festen Grundsätze hatte, wie viele
Teile der Einnahme auf diese und wie viele auf jene Bedürfnisse ver-
wendet werden dürften, und noch der Sohn wiederholte scherzend ihr
Sprüchlein: „Wer mehr will verzehren, Als sein Platz kann ernähren,
Der wird leichtlich verderben Und am Galgen sterben“.
Der Vater starb schon 1507, da er auf einer Reise aus einem vom
Feinde vergifteten Brunnen getrunken hatte, und nun nahm die Gross-
mutter, die Schwester Reuchlins, die Enkel Philipp und Georg aus dem
kleinen Ackerstädtchen nach Pforzheim, wo der Humanist Simler einen
weithin berühmten Unterricht in den alten Sprachen erteilte. Keuchlin,
damals Richter des schwäbischen Bundes, kam häufig von Stuttgart nach
Pforzheim herüber, freute sich der Fortschritte des Grossneffen, schenkte
ihm als Preis seiner Fortschritte Bücher, einmal sogar seinen Doktorhut
und als der Neffe eine der Reuchlin’schen Schulkomödien mit seinen
Freunden zur vollen Zufriedenheit des berühmten Autors agiert hatte,
Adolf Hausrath
angehört. Die Eigentümlichkeiten der Aussprache und Gestikulation,
die Neigung zu stiller Gemütlichkeit und dazu ein leises Heimweh nach
seiner süddeutschen Heimat haben das Brettener Kind auch an der Elbe
niemals verlassen.
Am 16. Februar 1497, als Luther in Magdeburg die Kurrende
sang, Zwingli in Bern seinen Studien oblag, Hutten sich anschickte,
die väterliche Burg mit dem verhassten Kloster Fulda zu vertauschen
und Loyola als Page am Hofe Ferdinand des Katholischen die Schleppe
seiner Herrin trug, wurde zu Bretten Philipp Schwarz erd geboren.
Der Vater stammte aus Heidelberg und hiess in Bretten der Heidelberger
Schlosser. Vertraulich und wohlbekannt schaut uns darum alles an, was
wir von Melanchthons Familie hören. Am Fusse unseres Schlossbergs
lag die dem Grossvater gehörige Werkstatt des Waffenschmieds und
Schwertfegers Georg Schwarzerd. Der kunstreiche Mann, der selbst für
Kaiser Max zu dessen hoher Zufriedenheit gearbeitet hatte, machte zu
Speyer mit einer Nichte des berühmten Gelehrten Keuchlin Hochzeit,
der zahlreiche Kitter anwohnten, denen er Harnische und Schwerter ge-
schmiedet. Dann verliess der junge Ehemann die Werkstatt des Vaters
und liess sich in dem kurpfälzischen Bretten nieder. Dort wurde ihm
heute vor vierhundert Jahren sein berühmter Sohn geboren, der nach dem
Landesherrn, dem Kurfürsten Philipp, genannt wurde. Magister Philippus
rühmt von seinem Vater, dass er nie einen Prozess gehabt, nie einen
Fluch gebraucht und dass er ihn niemals trunken gesehen. Diese milde
massvolle Art hat er dem Sohne vererbt. Der Mutter wird das Lob
einer sparsamen Hausfrau, die ihre festen Grundsätze hatte, wie viele
Teile der Einnahme auf diese und wie viele auf jene Bedürfnisse ver-
wendet werden dürften, und noch der Sohn wiederholte scherzend ihr
Sprüchlein: „Wer mehr will verzehren, Als sein Platz kann ernähren,
Der wird leichtlich verderben Und am Galgen sterben“.
Der Vater starb schon 1507, da er auf einer Reise aus einem vom
Feinde vergifteten Brunnen getrunken hatte, und nun nahm die Gross-
mutter, die Schwester Reuchlins, die Enkel Philipp und Georg aus dem
kleinen Ackerstädtchen nach Pforzheim, wo der Humanist Simler einen
weithin berühmten Unterricht in den alten Sprachen erteilte. Keuchlin,
damals Richter des schwäbischen Bundes, kam häufig von Stuttgart nach
Pforzheim herüber, freute sich der Fortschritte des Grossneffen, schenkte
ihm als Preis seiner Fortschritte Bücher, einmal sogar seinen Doktorhut
und als der Neffe eine der Reuchlin’schen Schulkomödien mit seinen
Freunden zur vollen Zufriedenheit des berühmten Autors agiert hatte,