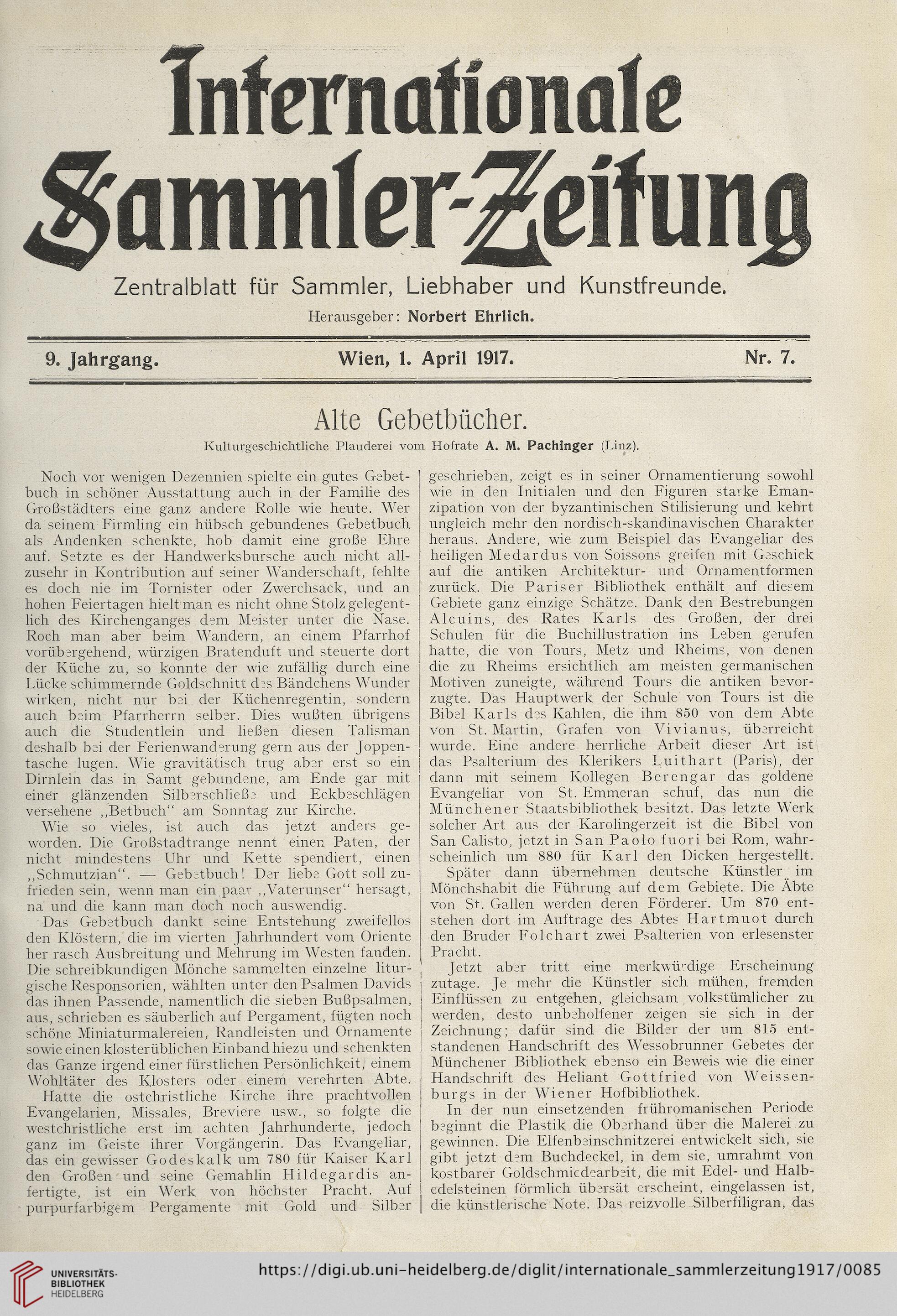Internationale
$ammter-2ßifiinfl
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde.
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
9. Jahrgang. Wien, 1. April 1917. Nr. 7.
Alte Gebetbücher.
Kulturgeschichtliche Plauderei vom Hofrate A. M. Pachinger (Linz).
Noch vor wenigen Dezennien spielte ein gutes Gebet-
buch in schöner Ausstattung auch in der Familie des
Großstädters eine ganz andere Rolle wie heute. Wer
da seinem Firmling ein hübsch gebundenes Gebetbuch
als Andenken schenkte, hob damit eine große Ehre
auf. Setzte es der Handwerksbursche auch nicht all-
zusehr in Kontribution auf seiner Wanderschaft, fehlte
es doch nie im Tornister oder Zwerchsack, und an
hohen Feiertagen hielt man es nicht ohne Stolz gelegent-
lich des Kirchenganges dem Meister unter die Nase.
Roch man aber beim Mündern, an einem Pfarrhof
vorübergehend, würzigen Bratenduft und steuerte dort
der Küche zu, so konnte der wie zufällig durch eine
Lücke schimmernde Goldschnitt des Bändchens Wunder
wirken, nicht nur bei der Küchenregentin, sondern
auch beim Pfarrherrn selber. Dies wußten übrigens
auch die Studentlein und ließen diesen Talisman
deshalb bei der Ferienwanderung gern aus der Joppen-
tasche lugen. Wie gravitätisch trug aber erst so ein
Dirnlein das in Samt gebundene, am Ende gar mit
einer glänzenden Silberschließe und Eckbeschlägen
versehene „Betbuch“ am Sonntag zur Kirche.
Wie so vieles, ist auch das jetzt anders ge-
worden. Die Großstadtrange nennt einen Paten, der
nicht mindestens Uhr und Kette spendiert, einen
„Schmutzian“. — Gebetbuch! Der liebe Gott soll zu-
frieden sein, wenn man ein paar „Vaterunser“ hersagt,
na und die kann man doch noch auswendig.
Das Gebetbuch dankt seine Entstehung zweifellos
den Klöstern, die im vierten Jahrhundert vom Oriente
her rasch Ausbreitung und Mehrung im Westen fanden.
Die schreibkundigen Mönche sammelten einzelne litur- ,
gische Responsorien, wählten unter den Psalmen Davids
das ihnen Passende, namentlich die sieben Bußpsalmen,
aus, schrieben es säuberlich auf Pergament, fügten noch
schöne Miniaturmalereien, Randleisten und Ornamente
sowie einen klosterüblichen Einband hiezu und schenkten
das Ganze irgend einer fürstlichen Persönlichkeit, einem
Wohltäter des Klosters oder einem verehrten Abte.
Hatte die ostchristliche Kirche ihre prachtvollen
Evangelarien, Missales, Breviere usw., so folgte die
westchristliche erst im achten Jahrhunderte, jedoch
ganz im Geiste ihrer Vorgängerin. Das Evangeliar,
das ein gewisser Go des kalk um 780 für Kaiser Karl
den Großen und seine Gemahlin Hildegardis an-
fertigte, ist ein Werk von höchster Pracht. Auf ■
purpurfarbigem Pergamente mit Gold und Silber |
geschrieben, zeigt es in seiner Ornamentierung sowohl
wie in den Initialen und den Figuren starke Eman-
zipation von der byzantinischen Stilisierung und kehrt
ungleich mehr den nordisch-skandinavischen Charakter
heraus. Andere, wie zum Beispiel das Evangeliar des
heiligen Medardus von Soissons greifen mit Geschick
auf die antiken Architektur- und Ornamentformen
zurück. Die Pariser Bibliothek enthält auf diesem
Gebiete ganz einzige Schätze. Dank den Bestrebungen
Alcuins, des Rates Karls des Großen, der drei
Schulen für die Buchillustration ins Leben gerufen
hatte, die von Tours, Metz und Rheims, von denen
die zu Rheims ersichtlich am meisten germanischen
Motiven zuneigte, während Tours die antiken bevor-
zugte. Das Hauptwerk der Schule von Tours ist die
Bibel Karls des Kahlen, die ihm 850 von dem Abte
von St. Martin, Grafen von Vivianus, überreicht
wurde. Eine andere herrliche Arbeit dieser Art ist
das Psalterium des Klerikers Luithart (Paris), der
dann mit seinem Kollegen Berengar das goldene
Evangeliar von St. Emmeran schuf, das nun die
Münchener Staatsbibliothek besitzt. Das letzte Werk
solcher Art aus der Karolingerzeit ist die Bibel von
San Calisto, jetzt in San Paolo fuori bei Rom, wahr-
scheinlich um 880 für Karl den Dicken hergestellt.
Später dann übernehmen deutsche Künstler im
Mönchshabit die Führung auf dem Gebiete. Die Äbte
von St. Gallen werden deren Förderer. Um 870 ent-
stehen dort im Auftrage des Abtes Hart,mnot durch
den Bruder Fo Ich art zwei Psalterien von erlesenster
Pracht.
Jetzt aber tritt eine merkwürdige Erscheinung
zutage. Je mehr die Künstler sich mühen, fremden
Einflüssen zu entgehen, gleichsam volkstümlicher zu
werden, desto unbeholfener zeigen sie sich in der
Zeichnung; dafür sind die Bilder der um 815 ent-
standenen Handschrift des Wessobrunner Gebetes der
Münchener Bibliothek ebenso ein Beweis wie die einer
Handschrift des Heliant Gottfried von Weissen-
burgs in der Wiener Hofbibliothek.
In der nun einsetzenden frühromanischen Periode
beginnt die Plastik die Oberhand über die Malerei zu
gewinnen. Die Elfenbeinschnitzerei entwickelt sich, sie
gibt jetzt dem Buchdeckel, in dem sie, umrahmt von
kostbarer Goldschmiedearbeit, die mit Edel- und Halb-
edelsteinen förmlich übersät erscheint, eingelassen ist,
| die künstlerische Note. Das reizvolle Silberfiligran, das
$ammter-2ßifiinfl
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde.
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
9. Jahrgang. Wien, 1. April 1917. Nr. 7.
Alte Gebetbücher.
Kulturgeschichtliche Plauderei vom Hofrate A. M. Pachinger (Linz).
Noch vor wenigen Dezennien spielte ein gutes Gebet-
buch in schöner Ausstattung auch in der Familie des
Großstädters eine ganz andere Rolle wie heute. Wer
da seinem Firmling ein hübsch gebundenes Gebetbuch
als Andenken schenkte, hob damit eine große Ehre
auf. Setzte es der Handwerksbursche auch nicht all-
zusehr in Kontribution auf seiner Wanderschaft, fehlte
es doch nie im Tornister oder Zwerchsack, und an
hohen Feiertagen hielt man es nicht ohne Stolz gelegent-
lich des Kirchenganges dem Meister unter die Nase.
Roch man aber beim Mündern, an einem Pfarrhof
vorübergehend, würzigen Bratenduft und steuerte dort
der Küche zu, so konnte der wie zufällig durch eine
Lücke schimmernde Goldschnitt des Bändchens Wunder
wirken, nicht nur bei der Küchenregentin, sondern
auch beim Pfarrherrn selber. Dies wußten übrigens
auch die Studentlein und ließen diesen Talisman
deshalb bei der Ferienwanderung gern aus der Joppen-
tasche lugen. Wie gravitätisch trug aber erst so ein
Dirnlein das in Samt gebundene, am Ende gar mit
einer glänzenden Silberschließe und Eckbeschlägen
versehene „Betbuch“ am Sonntag zur Kirche.
Wie so vieles, ist auch das jetzt anders ge-
worden. Die Großstadtrange nennt einen Paten, der
nicht mindestens Uhr und Kette spendiert, einen
„Schmutzian“. — Gebetbuch! Der liebe Gott soll zu-
frieden sein, wenn man ein paar „Vaterunser“ hersagt,
na und die kann man doch noch auswendig.
Das Gebetbuch dankt seine Entstehung zweifellos
den Klöstern, die im vierten Jahrhundert vom Oriente
her rasch Ausbreitung und Mehrung im Westen fanden.
Die schreibkundigen Mönche sammelten einzelne litur- ,
gische Responsorien, wählten unter den Psalmen Davids
das ihnen Passende, namentlich die sieben Bußpsalmen,
aus, schrieben es säuberlich auf Pergament, fügten noch
schöne Miniaturmalereien, Randleisten und Ornamente
sowie einen klosterüblichen Einband hiezu und schenkten
das Ganze irgend einer fürstlichen Persönlichkeit, einem
Wohltäter des Klosters oder einem verehrten Abte.
Hatte die ostchristliche Kirche ihre prachtvollen
Evangelarien, Missales, Breviere usw., so folgte die
westchristliche erst im achten Jahrhunderte, jedoch
ganz im Geiste ihrer Vorgängerin. Das Evangeliar,
das ein gewisser Go des kalk um 780 für Kaiser Karl
den Großen und seine Gemahlin Hildegardis an-
fertigte, ist ein Werk von höchster Pracht. Auf ■
purpurfarbigem Pergamente mit Gold und Silber |
geschrieben, zeigt es in seiner Ornamentierung sowohl
wie in den Initialen und den Figuren starke Eman-
zipation von der byzantinischen Stilisierung und kehrt
ungleich mehr den nordisch-skandinavischen Charakter
heraus. Andere, wie zum Beispiel das Evangeliar des
heiligen Medardus von Soissons greifen mit Geschick
auf die antiken Architektur- und Ornamentformen
zurück. Die Pariser Bibliothek enthält auf diesem
Gebiete ganz einzige Schätze. Dank den Bestrebungen
Alcuins, des Rates Karls des Großen, der drei
Schulen für die Buchillustration ins Leben gerufen
hatte, die von Tours, Metz und Rheims, von denen
die zu Rheims ersichtlich am meisten germanischen
Motiven zuneigte, während Tours die antiken bevor-
zugte. Das Hauptwerk der Schule von Tours ist die
Bibel Karls des Kahlen, die ihm 850 von dem Abte
von St. Martin, Grafen von Vivianus, überreicht
wurde. Eine andere herrliche Arbeit dieser Art ist
das Psalterium des Klerikers Luithart (Paris), der
dann mit seinem Kollegen Berengar das goldene
Evangeliar von St. Emmeran schuf, das nun die
Münchener Staatsbibliothek besitzt. Das letzte Werk
solcher Art aus der Karolingerzeit ist die Bibel von
San Calisto, jetzt in San Paolo fuori bei Rom, wahr-
scheinlich um 880 für Karl den Dicken hergestellt.
Später dann übernehmen deutsche Künstler im
Mönchshabit die Führung auf dem Gebiete. Die Äbte
von St. Gallen werden deren Förderer. Um 870 ent-
stehen dort im Auftrage des Abtes Hart,mnot durch
den Bruder Fo Ich art zwei Psalterien von erlesenster
Pracht.
Jetzt aber tritt eine merkwürdige Erscheinung
zutage. Je mehr die Künstler sich mühen, fremden
Einflüssen zu entgehen, gleichsam volkstümlicher zu
werden, desto unbeholfener zeigen sie sich in der
Zeichnung; dafür sind die Bilder der um 815 ent-
standenen Handschrift des Wessobrunner Gebetes der
Münchener Bibliothek ebenso ein Beweis wie die einer
Handschrift des Heliant Gottfried von Weissen-
burgs in der Wiener Hofbibliothek.
In der nun einsetzenden frühromanischen Periode
beginnt die Plastik die Oberhand über die Malerei zu
gewinnen. Die Elfenbeinschnitzerei entwickelt sich, sie
gibt jetzt dem Buchdeckel, in dem sie, umrahmt von
kostbarer Goldschmiedearbeit, die mit Edel- und Halb-
edelsteinen förmlich übersät erscheint, eingelassen ist,
| die künstlerische Note. Das reizvolle Silberfiligran, das