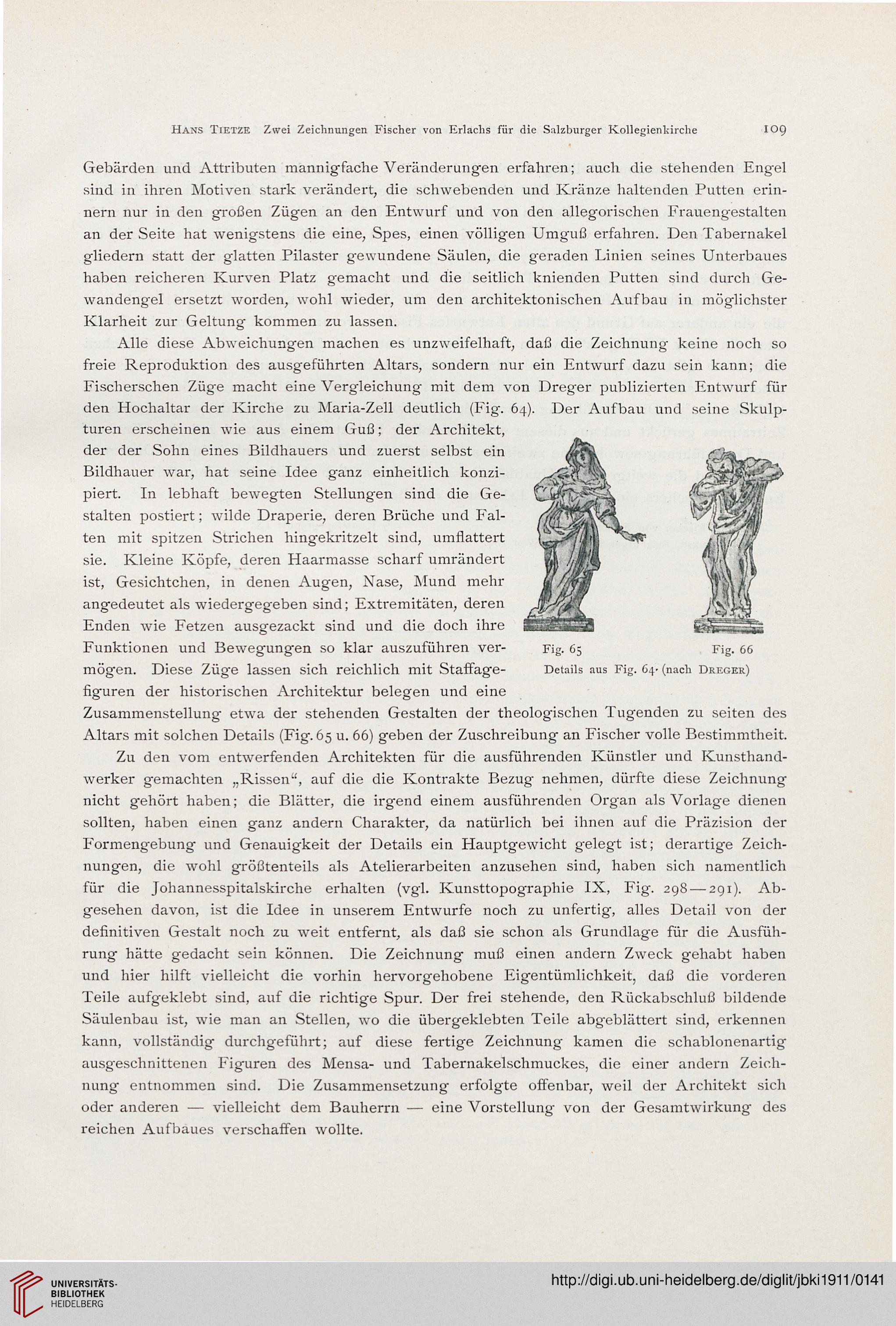Hans TlETZE Zwei Zeichnungen Fischer von Erlachs für die Salzburger Kollegienkirche
Gebärden und Attributen mannigfache Veränderungen erfahren; auch die stehenden Engel
sind in ihren Motiven stark verändert, die schwebenden und Kränze haltenden Putten erin-
nern nur in den großen Zügen an den Entwurf und von den allegorischen Erauengestalten
an der Seite hat wenigstens die eine, Spes, einen völligen Umguß erfahren. Den Tabernakel
gliedern statt der glatten Pilaster gewundene Säulen, die geraden Linien seines Unterbaues
haben reicheren Kurven Platz gemacht und die seitlich knienden Putten sind durch Ge-
wandengel ersetzt worden, wohl wieder, um den architektonischen Aufbau in möglichster
Klarheit zur Geltung kommen zu lassen.
Alle diese Abweichungen machen es unzweifelhaft, daß die Zeichnung keine noch so
freie Reproduktion des ausgeführten Altars, sondern nur ein Entwurf dazu sein kann; die
Fisch ersehen Züge macht eine Vergleichung mit dem von Dreger publizierten Entwurf für
den Hochaltar der Kirche zu Maria-Zell deutlich (Fig. 64). Der Aufbau und seine Skulp-
turen erscheinen wie aus einem Guß; der Architekt,
der der Sohn eines Bildhauers und zuerst selbst ein
Bildhauer war, hat seine Idee ganz einheitlich konzi-
piert. In lebhaft bewegten Stellungen sind die Ge-
stalten postiert; wilde Draperie, deren Brüche und Fal-
ten mit spitzen Strichen hingekritzelt sind, umflattert
sie. Kleine Köpfe, deren Haarmasse scharf umrändert
ist, Gesichtchen, in denen Augen, Nase, Mund mehr
angedeutet als wiedergegeben sind; Extremitäten, deren
Enden wie Fetzen ausgezackt sind und die doch ihre
Funktionen und Bewegungen so klar auszuführen ver- Fig. 65 Fig. 66
mögen. Diese Züge lassen sich reichlich mit Staffage- Details aus Fig. 64- (nach Dreger)
figuren der historischen Architektur belegen und eine
Zusammenstellung etwa der stehenden Gestalten der theologischen Tugenden zu seiten des
Altars mit solchen Details (Fig. 65 u. 66) geben der Zuschreibung an Fischer volle Bestimmtheit.
Zu den vom entwerfenden Architekten für die ausführenden Künstler und Kunsthand-
werker gemachten „Rissen"', auf die die Kontrakte Bezug nehmen, dürfte diese Zeichnung
nicht gehört haben; die Blätter, die irgend einem ausführenden Organ als Vorlage dienen
sollten, haben einen ganz andern Charakter, da natürlich bei ihnen auf die Präzision der
Formengebung und Genauigkeit der Details ein Hauptgewicht gelegt ist; derartige Zeich-
nungen, die wohl größtenteils als Atelierarbeiten anzusehen sind, haben sich namentlich
für die Johannesspitalskirche erhalten (vgl. Kunsttopographie IX, Fig. 298 — 291). Ab-
gesehen davon, ist die Idee in unserem Entwürfe noch zu unfertig, alles Detail von der
definitiven Gestalt noch zu weit entfernt, als daß sie schon als Grundlage für die Ausfüh-
rung hätte gedacht sein können. Die Zeichnung muß einen andern Zweck gehabt haben
und hier hilft vielleicht die vorhin hervorgehobene Eigentümlichkeit, daß die vorderen
Teile aufgeklebt sind, auf die richtige Spur. Der frei stehende, den Rückabschluß bildende
Säulenbau ist, wie man an Stellen, wo die übergeklebten Teile abgeblättert sind, erkennen
kann, vollständig durchgeführt; auf diese fertige Zeichnung kamen die schablonenartig
ausgeschnittenen Figuren des Mensa- und Tabernakelschmuckes, die einer andern Zeich-
nung entnommen sind. Die Zusammensetzung erfolgte offenbar, weil der Architekt sich
oder anderen — vielleicht dem Bauherrn — eine Vorstellung von der Gesamtwirkung des
reichen Aufbaues verschaffen wollte.
Gebärden und Attributen mannigfache Veränderungen erfahren; auch die stehenden Engel
sind in ihren Motiven stark verändert, die schwebenden und Kränze haltenden Putten erin-
nern nur in den großen Zügen an den Entwurf und von den allegorischen Erauengestalten
an der Seite hat wenigstens die eine, Spes, einen völligen Umguß erfahren. Den Tabernakel
gliedern statt der glatten Pilaster gewundene Säulen, die geraden Linien seines Unterbaues
haben reicheren Kurven Platz gemacht und die seitlich knienden Putten sind durch Ge-
wandengel ersetzt worden, wohl wieder, um den architektonischen Aufbau in möglichster
Klarheit zur Geltung kommen zu lassen.
Alle diese Abweichungen machen es unzweifelhaft, daß die Zeichnung keine noch so
freie Reproduktion des ausgeführten Altars, sondern nur ein Entwurf dazu sein kann; die
Fisch ersehen Züge macht eine Vergleichung mit dem von Dreger publizierten Entwurf für
den Hochaltar der Kirche zu Maria-Zell deutlich (Fig. 64). Der Aufbau und seine Skulp-
turen erscheinen wie aus einem Guß; der Architekt,
der der Sohn eines Bildhauers und zuerst selbst ein
Bildhauer war, hat seine Idee ganz einheitlich konzi-
piert. In lebhaft bewegten Stellungen sind die Ge-
stalten postiert; wilde Draperie, deren Brüche und Fal-
ten mit spitzen Strichen hingekritzelt sind, umflattert
sie. Kleine Köpfe, deren Haarmasse scharf umrändert
ist, Gesichtchen, in denen Augen, Nase, Mund mehr
angedeutet als wiedergegeben sind; Extremitäten, deren
Enden wie Fetzen ausgezackt sind und die doch ihre
Funktionen und Bewegungen so klar auszuführen ver- Fig. 65 Fig. 66
mögen. Diese Züge lassen sich reichlich mit Staffage- Details aus Fig. 64- (nach Dreger)
figuren der historischen Architektur belegen und eine
Zusammenstellung etwa der stehenden Gestalten der theologischen Tugenden zu seiten des
Altars mit solchen Details (Fig. 65 u. 66) geben der Zuschreibung an Fischer volle Bestimmtheit.
Zu den vom entwerfenden Architekten für die ausführenden Künstler und Kunsthand-
werker gemachten „Rissen"', auf die die Kontrakte Bezug nehmen, dürfte diese Zeichnung
nicht gehört haben; die Blätter, die irgend einem ausführenden Organ als Vorlage dienen
sollten, haben einen ganz andern Charakter, da natürlich bei ihnen auf die Präzision der
Formengebung und Genauigkeit der Details ein Hauptgewicht gelegt ist; derartige Zeich-
nungen, die wohl größtenteils als Atelierarbeiten anzusehen sind, haben sich namentlich
für die Johannesspitalskirche erhalten (vgl. Kunsttopographie IX, Fig. 298 — 291). Ab-
gesehen davon, ist die Idee in unserem Entwürfe noch zu unfertig, alles Detail von der
definitiven Gestalt noch zu weit entfernt, als daß sie schon als Grundlage für die Ausfüh-
rung hätte gedacht sein können. Die Zeichnung muß einen andern Zweck gehabt haben
und hier hilft vielleicht die vorhin hervorgehobene Eigentümlichkeit, daß die vorderen
Teile aufgeklebt sind, auf die richtige Spur. Der frei stehende, den Rückabschluß bildende
Säulenbau ist, wie man an Stellen, wo die übergeklebten Teile abgeblättert sind, erkennen
kann, vollständig durchgeführt; auf diese fertige Zeichnung kamen die schablonenartig
ausgeschnittenen Figuren des Mensa- und Tabernakelschmuckes, die einer andern Zeich-
nung entnommen sind. Die Zusammensetzung erfolgte offenbar, weil der Architekt sich
oder anderen — vielleicht dem Bauherrn — eine Vorstellung von der Gesamtwirkung des
reichen Aufbaues verschaffen wollte.