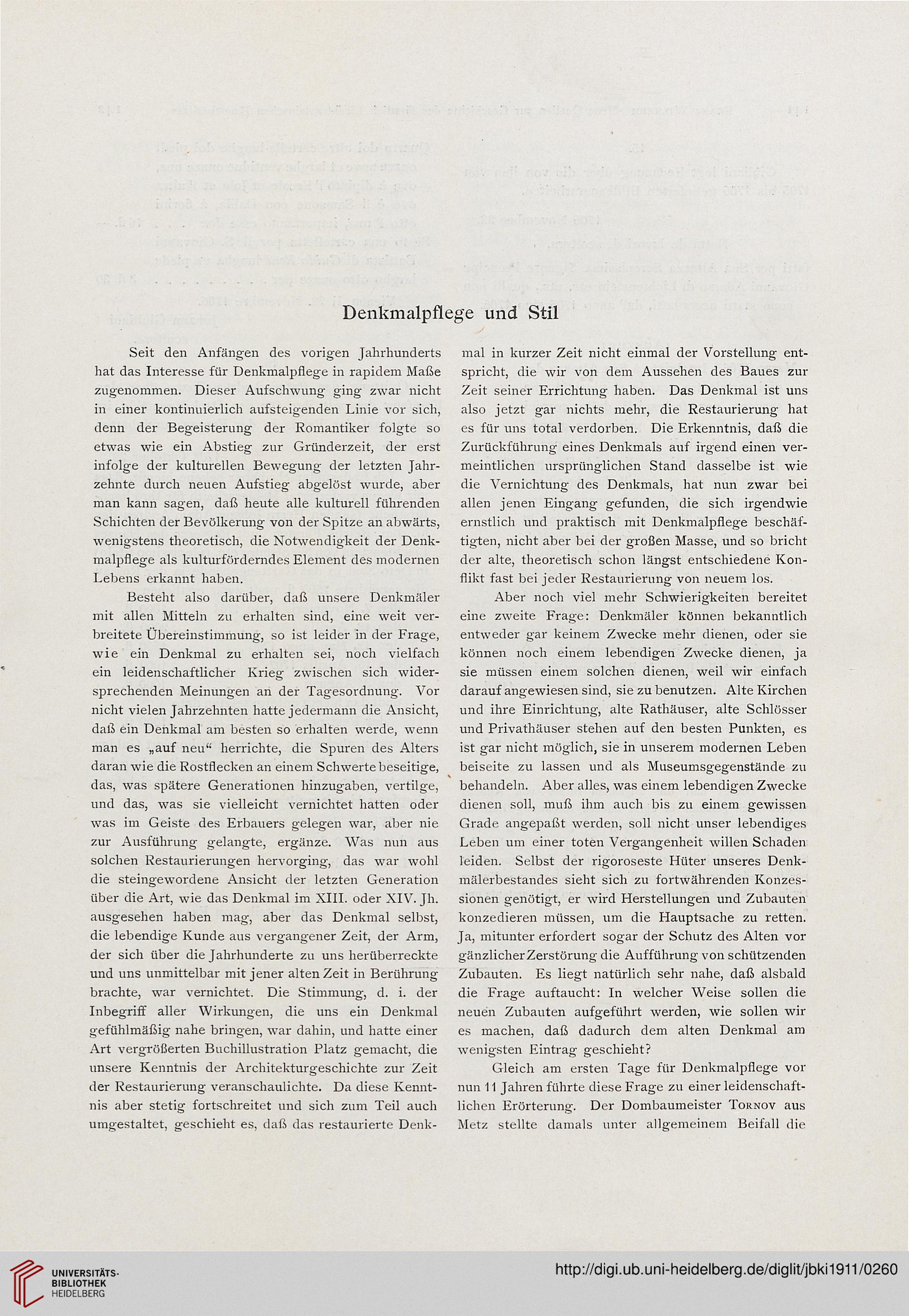Denkmalpflege und Stil
Seit den Anfängen des vorigen Jahrhunderts
hat das Interesse für Denkmalpflege in rapidem Maße
zugenommen. Dieser Aufschwung ging zwar nicht
in einer kontinuierlich aufsteigenden Linie vor sich,
denn der Begeisterung der Romantiker folgte so
etwas wie ein Abstieg zur Gründerzeit, der erst
infolge der kulturellen Bewegung der letzten Jahr-
zehnte durch neuen Aufstieg abgelöst wurde, aber
man kann sagen, daß heute alle kulturell führenden
Schichten der Bevölkerung von der Spitze an abwärts,
wenigstens theoretisch, die Notwendigkeit der Denk-
malpflege als kulturförderndes Element des modernen
Lebens erkannt haben.
Besteht also darüber, daß unsere Denkmäler
mit allen Mitteln zu erhalten sind, eine weit ver-
breitete Übereinstimmung, so ist leider in der Frage,
wie ein Denkmal zu erhalten sei, noch vielfach
ein leidenschaftlicher Krieg zwischen sich wider-
sprechenden Meinungen an der Tagesordnung. Vor
nicht vielen Jahrzehnten hatte jedermann die Ansicht,
daß ein Denkmal am besten so erhalten werde, wenn
man es „auf neu" herrichte, die Spuren des Alters
daran wie die Rostflecken an einem Schwerte beseitige,
das, was spätere Generationen hinzugaben, vertilge,
und das, was sie vielleicht vernichtet hatten oder
was im Geiste des Erbauers gelegen war, aber nie
zur Ausführung gelangte, ergänze. Was nun aus
solchen Restaurierungen hervorging, das war wohl
die steingewordene Ansicht der letzten Generation
über die Art, wie das Denkmal im XIII. oder XIV. Jh.
ausgesehen haben mag, aber das Denkmal selbst,
die lebendige Kunde aus vergangener Zeit, der Arm,
der sich über die Jahrhunderte zu uns herüberreckte
und uns unmittelbar mit jener alten Zeit in Berührung
brachte, war vernichtet. Die Stimmung, d. i. der
Inbegriff aller Wirkungen, die uns ein Denkmal
gefühlmäßig nahe bringen, w-ar dahin, und hatte einer
Art vergrößerten Buchillustration Platz gemacht, die
unsere Kenntnis der Architekturgeschichte zur Zeit
der Restaurierung veranschaulichte. Da diese Kennt-
nis aber stetig fortschreitet und sich zum Teil auch
umgestaltet, geschieht es, daß das restaurierte Denk-
mal in kurzer Zeit nicht einmal der Vorstellung ent-
spricht, die wir von dem Aussehen des Baues zur
Zeit seiner Errichtung haben. Das Denkmal ist uns
also jetzt gar nichts mehr, die Restaurierung hat
es für uns total verdorben. Die Erkenntnis, daß die
Zurückführung eines Denkmals auf irgend einen ver-
meintlichen ursprünglichen Stand dasselbe ist wie
die Vernichtung des Denkmals, hat nun zwar bei
allen jenen Eingang gefunden, die sich irgendwie
ernstlich und praktisch mit Denkmalpflege beschäf-
tigten, nicht aber bei der großen Masse, und so bricht
der alte, theoretisch schon längst entschiedene Kon-
flikt fast bei jeder Restaimerung von neuem los.
Aber noch viel mehr Schwierigkeiten bereitet
eine zweite Frage: Denkmäler können bekanntlich
entweder gar keinem Zwecke mehr dienen, oder sie
können noch einem lebendigen Zwecke dienen, ja
sie müssen einem solchen dienen, weil wir einfach
darauf angewiesen sind, sie zu benutzen. Alte Kirchen
und ihre Einrichtung, alte Rathäuser, alte Schlösser
und Privathäuser stehen auf den besten Punkten, es
ist gar nicht möglich, sie in unserem modernen Leben
beiseite zu lassen und als Museumsgegenstände zu
behandeln. Aber alles, was einem lebendigen Zwecke
dienen soll, muß ihm auch bis zu einem gewissen
Grade angepaßt werden, soll nicht unser lebendiges
Leben um einer toten Vergangenheit willen Schaden
leiden. Selbst der rigoroseste Hüter unseres Denk-
mälerbestandes sieht sich zu fortwährenden Konzes-
sionen genötigt, er wird Herstellungen und Zubauten
konzedieren müssen, um die Hauptsache zu retten.
Ja, mitunter erfordert sogar der Schutz des Alten vor
gänzlicher Zerstörung die Aufführung von schützenden
Zubauten. Es liegt natürlich sehr nahe, daß alsbald
die Frage auftaucht: In welcher Weise sollen die
neuen Zubauten aufgeführt werden, wie sollen wir
es machen, daß dadurch dem alten Denkmal am
wenigsten Eintrag geschieht?
Gleich am ersten Tage für Denkmalpflege vor
nun 11 Jahren führte diese Frage zu einer leidenschaft-
lichen Erörterung. Der Dombaumeister Tornov aus
Metz stellte damals unter allgemeinem Beifall die
Seit den Anfängen des vorigen Jahrhunderts
hat das Interesse für Denkmalpflege in rapidem Maße
zugenommen. Dieser Aufschwung ging zwar nicht
in einer kontinuierlich aufsteigenden Linie vor sich,
denn der Begeisterung der Romantiker folgte so
etwas wie ein Abstieg zur Gründerzeit, der erst
infolge der kulturellen Bewegung der letzten Jahr-
zehnte durch neuen Aufstieg abgelöst wurde, aber
man kann sagen, daß heute alle kulturell führenden
Schichten der Bevölkerung von der Spitze an abwärts,
wenigstens theoretisch, die Notwendigkeit der Denk-
malpflege als kulturförderndes Element des modernen
Lebens erkannt haben.
Besteht also darüber, daß unsere Denkmäler
mit allen Mitteln zu erhalten sind, eine weit ver-
breitete Übereinstimmung, so ist leider in der Frage,
wie ein Denkmal zu erhalten sei, noch vielfach
ein leidenschaftlicher Krieg zwischen sich wider-
sprechenden Meinungen an der Tagesordnung. Vor
nicht vielen Jahrzehnten hatte jedermann die Ansicht,
daß ein Denkmal am besten so erhalten werde, wenn
man es „auf neu" herrichte, die Spuren des Alters
daran wie die Rostflecken an einem Schwerte beseitige,
das, was spätere Generationen hinzugaben, vertilge,
und das, was sie vielleicht vernichtet hatten oder
was im Geiste des Erbauers gelegen war, aber nie
zur Ausführung gelangte, ergänze. Was nun aus
solchen Restaurierungen hervorging, das war wohl
die steingewordene Ansicht der letzten Generation
über die Art, wie das Denkmal im XIII. oder XIV. Jh.
ausgesehen haben mag, aber das Denkmal selbst,
die lebendige Kunde aus vergangener Zeit, der Arm,
der sich über die Jahrhunderte zu uns herüberreckte
und uns unmittelbar mit jener alten Zeit in Berührung
brachte, war vernichtet. Die Stimmung, d. i. der
Inbegriff aller Wirkungen, die uns ein Denkmal
gefühlmäßig nahe bringen, w-ar dahin, und hatte einer
Art vergrößerten Buchillustration Platz gemacht, die
unsere Kenntnis der Architekturgeschichte zur Zeit
der Restaurierung veranschaulichte. Da diese Kennt-
nis aber stetig fortschreitet und sich zum Teil auch
umgestaltet, geschieht es, daß das restaurierte Denk-
mal in kurzer Zeit nicht einmal der Vorstellung ent-
spricht, die wir von dem Aussehen des Baues zur
Zeit seiner Errichtung haben. Das Denkmal ist uns
also jetzt gar nichts mehr, die Restaurierung hat
es für uns total verdorben. Die Erkenntnis, daß die
Zurückführung eines Denkmals auf irgend einen ver-
meintlichen ursprünglichen Stand dasselbe ist wie
die Vernichtung des Denkmals, hat nun zwar bei
allen jenen Eingang gefunden, die sich irgendwie
ernstlich und praktisch mit Denkmalpflege beschäf-
tigten, nicht aber bei der großen Masse, und so bricht
der alte, theoretisch schon längst entschiedene Kon-
flikt fast bei jeder Restaimerung von neuem los.
Aber noch viel mehr Schwierigkeiten bereitet
eine zweite Frage: Denkmäler können bekanntlich
entweder gar keinem Zwecke mehr dienen, oder sie
können noch einem lebendigen Zwecke dienen, ja
sie müssen einem solchen dienen, weil wir einfach
darauf angewiesen sind, sie zu benutzen. Alte Kirchen
und ihre Einrichtung, alte Rathäuser, alte Schlösser
und Privathäuser stehen auf den besten Punkten, es
ist gar nicht möglich, sie in unserem modernen Leben
beiseite zu lassen und als Museumsgegenstände zu
behandeln. Aber alles, was einem lebendigen Zwecke
dienen soll, muß ihm auch bis zu einem gewissen
Grade angepaßt werden, soll nicht unser lebendiges
Leben um einer toten Vergangenheit willen Schaden
leiden. Selbst der rigoroseste Hüter unseres Denk-
mälerbestandes sieht sich zu fortwährenden Konzes-
sionen genötigt, er wird Herstellungen und Zubauten
konzedieren müssen, um die Hauptsache zu retten.
Ja, mitunter erfordert sogar der Schutz des Alten vor
gänzlicher Zerstörung die Aufführung von schützenden
Zubauten. Es liegt natürlich sehr nahe, daß alsbald
die Frage auftaucht: In welcher Weise sollen die
neuen Zubauten aufgeführt werden, wie sollen wir
es machen, daß dadurch dem alten Denkmal am
wenigsten Eintrag geschieht?
Gleich am ersten Tage für Denkmalpflege vor
nun 11 Jahren führte diese Frage zu einer leidenschaft-
lichen Erörterung. Der Dombaumeister Tornov aus
Metz stellte damals unter allgemeinem Beifall die