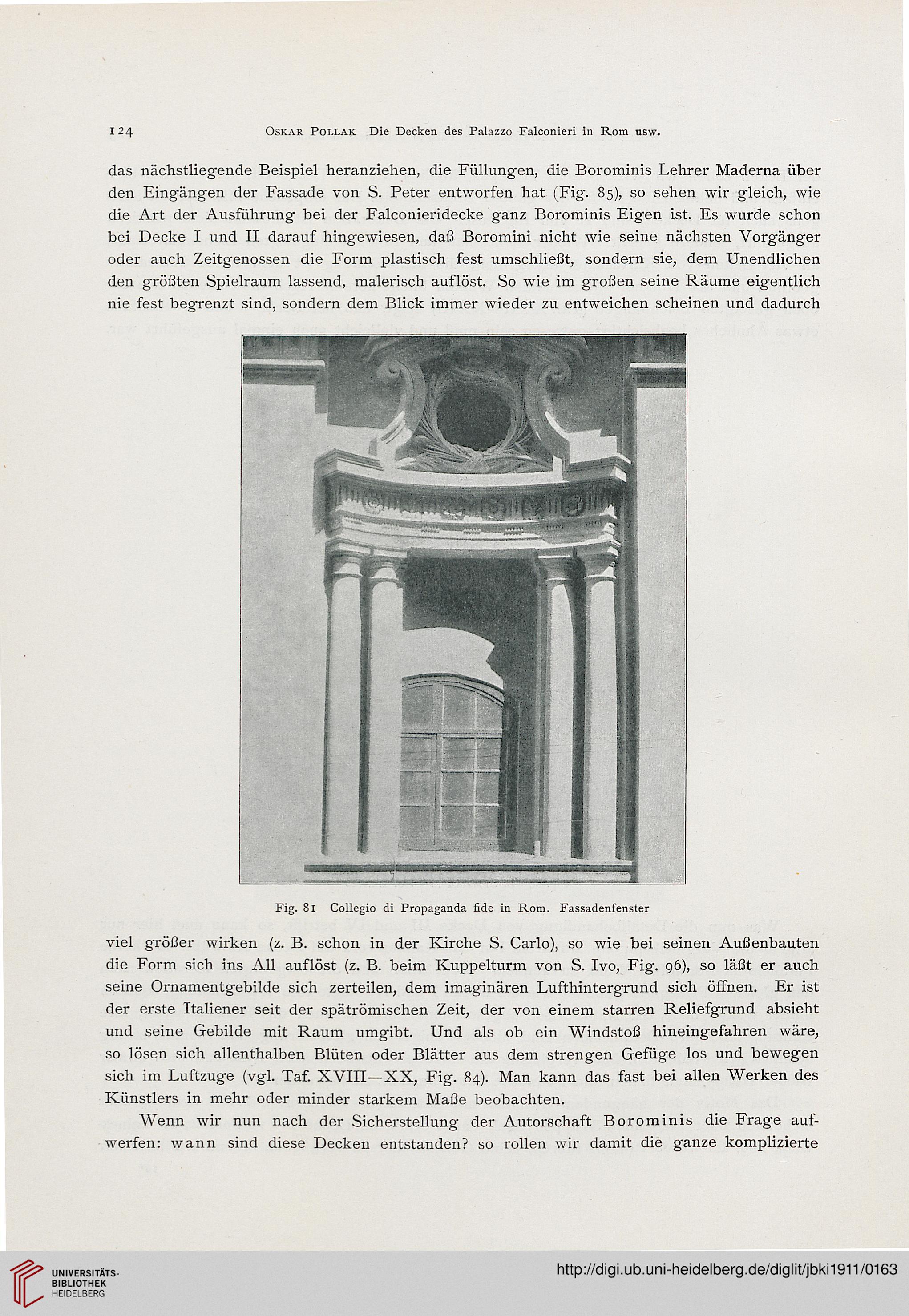I24
Oskar Poi.i.ak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.
das nächstliegende Beispiel heranziehen, die Füllungen, die Borominis Lehrer Maderna über
den Eingängen der Fassade von S. Peter entworfen hat (Fig. 85), so sehen wir gleich, wie
die Art der Ausführung bei der Falconieridecke ganz Borominis Eigen ist. Es wurde schon
bei Decke I und II darauf hingewiesen, daß Boromini nicht wie seine nächsten Vorgänger
oder auch Zeitgenossen die Form plastisch fest umschließt, sondern sie, dem Unendlichen
den größten Spielraum lassend, malerisch auflöst. So wie im großen seine Räume eigentlich
nie fest begrenzt sind, sondern dem Blick immer wieder zu entweichen scheinen und dadurch
Fig. 81 Collegio di Propaganda fide in Rom. Fassadenfenster
viel größer wirken (z. B. schon in der Kirche S. Carlo), so wie bei seinen Außenbauten
die Form sich ins All auflöst (z. B. beim Kuppelturm von S. Ivo, Fig. 96), so läßt er auch
seine Ornamentgebilde sich zerteilen, dem imaginären Lufthintergrund sich öffnen. Er ist
der erste Italiener seit der spätrömischen Zeit, der von einem starren Reliefgrund absieht
und seine Gebilde mit Raum umgibt. Und als ob ein Windstoß hineingefahren wäre,
so lösen sich allenthalben Blüten oder Blätter aus dem strengen Gefüge los und bewegen
sich im Luftzuge (vgl. Taf. XVIII—XX, Fig. 84). Man kann das fast bei allen Werken des
Künstlers in mehr oder minder starkem Maße beobachten.
Wenn wir nun nach der Sicherstellung der Autorschaft Borominis die Frage auf-
werfen: wann sind diese Decken entstanden? so rollen wir damit die ganze komplizierte
Oskar Poi.i.ak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.
das nächstliegende Beispiel heranziehen, die Füllungen, die Borominis Lehrer Maderna über
den Eingängen der Fassade von S. Peter entworfen hat (Fig. 85), so sehen wir gleich, wie
die Art der Ausführung bei der Falconieridecke ganz Borominis Eigen ist. Es wurde schon
bei Decke I und II darauf hingewiesen, daß Boromini nicht wie seine nächsten Vorgänger
oder auch Zeitgenossen die Form plastisch fest umschließt, sondern sie, dem Unendlichen
den größten Spielraum lassend, malerisch auflöst. So wie im großen seine Räume eigentlich
nie fest begrenzt sind, sondern dem Blick immer wieder zu entweichen scheinen und dadurch
Fig. 81 Collegio di Propaganda fide in Rom. Fassadenfenster
viel größer wirken (z. B. schon in der Kirche S. Carlo), so wie bei seinen Außenbauten
die Form sich ins All auflöst (z. B. beim Kuppelturm von S. Ivo, Fig. 96), so läßt er auch
seine Ornamentgebilde sich zerteilen, dem imaginären Lufthintergrund sich öffnen. Er ist
der erste Italiener seit der spätrömischen Zeit, der von einem starren Reliefgrund absieht
und seine Gebilde mit Raum umgibt. Und als ob ein Windstoß hineingefahren wäre,
so lösen sich allenthalben Blüten oder Blätter aus dem strengen Gefüge los und bewegen
sich im Luftzuge (vgl. Taf. XVIII—XX, Fig. 84). Man kann das fast bei allen Werken des
Künstlers in mehr oder minder starkem Maße beobachten.
Wenn wir nun nach der Sicherstellung der Autorschaft Borominis die Frage auf-
werfen: wann sind diese Decken entstanden? so rollen wir damit die ganze komplizierte