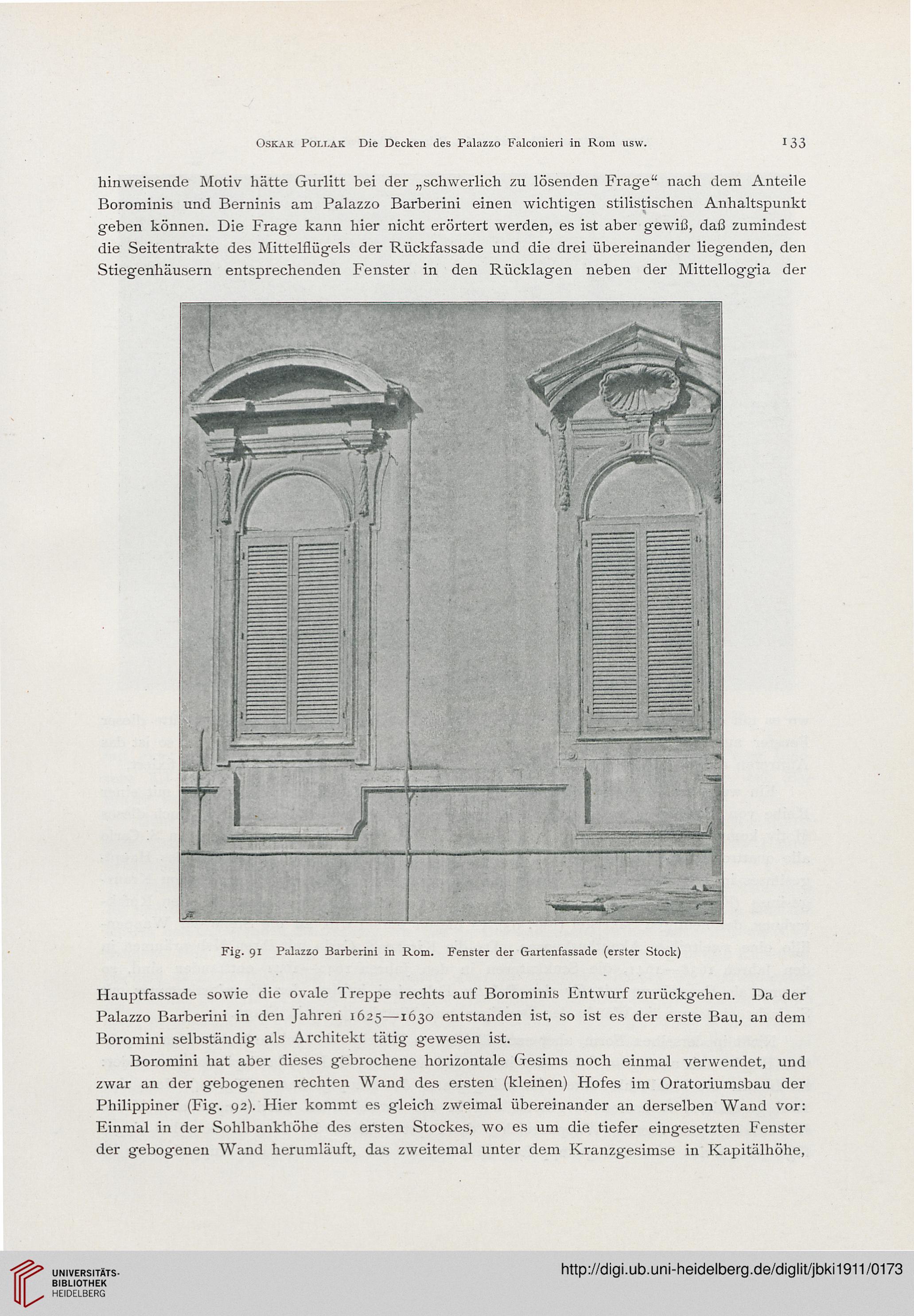Oskar Poi.i.ak Die Decken des Palazzo Falconieri in Rom usw.
133
hinweisende Motiv hätte Gurlitt bei der „schwerlich zu lösenden Frage" nach dem Anteile
Borominis und Berninis am Palazzo Barberini einen wichtigen stilistischen Anhaltspunkt
geben können. Die Frage kann hier nicht erörtert werden, es ist aber gewiß, daß zumindest
die Seitentrakte des Mittelflügels der Rückfassade und die drei übereinander liegenden, den
Stiegenhäusern entsprechenden Fenster in den Rücklagen neben der Mittelloggia der
Fig. 91 Palazzo Barberini in Rom. Fenster der Gartenfassade (erster Stock)
Hauptfassade sowie die ovale Treppe rechts auf Borominis Entwurf zurückgehen. Da der
Palazzo Barberini in den Jahren 1625—1630 entstanden ist, so ist es der erste Bau, an dem
Boromini selbständig als Architekt tätig gewesen ist.
Boromini hat aber dieses gebrochene horizontale Gesims noch einmal verwendet, und
zwar an der gebogenen rechten Wand des ersten (kleinen) Hofes im Oratoriumsbau der
Philippiner (Fig. 92). Hier kommt es gleich zweimal übereinander an derselben Wand vor:
Einmal in der Sohlbankhöhe des ersten Stockes, wo es um die tiefer eingesetzten Fenster
der gebogenen Wand herumläuft, das zweitemal unter dem Kranzgesimse in Kapitälhöhe,
133
hinweisende Motiv hätte Gurlitt bei der „schwerlich zu lösenden Frage" nach dem Anteile
Borominis und Berninis am Palazzo Barberini einen wichtigen stilistischen Anhaltspunkt
geben können. Die Frage kann hier nicht erörtert werden, es ist aber gewiß, daß zumindest
die Seitentrakte des Mittelflügels der Rückfassade und die drei übereinander liegenden, den
Stiegenhäusern entsprechenden Fenster in den Rücklagen neben der Mittelloggia der
Fig. 91 Palazzo Barberini in Rom. Fenster der Gartenfassade (erster Stock)
Hauptfassade sowie die ovale Treppe rechts auf Borominis Entwurf zurückgehen. Da der
Palazzo Barberini in den Jahren 1625—1630 entstanden ist, so ist es der erste Bau, an dem
Boromini selbständig als Architekt tätig gewesen ist.
Boromini hat aber dieses gebrochene horizontale Gesims noch einmal verwendet, und
zwar an der gebogenen rechten Wand des ersten (kleinen) Hofes im Oratoriumsbau der
Philippiner (Fig. 92). Hier kommt es gleich zweimal übereinander an derselben Wand vor:
Einmal in der Sohlbankhöhe des ersten Stockes, wo es um die tiefer eingesetzten Fenster
der gebogenen Wand herumläuft, das zweitemal unter dem Kranzgesimse in Kapitälhöhe,