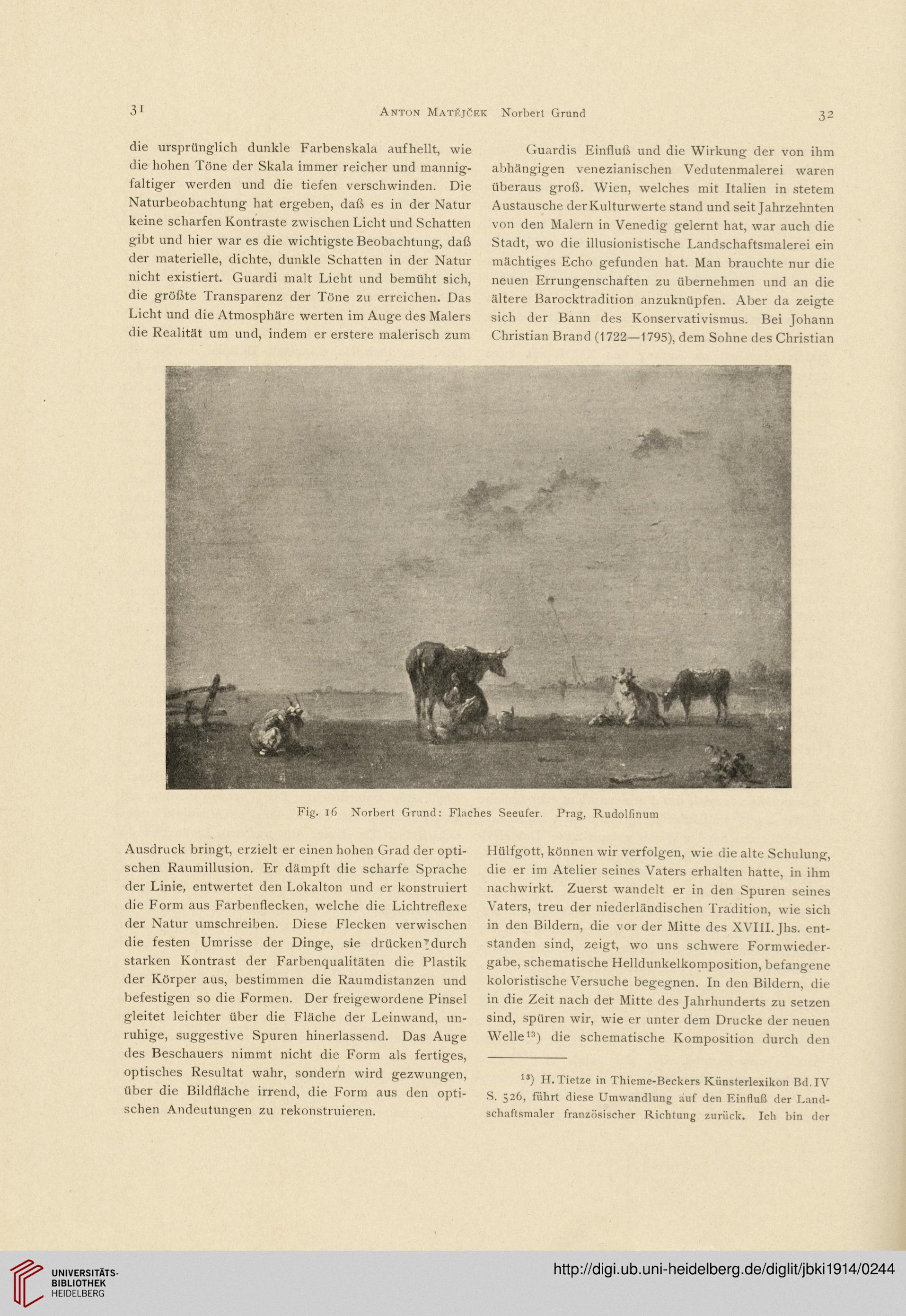3i
Anton MatäjCek Norbert Grund
32
die ursprünglich dunkle Farbenskala aufhellt, wie
die hohen Töne der Skala immer reicher und mannig-
faltiger werden und die tiefen verschwinden. Die
Naturbeobachtung hat ergeben, daß es in der Natur
keine scharfen Kontraste zwischen Licht und Schatten
gibt und hier war es die wichtigste Beobachtung, daß
der materielle, dichte, dunkle Schatten in der Natur
nicht existiert. Guardi malt Licht und bemüht sich,
die größte Transparenz der Töne zu erreichen. Das
Licht und die Atmosphäre werten im Auge des Malers
die Realität um und, indem er erstere malerisch zum
Guardis Einfluß und die Wirkung der von ihm
abhängigen venezianischen Vedutenmalerei waren
überaus groß. Wien, welches mit Italien in stetem
Austausche derKulturwerte stand und seit Jahrzehnten
von den Maiern in Venedig gelernt hat, war auch die
Stadt, wo die illusionistische Landschaftsmalerei ein
mächtiges Echo gefunden hat. Man brauchte nur die
neuen Errungenschaften zu übernehmen und an die
ältere Barocktradition anzuknüpfen. Aber da zeigte
sich der Bann des Konservativismus. Bei Johann
Christian Brand (1722—1795), dem Sohne des Christian
Fig. 16 Norbert Grund: Flaches Seeufer. Prag, Rudolfinum
Ausdruck bringt, erzielt er einen hohen Grad der opti-
schen Raumillusion. Er dämpft die scharfe Sprache
der Linie, entwertet den Lokalton und er konstruiert
die Form aus Farbenflecken, welche die Lichtreflexe
der Natur umschreiben. Diese Flecken verwischen
die festen Umrisse der Dinge, sie drücken'durch
starken Kontrast der Farbenqualitäten die Plastik
der Körper aus, bestimmen die Raumdistanzen und
befestigen so die Formen. Der freigewordene Pinsel
gleitet leichter über die l'läche der Leinwand, un-
ruhige, suggestive Spuren hinerlassend. Das Auge
des Beschauers nimmt nicht die Form als fertiges,
optisches Resultat wahr, sondern wird gezwungen,
über die Bildfläche irrend, die Form aus den opti-
schen Andeutungen zu rekonstruieren.
Hülfgott, können wir verfolgen, wie die alte Schulung,
die er im Atelier seines Vaters erhalten hatte, in ihm
nachwirkt. Zuerst wandelt er in den Spuren seines
Vaters, treu der niederländischen Tradition, wie sich
in den Bildern, die vor der Mitte des XVIII. Jhs. ent-
standen sind, zeigt, wo uns schwere Formwieder-
gabe, schematische Helldunkelkomposition, befangene
koloristische Versuche begegnen. In den Bildern, die
in die Zeit nach det Mitte des Jahrhunderts zu setzen
sind, spüren wir, wie er unter dem Drucke der neuen
Welle13) die schematische Komposition durch den
13) H. Tietze in Thieme-Beckers Kiinsterlexikon Bd.IV
S. 526, fiihrt diese Umwandlung auf den Einflnß der Land-
schaftsmaler französischer Richtung zuriick. Ich bin der
Anton MatäjCek Norbert Grund
32
die ursprünglich dunkle Farbenskala aufhellt, wie
die hohen Töne der Skala immer reicher und mannig-
faltiger werden und die tiefen verschwinden. Die
Naturbeobachtung hat ergeben, daß es in der Natur
keine scharfen Kontraste zwischen Licht und Schatten
gibt und hier war es die wichtigste Beobachtung, daß
der materielle, dichte, dunkle Schatten in der Natur
nicht existiert. Guardi malt Licht und bemüht sich,
die größte Transparenz der Töne zu erreichen. Das
Licht und die Atmosphäre werten im Auge des Malers
die Realität um und, indem er erstere malerisch zum
Guardis Einfluß und die Wirkung der von ihm
abhängigen venezianischen Vedutenmalerei waren
überaus groß. Wien, welches mit Italien in stetem
Austausche derKulturwerte stand und seit Jahrzehnten
von den Maiern in Venedig gelernt hat, war auch die
Stadt, wo die illusionistische Landschaftsmalerei ein
mächtiges Echo gefunden hat. Man brauchte nur die
neuen Errungenschaften zu übernehmen und an die
ältere Barocktradition anzuknüpfen. Aber da zeigte
sich der Bann des Konservativismus. Bei Johann
Christian Brand (1722—1795), dem Sohne des Christian
Fig. 16 Norbert Grund: Flaches Seeufer. Prag, Rudolfinum
Ausdruck bringt, erzielt er einen hohen Grad der opti-
schen Raumillusion. Er dämpft die scharfe Sprache
der Linie, entwertet den Lokalton und er konstruiert
die Form aus Farbenflecken, welche die Lichtreflexe
der Natur umschreiben. Diese Flecken verwischen
die festen Umrisse der Dinge, sie drücken'durch
starken Kontrast der Farbenqualitäten die Plastik
der Körper aus, bestimmen die Raumdistanzen und
befestigen so die Formen. Der freigewordene Pinsel
gleitet leichter über die l'läche der Leinwand, un-
ruhige, suggestive Spuren hinerlassend. Das Auge
des Beschauers nimmt nicht die Form als fertiges,
optisches Resultat wahr, sondern wird gezwungen,
über die Bildfläche irrend, die Form aus den opti-
schen Andeutungen zu rekonstruieren.
Hülfgott, können wir verfolgen, wie die alte Schulung,
die er im Atelier seines Vaters erhalten hatte, in ihm
nachwirkt. Zuerst wandelt er in den Spuren seines
Vaters, treu der niederländischen Tradition, wie sich
in den Bildern, die vor der Mitte des XVIII. Jhs. ent-
standen sind, zeigt, wo uns schwere Formwieder-
gabe, schematische Helldunkelkomposition, befangene
koloristische Versuche begegnen. In den Bildern, die
in die Zeit nach det Mitte des Jahrhunderts zu setzen
sind, spüren wir, wie er unter dem Drucke der neuen
Welle13) die schematische Komposition durch den
13) H. Tietze in Thieme-Beckers Kiinsterlexikon Bd.IV
S. 526, fiihrt diese Umwandlung auf den Einflnß der Land-
schaftsmaler französischer Richtung zuriick. Ich bin der