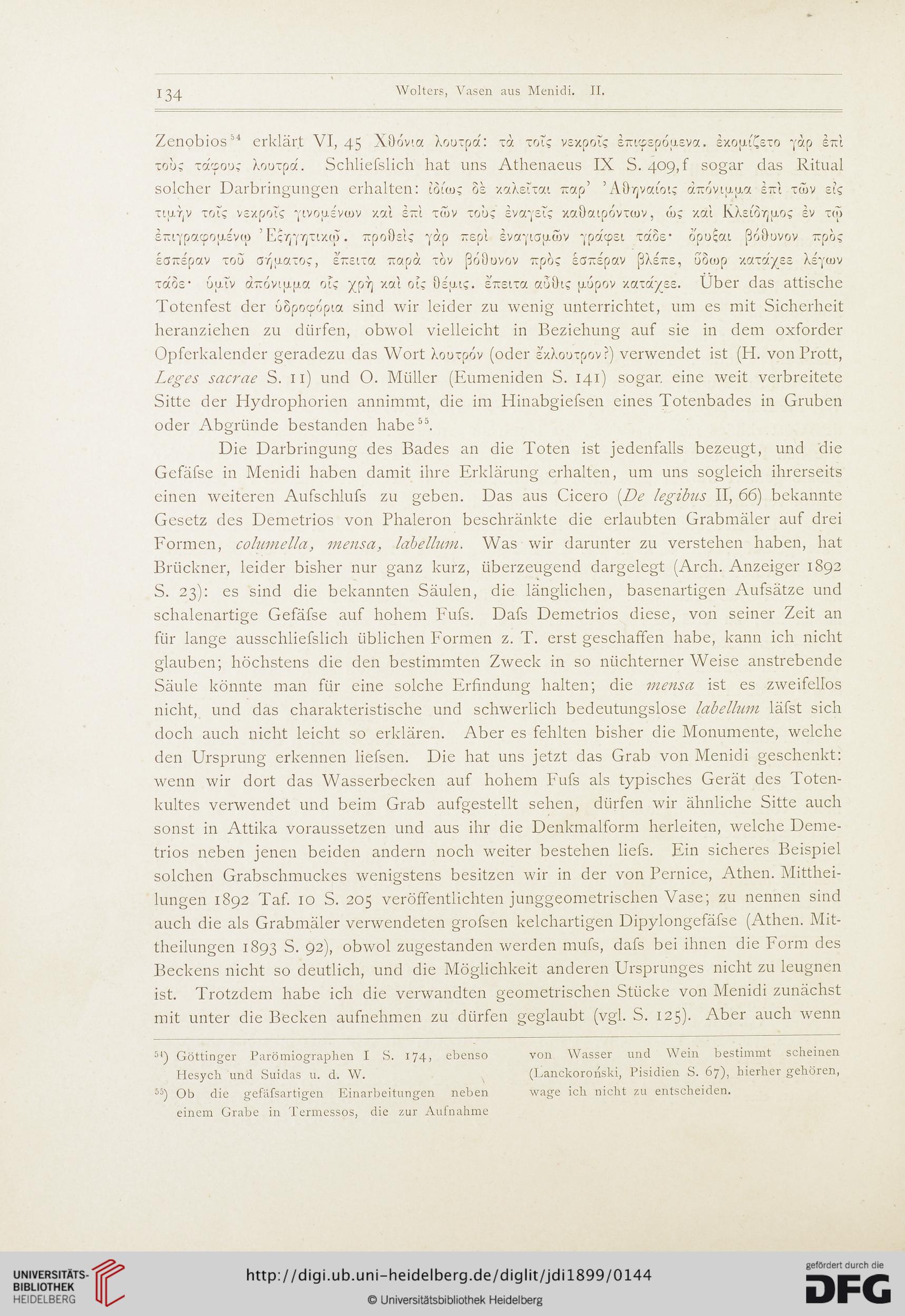134 Wolters, Vasen aus Menidi. II,
Zenobios04 erklärt VI, 45 XDovia λουτρά: τά τοις νεκροΐς επιφερόμενα. έκομιζετο γάρ επί
τους τάφους λουτρά. Schliefslich hat uns Athenaeus IX S. 409,f sogar das Ritual
solcher Darbringungen erhalten: ιδίως δε καλείται παρ’ Άβηναίοις άπόνιμμα έπ'ι των εις
τιμήν τοις νεκροις γινομένων και έπ'ι των τους εναγείς κα ιίαιρ ον των, ώς καί Κλείδημος έν τω
έπιγραφομένω ’ Εςηγητικω. προΟε'ις γάρ περ'ι έναγισμών γράφει τάδε* δρυςαι βόθυνον προς
εσπέραν του σήματος, επειτα παρά τον βόΟυνον προς εσπέραν βλέπε, ύδωρ κατάχεε λέγων
τάδε· ύμιν άπόνιμμα οίς χρή και οις Οέμις. έπειτα αυθις μύρον κατάχεε. Über das attische
Totenfest der υδροφόρια sind wir leider zu wenig unterrichtet, um es mit Sicherheit
heranziehen zu dürfen, obwol vielleicht in Beziehung auf sie in dem oxforder
Opferkalender geradezu das Wort λουτρόν (oder έκλουτοον?) verwendet ist (H. von Prott,
Leges sacrae S. 11) und O. Müller (Eumeniden S. 141) sogar, eine weit verbreitete
Sitte der Hydrophorien annimmt, die im Hinabgiefsen eines Totenbades in Gruben
oder Abgründe bestanden habe55.
Die Darbringung des Bades an die Toten ist jedenfalls bezeugt, und die
Gefäfse in Menidi haben damit ihre Erklärung erhalten, um uns sogleich ihrerseits
einen weiteren Aufschlufs zu geben. Das aus Cicero (De legibus II, 66) bekannte
Gesetz des Demetrios von Phaleron beschränkte die erlaubten Grabmäler auf drei
Formen, colwnella, mensa, labellum. Was wir darunter zu verstehen haben, hat
Brückner, leider bisher nur ganz kurz, überzeugend dargelegt (Arch. Anzeiger 1892
S. 23): es sind die bekannten Säulen, die länglichen, basenartigen Aufsätze und
schalenartige Gefäfse auf hohem Fufs. Dafs Demetrios diese, von seiner Zeit an
für lange ausschliefslich üblichen Formen z. T. erst geschaffen habe, kann ich nicht
glauben; höchstens die den bestimmten Zweck in so nüchterner Weise anstrebende
Säule könnte man für eine solche Erfindung halten; die mensa ist es zweifellos
nicht, und das charakteristische und schwerlich bedeutungslose labellum läfst sich
doch auch nicht leicht so erklären. Aber es fehlten bisher die Monumente, welche
den Ursprung erkennen liefsen. Die hat uns jetzt das Grab von Menidi geschenkt:
wenn wir dort das Wasserbecken auf hohem Fufs als typisches Gerät des Toten-
kultes verwendet und beim Grab aufgestellt sehen, dürfen wir ähnliche Sitte auch
sonst in Attika voraussetzen und aus ihr die Denkmalform herleiten, welche Deme-
trios neben jenen beiden andern noch weiter bestehen liefs. Ein sicheres Beispiel
solchen Grabschmuckes wenigstens besitzen wir in der von Pernice, Athen. Mitthei-
lungen 1892 Taf. 10 S. 205 veröffentlichten junggeometrischen Vase; zu nennen sind
auch die als Grabmäler verwendeten grofsen kelchartigen Dipylongefäfse (Athen. Mit-
theilungen 1893 S. 92), obwol zugestanden werden mufs, dafs bei ihnen die Form des
Beckens nicht so deutlich, und die Möglichkeit anderen Ursprunges nicht zu leugnen
ist. Trotzdem habe ich die verwandten geometrischen Stücke von Menidi zunächst
mit unter die Becken aufnehmen zu dürfen geglaubt (vgl. S. 125). Aber auch wenn
Göttinger Parömiographen I S. 174j ebenso von Wasser und Wein bestimmt scheinen
Hesych und Suidas u. d. W. (Lanckoroiiski, Pisidien S. 67), hierher gehören,
55) Ob die gefafsartigen Einarbeitungen neben wage ich nicht zu entscheiden.
einem Grabe in Termessos, die zur Aufnahme
Zenobios04 erklärt VI, 45 XDovia λουτρά: τά τοις νεκροΐς επιφερόμενα. έκομιζετο γάρ επί
τους τάφους λουτρά. Schliefslich hat uns Athenaeus IX S. 409,f sogar das Ritual
solcher Darbringungen erhalten: ιδίως δε καλείται παρ’ Άβηναίοις άπόνιμμα έπ'ι των εις
τιμήν τοις νεκροις γινομένων και έπ'ι των τους εναγείς κα ιίαιρ ον των, ώς καί Κλείδημος έν τω
έπιγραφομένω ’ Εςηγητικω. προΟε'ις γάρ περ'ι έναγισμών γράφει τάδε* δρυςαι βόθυνον προς
εσπέραν του σήματος, επειτα παρά τον βόΟυνον προς εσπέραν βλέπε, ύδωρ κατάχεε λέγων
τάδε· ύμιν άπόνιμμα οίς χρή και οις Οέμις. έπειτα αυθις μύρον κατάχεε. Über das attische
Totenfest der υδροφόρια sind wir leider zu wenig unterrichtet, um es mit Sicherheit
heranziehen zu dürfen, obwol vielleicht in Beziehung auf sie in dem oxforder
Opferkalender geradezu das Wort λουτρόν (oder έκλουτοον?) verwendet ist (H. von Prott,
Leges sacrae S. 11) und O. Müller (Eumeniden S. 141) sogar, eine weit verbreitete
Sitte der Hydrophorien annimmt, die im Hinabgiefsen eines Totenbades in Gruben
oder Abgründe bestanden habe55.
Die Darbringung des Bades an die Toten ist jedenfalls bezeugt, und die
Gefäfse in Menidi haben damit ihre Erklärung erhalten, um uns sogleich ihrerseits
einen weiteren Aufschlufs zu geben. Das aus Cicero (De legibus II, 66) bekannte
Gesetz des Demetrios von Phaleron beschränkte die erlaubten Grabmäler auf drei
Formen, colwnella, mensa, labellum. Was wir darunter zu verstehen haben, hat
Brückner, leider bisher nur ganz kurz, überzeugend dargelegt (Arch. Anzeiger 1892
S. 23): es sind die bekannten Säulen, die länglichen, basenartigen Aufsätze und
schalenartige Gefäfse auf hohem Fufs. Dafs Demetrios diese, von seiner Zeit an
für lange ausschliefslich üblichen Formen z. T. erst geschaffen habe, kann ich nicht
glauben; höchstens die den bestimmten Zweck in so nüchterner Weise anstrebende
Säule könnte man für eine solche Erfindung halten; die mensa ist es zweifellos
nicht, und das charakteristische und schwerlich bedeutungslose labellum läfst sich
doch auch nicht leicht so erklären. Aber es fehlten bisher die Monumente, welche
den Ursprung erkennen liefsen. Die hat uns jetzt das Grab von Menidi geschenkt:
wenn wir dort das Wasserbecken auf hohem Fufs als typisches Gerät des Toten-
kultes verwendet und beim Grab aufgestellt sehen, dürfen wir ähnliche Sitte auch
sonst in Attika voraussetzen und aus ihr die Denkmalform herleiten, welche Deme-
trios neben jenen beiden andern noch weiter bestehen liefs. Ein sicheres Beispiel
solchen Grabschmuckes wenigstens besitzen wir in der von Pernice, Athen. Mitthei-
lungen 1892 Taf. 10 S. 205 veröffentlichten junggeometrischen Vase; zu nennen sind
auch die als Grabmäler verwendeten grofsen kelchartigen Dipylongefäfse (Athen. Mit-
theilungen 1893 S. 92), obwol zugestanden werden mufs, dafs bei ihnen die Form des
Beckens nicht so deutlich, und die Möglichkeit anderen Ursprunges nicht zu leugnen
ist. Trotzdem habe ich die verwandten geometrischen Stücke von Menidi zunächst
mit unter die Becken aufnehmen zu dürfen geglaubt (vgl. S. 125). Aber auch wenn
Göttinger Parömiographen I S. 174j ebenso von Wasser und Wein bestimmt scheinen
Hesych und Suidas u. d. W. (Lanckoroiiski, Pisidien S. 67), hierher gehören,
55) Ob die gefafsartigen Einarbeitungen neben wage ich nicht zu entscheiden.
einem Grabe in Termessos, die zur Aufnahme