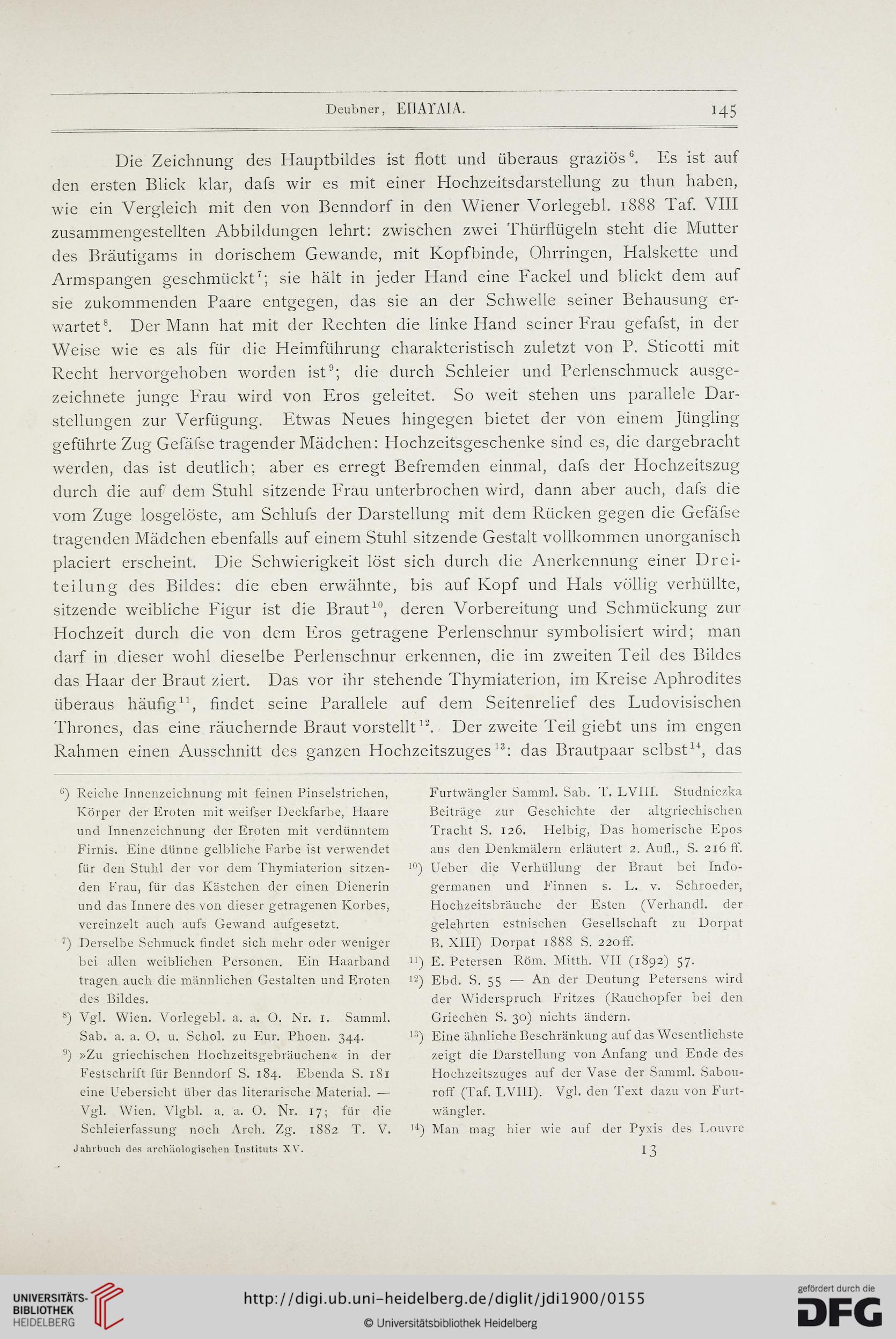Deubner, EüAYAIA. 145
Die Zeichnung des Hauptbildes ist flott und überaus graziös6. Es ist auf
den ersten Blick klar, dafs wir es mit einer Hochzeitsdarstellung zu thun haben,
wie ein Vergleich mit den von Benndorf in den Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. VIII
zusammengestellten Abbildungen lehrt: zwischen zwei Thürflügeln steht die Mutter
des Bräutigams in dorischem Gewände, mit Kopfbinde, Ohrringen, Halskette und
Armspangen geschmückt7; sie hält in jeder Hand eine Fackel und blickt dem auf
sie zukommenden Paare entgegen, das sie an der Schwelle seiner Behausung er-
wartet8. Der Mann hat mit der Rechten die linke Hand seiner Frau gefafst, in der
Weise wie es als für die Heimführung charakteristisch zuletzt von P. Sticotti mit
Recht hervorgehoben worden ist9; die durch Schleier und Perlenschmuck ausge-
zeichnete junge Frau wird von Eros geleitet. So weit stehen uns parallele Dar-
stellungen zur Verfügung. Etwas Neues hingegen bietet der von einem Jüngling
geführte Zug Gefäfse tragender Mädchen: Hochzeitsgeschenke sind es, die dargebracht
werden, das ist deutlich; aber es erregt Befremden einmal, dafs der Hochzeitszug
durch die auf dem Stuhl sitzende P'rau unterbrochen wird, dann aber auch, dafs die
vom Zuge losgelöste, am Schlufs der Darstellung mit dem Rücken gegen die Gefäfse
tragenden Mädchen ebenfalls auf einem Stuhl sitzende Gestalt vollkommen unorganisch
placiert erscheint. Die Schwierigkeit löst sich durch die Anerkennung einer Drei-
teilung des Bildes: die eben erwähnte, bis auf Kopf und Hals völlig verhüllte,
sitzende weibliche Figur ist die Braut10, deren Vorbereitung und Schmückung zur
Hochzeit durch die von dem Eros getragene Perlenschnur symbolisiert wird; man
darf in dieser wohl dieselbe Perlenschnur erkennen, die im zweiten Teil des Bildes
das Haar der Braut ziert. Das vor ihr stehende Thymiaterion, im Kreise Aphrodites
überaus häufig11, findet seine Parallele auf dem Seitenrelief des Eudovisischen
Thrones, das eine räuchernde Braut vorstellt12. Der zweite Teil giebt uns im engen
Rahmen einen Ausschnitt des ganzen Hochzeitszuges13: das Brautpaar selbst14, das
°) Reiche Innenzeichnung mit feinen Pinselstrichen,
Körper der Eroten mit weifser Deckfarbe, Haare
und Innenzeichnung der Eroten mit verdünntem
Firnis. Eine dünne gelbliche Farbe ist verwendet
für den Stuhl der vor dem Thymiaterion sitzen-
den Frau, für das Kästchen der einen Dienerin
und das Innere des von dieser getragenen Korbes,
vereinzelt auch aufs Gewand aufgesetzt.
7) Derselbe Schmuck findet sich mehr oder weniger
bei allen weiblichen Personen. Ein Haarband
tragen auch die männlichen Gestalten und Eroten
des Bildes.
8) Vgl. Wien. Vorlegebl. a. a. O. Nr. 1. Samml.
Sab. a. a. O. u. Schol. zu Eur. Phoen. 344.
9) »Zu griechischen Hochzeitsgebräuchen« in der
Festschrift für Benndorf S. 184. Ebenda S. 181
eine Uebersicht über das literarische Material. —
Vgl. Wien. Vlgbl. a. a. O. Nr. 17; für die
Schleierfassung noch Arch. Zg. 18S2 T. V.
Jahrbuch des archäologischen Instituts XV.
Furtwängler Samml. Sab. T. LVIII. Studniczka
Beiträge zur Geschichte der altgriechischen
Tracht S. 126. Helbig, Das homerische Epos
aus den Denkmälern erläutert 2. Auf!., S. 216 ff.
10) Ueber die Verhüllung der Braut bei Indo-
germanen und Finnen s. L. v. Schroeder,
Hochzeitsbräuche der Esten (Verhandl. der
gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat
B. XIII) Dorpat 1888 S. 220 ff.
n) E. Petersen Rom. Mitth. VII (1892) 57.
12) Ebd. S. 55 — An der Deutung Petersens wird
der Widerspruch Fritzes (Rauchopfer bei den
Griechen S. 30) nichts ändern.
13) Eine ähnliche Beschränkung auf das Wesentlichste
zeigt die Darstellung von Anfang und Ende des
Hochzeitszuges auf der Vase der Samml. Sabou-
roff (Taf. LVIII). Vgl. den Text dazu von Furt-
wängler.
14) Man mag hier wie auf der Pyxis des- Louvre
13
Die Zeichnung des Hauptbildes ist flott und überaus graziös6. Es ist auf
den ersten Blick klar, dafs wir es mit einer Hochzeitsdarstellung zu thun haben,
wie ein Vergleich mit den von Benndorf in den Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. VIII
zusammengestellten Abbildungen lehrt: zwischen zwei Thürflügeln steht die Mutter
des Bräutigams in dorischem Gewände, mit Kopfbinde, Ohrringen, Halskette und
Armspangen geschmückt7; sie hält in jeder Hand eine Fackel und blickt dem auf
sie zukommenden Paare entgegen, das sie an der Schwelle seiner Behausung er-
wartet8. Der Mann hat mit der Rechten die linke Hand seiner Frau gefafst, in der
Weise wie es als für die Heimführung charakteristisch zuletzt von P. Sticotti mit
Recht hervorgehoben worden ist9; die durch Schleier und Perlenschmuck ausge-
zeichnete junge Frau wird von Eros geleitet. So weit stehen uns parallele Dar-
stellungen zur Verfügung. Etwas Neues hingegen bietet der von einem Jüngling
geführte Zug Gefäfse tragender Mädchen: Hochzeitsgeschenke sind es, die dargebracht
werden, das ist deutlich; aber es erregt Befremden einmal, dafs der Hochzeitszug
durch die auf dem Stuhl sitzende P'rau unterbrochen wird, dann aber auch, dafs die
vom Zuge losgelöste, am Schlufs der Darstellung mit dem Rücken gegen die Gefäfse
tragenden Mädchen ebenfalls auf einem Stuhl sitzende Gestalt vollkommen unorganisch
placiert erscheint. Die Schwierigkeit löst sich durch die Anerkennung einer Drei-
teilung des Bildes: die eben erwähnte, bis auf Kopf und Hals völlig verhüllte,
sitzende weibliche Figur ist die Braut10, deren Vorbereitung und Schmückung zur
Hochzeit durch die von dem Eros getragene Perlenschnur symbolisiert wird; man
darf in dieser wohl dieselbe Perlenschnur erkennen, die im zweiten Teil des Bildes
das Haar der Braut ziert. Das vor ihr stehende Thymiaterion, im Kreise Aphrodites
überaus häufig11, findet seine Parallele auf dem Seitenrelief des Eudovisischen
Thrones, das eine räuchernde Braut vorstellt12. Der zweite Teil giebt uns im engen
Rahmen einen Ausschnitt des ganzen Hochzeitszuges13: das Brautpaar selbst14, das
°) Reiche Innenzeichnung mit feinen Pinselstrichen,
Körper der Eroten mit weifser Deckfarbe, Haare
und Innenzeichnung der Eroten mit verdünntem
Firnis. Eine dünne gelbliche Farbe ist verwendet
für den Stuhl der vor dem Thymiaterion sitzen-
den Frau, für das Kästchen der einen Dienerin
und das Innere des von dieser getragenen Korbes,
vereinzelt auch aufs Gewand aufgesetzt.
7) Derselbe Schmuck findet sich mehr oder weniger
bei allen weiblichen Personen. Ein Haarband
tragen auch die männlichen Gestalten und Eroten
des Bildes.
8) Vgl. Wien. Vorlegebl. a. a. O. Nr. 1. Samml.
Sab. a. a. O. u. Schol. zu Eur. Phoen. 344.
9) »Zu griechischen Hochzeitsgebräuchen« in der
Festschrift für Benndorf S. 184. Ebenda S. 181
eine Uebersicht über das literarische Material. —
Vgl. Wien. Vlgbl. a. a. O. Nr. 17; für die
Schleierfassung noch Arch. Zg. 18S2 T. V.
Jahrbuch des archäologischen Instituts XV.
Furtwängler Samml. Sab. T. LVIII. Studniczka
Beiträge zur Geschichte der altgriechischen
Tracht S. 126. Helbig, Das homerische Epos
aus den Denkmälern erläutert 2. Auf!., S. 216 ff.
10) Ueber die Verhüllung der Braut bei Indo-
germanen und Finnen s. L. v. Schroeder,
Hochzeitsbräuche der Esten (Verhandl. der
gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat
B. XIII) Dorpat 1888 S. 220 ff.
n) E. Petersen Rom. Mitth. VII (1892) 57.
12) Ebd. S. 55 — An der Deutung Petersens wird
der Widerspruch Fritzes (Rauchopfer bei den
Griechen S. 30) nichts ändern.
13) Eine ähnliche Beschränkung auf das Wesentlichste
zeigt die Darstellung von Anfang und Ende des
Hochzeitszuges auf der Vase der Samml. Sabou-
roff (Taf. LVIII). Vgl. den Text dazu von Furt-
wängler.
14) Man mag hier wie auf der Pyxis des- Louvre
13