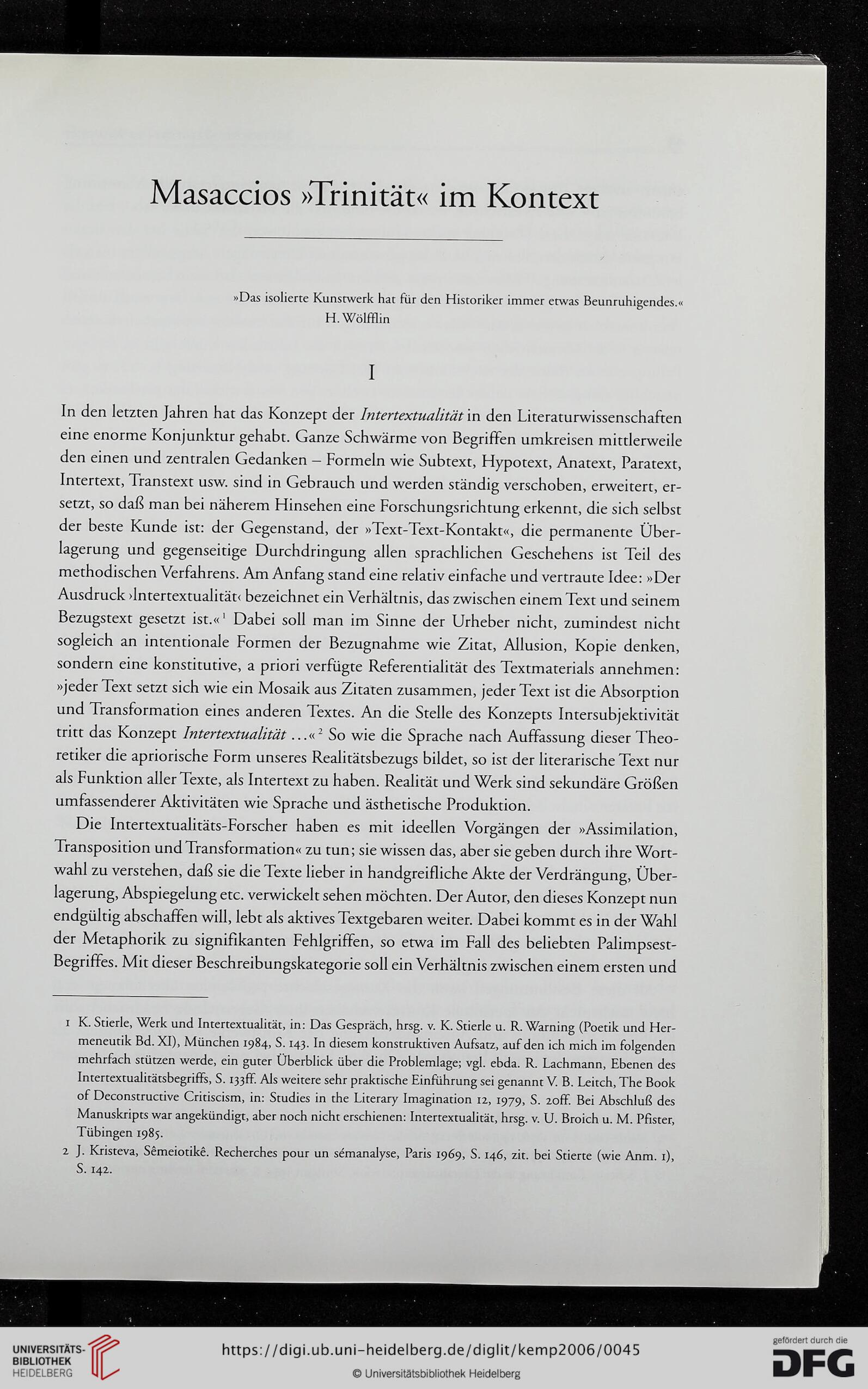Masaccios »Trinität« im Kontext
»Das isolierte Kunstwerk hat für den Historiker immer etwas Beunruhigendes.«
H.Wölfflin
I
In den letzten Jahren hat das Konzept der Intertextualität in den Literaturwissenschaften
eine enorme Konjunktur gehabt. Ganze Schwärme von Begriffen umkreisen mittlerweile
den einen und zentralen Gedanken - Formeln wie Subtext, Hypotext, Anatext, Paratext,
Intertext, Transtext usw. sind in Gebrauch und werden ständig verschoben, erweitert, er-
setzt, so daß man bei näherem Hinsehen eine Forschungsrichtung erkennt, die sich selbst
der beste Kunde ist: der Gegenstand, der »Text-Text-Kontakt«, die permanente Über-
lagerung und gegenseitige Durchdringung allen sprachlichen Geschehens ist Teil des
methodischen Verfahrens. Am Anfang stand eine relativ einfache und vertraute Idee: »Der
Ausdruck dntertextualität« bezeichnet ein Verhältnis, das zwischen einem Text und seinem
Bezugstext gesetzt ist.«' Dabei soll man im Sinne der Urheber nicht, zumindest nicht
sogleich an intentionale Formen der Bezugnahme wie Zitat, Allusion, Kopie denken,
sondern eine konstitutive, a priori verfügte Referentialität des Textmaterials annehmen:
»jeder Text setzt sich wie ein Mosaik aus Zitaten zusammen, jeder Text ist die Absorption
und Transformation eines anderen Textes. An die Stelle des Konzepts Intersubjektivität
tritt das Konzept Intertextualität . ..«1 2 So wie die Sprache nach Auffassung dieser Theo-
retiker die apriorische Form unseres Realitätsbezugs bildet, so ist der literarische Text nur
als Funktion allerTexte, als Intertext zu haben. Realität und Werk sind sekundäre Größen
umfassenderer Aktivitäten wie Sprache und ästhetische Produktion.
Die Intertextualitäts-Forscher haben es mit ideellen Vorgängen der »Assimilation,
Transposition und Transformation« zu tun; sie wissen das, aber sie geben durch ihre Wort-
wahl zu verstehen, daß sie die Texte lieber in handgreifliche Akte der Verdrängung, Über-
lagerung, Abspiegelung etc. verwickelt sehen möchten. Der Autor, den dieses Konzept nun
endgültig abschaffen will, lebt als aktives Textgebaren weiter. Dabei kommt es in der Wahl
der Metaphorik zu signifikanten Fehlgriffen, so etwa im Fall des beliebten Palimpsest-
Begriffes. Mit dieser Beschreibungskategorie soll ein Verhältnis zwischen einem ersten und
1 K. Stierle, Werk und Intertextualität, in: Das Gespräch, hrsg. v. K. Stierle u. R. Warning (Poetik und Her-
meneutik Bd. XI), München 1984, S. 143. In diesem konstruktiven Aufsatz, auf den ich mich im folgenden
mehrfach stützen werde, ein guter Überblick über die Problemlage; vgl. ebda. R. Lachmann, Ebenen des
Intertextualitätsbegriffs, S. 133fr Als weitere sehr praktische Einführung sei genannt V. B. Leitch, The Book
of Deconstructive Critiscism, in: Studies in the Literary Imagination 12, 1979, S. zoff. Bei Abschluß des
Manuskripts war angekündigt, aber noch nicht erschienen: Intertextualität, hrsg. v. U. Broich u. M. Pfister,
Tübingen 1985.
2 J. Kristeva, Semeiotike. Recherches pour un semanalyse, Paris 1969, S. 146, zit. bei Stierte (wie Anm. 1),
S. 142.
»Das isolierte Kunstwerk hat für den Historiker immer etwas Beunruhigendes.«
H.Wölfflin
I
In den letzten Jahren hat das Konzept der Intertextualität in den Literaturwissenschaften
eine enorme Konjunktur gehabt. Ganze Schwärme von Begriffen umkreisen mittlerweile
den einen und zentralen Gedanken - Formeln wie Subtext, Hypotext, Anatext, Paratext,
Intertext, Transtext usw. sind in Gebrauch und werden ständig verschoben, erweitert, er-
setzt, so daß man bei näherem Hinsehen eine Forschungsrichtung erkennt, die sich selbst
der beste Kunde ist: der Gegenstand, der »Text-Text-Kontakt«, die permanente Über-
lagerung und gegenseitige Durchdringung allen sprachlichen Geschehens ist Teil des
methodischen Verfahrens. Am Anfang stand eine relativ einfache und vertraute Idee: »Der
Ausdruck dntertextualität« bezeichnet ein Verhältnis, das zwischen einem Text und seinem
Bezugstext gesetzt ist.«' Dabei soll man im Sinne der Urheber nicht, zumindest nicht
sogleich an intentionale Formen der Bezugnahme wie Zitat, Allusion, Kopie denken,
sondern eine konstitutive, a priori verfügte Referentialität des Textmaterials annehmen:
»jeder Text setzt sich wie ein Mosaik aus Zitaten zusammen, jeder Text ist die Absorption
und Transformation eines anderen Textes. An die Stelle des Konzepts Intersubjektivität
tritt das Konzept Intertextualität . ..«1 2 So wie die Sprache nach Auffassung dieser Theo-
retiker die apriorische Form unseres Realitätsbezugs bildet, so ist der literarische Text nur
als Funktion allerTexte, als Intertext zu haben. Realität und Werk sind sekundäre Größen
umfassenderer Aktivitäten wie Sprache und ästhetische Produktion.
Die Intertextualitäts-Forscher haben es mit ideellen Vorgängen der »Assimilation,
Transposition und Transformation« zu tun; sie wissen das, aber sie geben durch ihre Wort-
wahl zu verstehen, daß sie die Texte lieber in handgreifliche Akte der Verdrängung, Über-
lagerung, Abspiegelung etc. verwickelt sehen möchten. Der Autor, den dieses Konzept nun
endgültig abschaffen will, lebt als aktives Textgebaren weiter. Dabei kommt es in der Wahl
der Metaphorik zu signifikanten Fehlgriffen, so etwa im Fall des beliebten Palimpsest-
Begriffes. Mit dieser Beschreibungskategorie soll ein Verhältnis zwischen einem ersten und
1 K. Stierle, Werk und Intertextualität, in: Das Gespräch, hrsg. v. K. Stierle u. R. Warning (Poetik und Her-
meneutik Bd. XI), München 1984, S. 143. In diesem konstruktiven Aufsatz, auf den ich mich im folgenden
mehrfach stützen werde, ein guter Überblick über die Problemlage; vgl. ebda. R. Lachmann, Ebenen des
Intertextualitätsbegriffs, S. 133fr Als weitere sehr praktische Einführung sei genannt V. B. Leitch, The Book
of Deconstructive Critiscism, in: Studies in the Literary Imagination 12, 1979, S. zoff. Bei Abschluß des
Manuskripts war angekündigt, aber noch nicht erschienen: Intertextualität, hrsg. v. U. Broich u. M. Pfister,
Tübingen 1985.
2 J. Kristeva, Semeiotike. Recherches pour un semanalyse, Paris 1969, S. 146, zit. bei Stierte (wie Anm. 1),
S. 142.