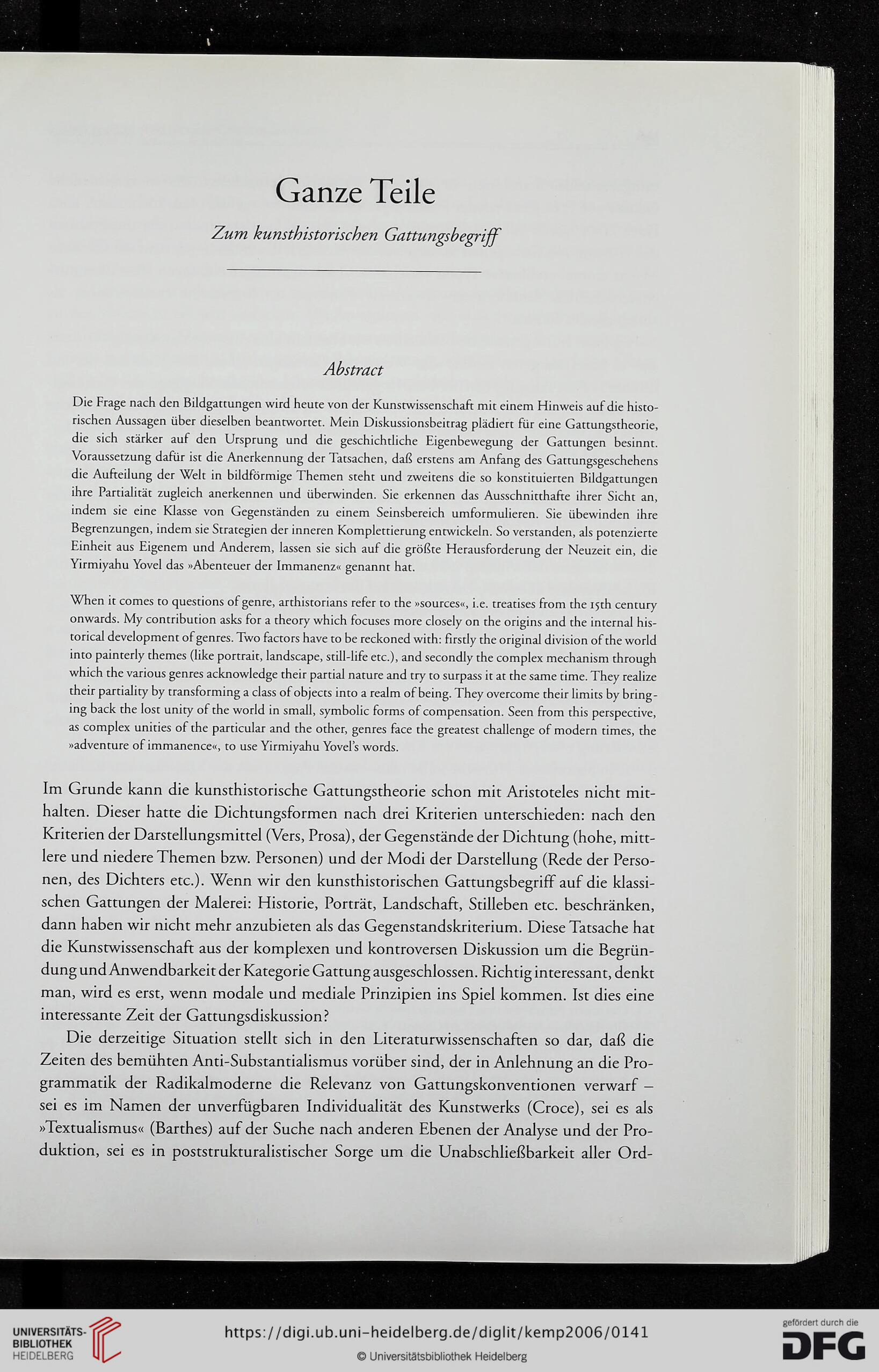Ganze Teile
Zum kunsthistorischen Gattungsbegriff
Abstract
Die Frage nach den Bildgattungen wird heute von der Kunstwissenschaft mit einem Hinweis auf die histo-
rischen Aussagen über dieselben beantwortet. Mein Diskussionsbeitrag plädiert für eine Gattungstheorie,
die sich stärker auf den Ursprung und die geschichtliche Eigenbewegung der Gattungen besinnt.
Voraussetzung dafür ist die Anerkennung der Tatsachen, daß erstens am Anfang des Gattungsgeschehens
die Aufteilung der Welt in bildförmige Themen steht und zweitens die so konstituierten Bildgattungen
ihre Partialität zugleich anerkennen und überwinden. Sie erkennen das Ausschnitthafte ihrer Sicht an,
indem sie eine Klasse von Gegenständen zu einem Seinsbereich umformulieren. Sie übewinden ihre
Begrenzungen, indem sie Strategien der inneren Komplettierung entwickeln. So verstanden, als potenzierte
Einheit aus Eigenem und Anderem, lassen sie sich auf die größte Herausforderung der Neuzeit ein, die
Yirmiyahu Yovel das »Abenteuer der Immanenz« genannt hat.
When it comes to questions of genre, arthistorians refer to the »sources«, i.e. treatises from the I5th Century
onwards. My contribution asks for a theory which focuses more closely on the origins and the internal his-
torical development of genres. Two factors have to be reckoned with: firstly the original division of the world
into painterly themes (like portrait, landscape, still-life etc.), and secondly the complex mechanism through
which the various genres acknowledge their partial nature and try to surpass it at the same time. They realize
their partiality by transforming a dass of objects into a realm of being. They overcome their Ümits by bring-
ing back the lost unity of the world in small, symbolic forms of compensation. Seen from this perspective,
as complex unities of the particular and the other, genres face the greatest challenge of modern times, the
»adventure of immanence«, to use Yirmiyahu Yovel’s words.
Im Grunde kann die kunsthistorische Gattungstheorie schon mit Aristoteles nicht mit-
halten. Dieser hatte die Dichtungsformen nach drei Kriterien unterschieden: nach den
Kriterien der Darstellungsmittel (Vers, Prosa), der Gegenstände der Dichtung (hohe, mitt-
lere und niedere Themen bzw. Personen) und der Modi der Darstellung (Rede der Perso-
nen, des Dichters etc.). Wenn wir den kunsthistorischen Gattungsbegriff auf die klassi-
schen Gattungen der Malerei: Historie, Porträt, Landschaft, Stilleben etc. beschränken,
dann haben wir nicht mehr anzubieten als das Gegenstandskriterium. Diese Tatsache hat
die Kunstwissenschaft aus der komplexen und kontroversen Diskussion um die Begrün-
dung und Anwendbarkeit der Kategorie Gattung ausgeschlossen. Richtig interessant, denkt
man, wird es erst, wenn modale und mediale Prinzipien ins Spiel kommen. Ist dies eine
interessante Zeit der Gattungsdiskussion?
Die derzeitige Situation stellt sich in den Literaturwissenschaften so dar, daß die
Zeiten des bemühten Anti-Substantialismus vorüber sind, der in Anlehnung an die Pro-
grammatik der Radikalmoderne die Relevanz von Gattungskonventionen verwarf -
sei es im Namen der unverfügbaren Individualität des Kunstwerks (Croce), sei es als
»Textualismus« (Barthes) auf der Suche nach anderen Ebenen der Analyse und der Pro-
duktion, sei es in poststrukturalistischer Sorge um die Unabschließbarkeit aller Ord-
Zum kunsthistorischen Gattungsbegriff
Abstract
Die Frage nach den Bildgattungen wird heute von der Kunstwissenschaft mit einem Hinweis auf die histo-
rischen Aussagen über dieselben beantwortet. Mein Diskussionsbeitrag plädiert für eine Gattungstheorie,
die sich stärker auf den Ursprung und die geschichtliche Eigenbewegung der Gattungen besinnt.
Voraussetzung dafür ist die Anerkennung der Tatsachen, daß erstens am Anfang des Gattungsgeschehens
die Aufteilung der Welt in bildförmige Themen steht und zweitens die so konstituierten Bildgattungen
ihre Partialität zugleich anerkennen und überwinden. Sie erkennen das Ausschnitthafte ihrer Sicht an,
indem sie eine Klasse von Gegenständen zu einem Seinsbereich umformulieren. Sie übewinden ihre
Begrenzungen, indem sie Strategien der inneren Komplettierung entwickeln. So verstanden, als potenzierte
Einheit aus Eigenem und Anderem, lassen sie sich auf die größte Herausforderung der Neuzeit ein, die
Yirmiyahu Yovel das »Abenteuer der Immanenz« genannt hat.
When it comes to questions of genre, arthistorians refer to the »sources«, i.e. treatises from the I5th Century
onwards. My contribution asks for a theory which focuses more closely on the origins and the internal his-
torical development of genres. Two factors have to be reckoned with: firstly the original division of the world
into painterly themes (like portrait, landscape, still-life etc.), and secondly the complex mechanism through
which the various genres acknowledge their partial nature and try to surpass it at the same time. They realize
their partiality by transforming a dass of objects into a realm of being. They overcome their Ümits by bring-
ing back the lost unity of the world in small, symbolic forms of compensation. Seen from this perspective,
as complex unities of the particular and the other, genres face the greatest challenge of modern times, the
»adventure of immanence«, to use Yirmiyahu Yovel’s words.
Im Grunde kann die kunsthistorische Gattungstheorie schon mit Aristoteles nicht mit-
halten. Dieser hatte die Dichtungsformen nach drei Kriterien unterschieden: nach den
Kriterien der Darstellungsmittel (Vers, Prosa), der Gegenstände der Dichtung (hohe, mitt-
lere und niedere Themen bzw. Personen) und der Modi der Darstellung (Rede der Perso-
nen, des Dichters etc.). Wenn wir den kunsthistorischen Gattungsbegriff auf die klassi-
schen Gattungen der Malerei: Historie, Porträt, Landschaft, Stilleben etc. beschränken,
dann haben wir nicht mehr anzubieten als das Gegenstandskriterium. Diese Tatsache hat
die Kunstwissenschaft aus der komplexen und kontroversen Diskussion um die Begrün-
dung und Anwendbarkeit der Kategorie Gattung ausgeschlossen. Richtig interessant, denkt
man, wird es erst, wenn modale und mediale Prinzipien ins Spiel kommen. Ist dies eine
interessante Zeit der Gattungsdiskussion?
Die derzeitige Situation stellt sich in den Literaturwissenschaften so dar, daß die
Zeiten des bemühten Anti-Substantialismus vorüber sind, der in Anlehnung an die Pro-
grammatik der Radikalmoderne die Relevanz von Gattungskonventionen verwarf -
sei es im Namen der unverfügbaren Individualität des Kunstwerks (Croce), sei es als
»Textualismus« (Barthes) auf der Suche nach anderen Ebenen der Analyse und der Pro-
duktion, sei es in poststrukturalistischer Sorge um die Unabschließbarkeit aller Ord-