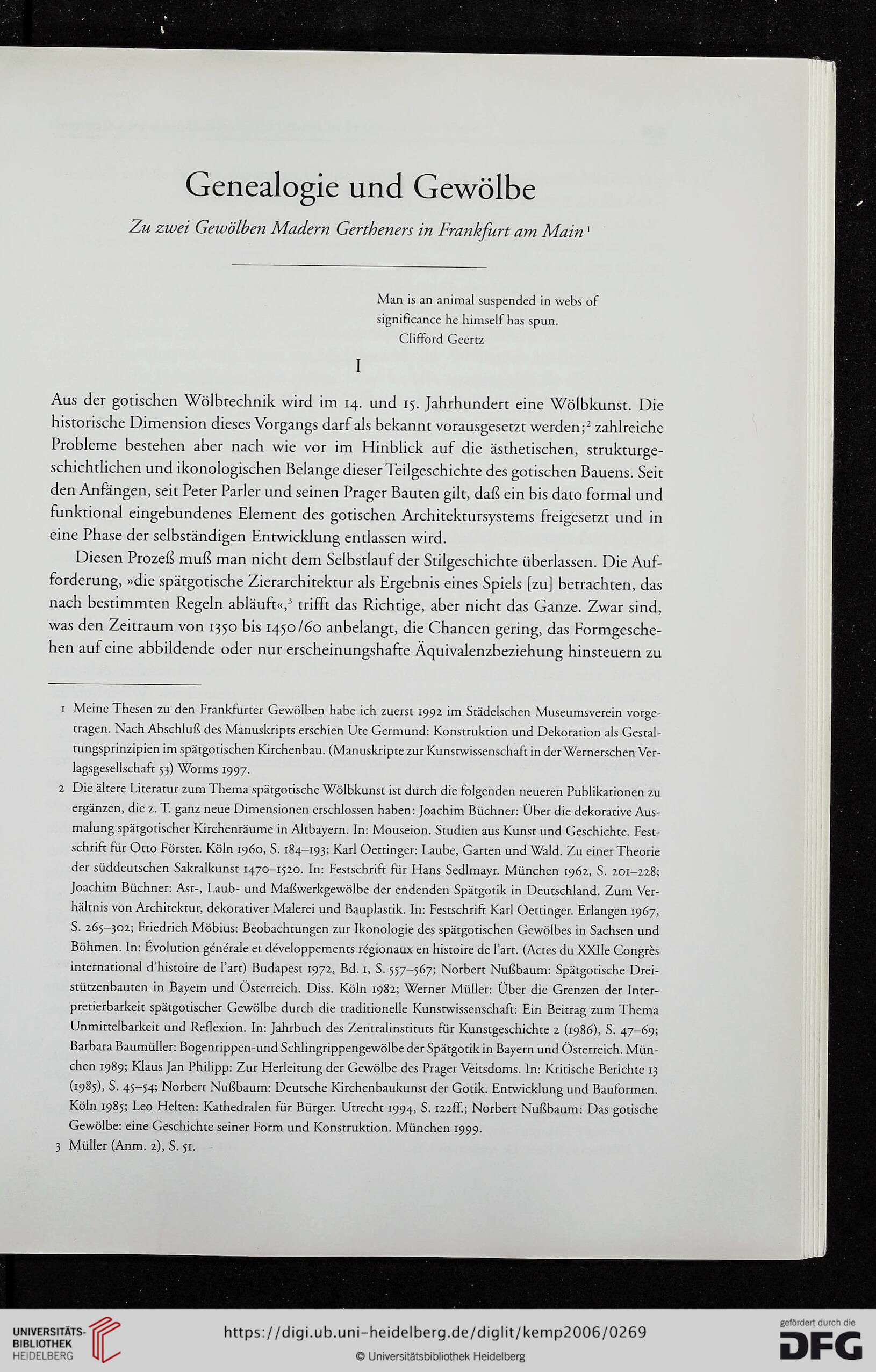Genealogie und Gewölbe
Zu zwei Gewölben Madern Gertheners in Frankfurt am Main'
Man is an animal suspended in webs of
significance he himself has spun.
Clifford Geertz
I
Aus der gotischen Wölbtechnik wird im 14. und 15. Jahrhundert eine Wölbkunst. Die
historische Dimension dieses Vorgangs darf als bekannt vorausgesetzt werden;1 2 zahlreiche
Probleme bestehen aber nach wie vor im Hinblick auf die ästhetischen, strukturge-
schichtlichen und ikonologischen Belange dieser Teilgeschichte des gotischen Bauens. Seit
den Anfängen, seit Peter Parier und seinen Prager Bauten gilt, daß ein bis dato formal und
funktional eingebundenes Element des gotischen Architektursystems freigesetzt und in
eine Phase der selbständigen Entwicklung entlassen wird.
Diesen Prozeß muß man nicht dem Selbstlauf der Stilgeschichte überlassen. Die Auf-
forderung, »die spätgotische Zierarchitektur als Ergebnis eines Spiels [zu] betrachten, das
nach bestimmten Regeln abläuft«,3 trifft das Richtige, aber nicht das Ganze. Zwar sind,
was den Zeitraum von 1350 bis 1450/60 anbelangt, die Chancen gering, das Formgesche-
hen auf eine abbildende oder nur erscheinungshafte Aquivalenzbeziehung hinsteuern zu
1 Meine Thesen zu den Frankfurter Gewölben habe ich zuerst 1992 im Städelschen Museumsverein vorge-
tragen. Nach Abschluß des Manuskripts erschien Ute Germund: Konstruktion und Dekoration als Gestal-
tungsprinzipien im spätgotischen Kirchenbau. (Manuskripte zur Kunstwissenschaft in der Wernerschen Ver-
lagsgesellschaft 53) Worms 1997.
2 Die ältere Literatur zum Thema spätgotische Wölbkunst ist durch die folgenden neueren Publikationen zu
ergänzen, die z. T. ganz neue Dimensionen erschlossen haben: Joachim Büchner: Über die dekorative Aus-
malung spätgotischer Kirchenräume in Altbayern. In: Mouseion. Studien aus Kunst und Geschichte. Fest-
schrift für Otto Förster. Köln 1960, S. 184-193; Karl Oettinger: Laube, Garten und Wald. Zu einer Theorie
der süddeutschen Sakralkunst 1470—1520. In: Festschrift für Hans Sedlmayr. München 1962, S. 201—228;
Joachim Büchner: Ast-, Laub- und Maßwerkgewölbe der endenden Spätgotik in Deutschland. Zum Ver-
hältnis von Architektur, dekorativer Malerei und Bauplastik. In: Festschrift Karl Oettinger. Erlangen 1967,
S. 265-302; Friedrich Möbius: Beobachtungen zur Ikonologie des spätgotischen Gewölbes in Sachsen und
Böhmen. In: Evolution generale et d^veloppements r^gionaux en histoire de l’art. (Actes du XXIle Congr&s
international d’histoire de l’art) Budapest 1972, Bd. 1, S. 557-567; Norbert Nußbaum: Spätgotische Drei-
stützenbauten in Bayern und Österreich. Diss. Köln 1982; Werner Müller: Über die Grenzen der Inter-
pretierbarkeit spätgotischer Gewölbe durch die traditionelle Kunstwissenschaft: Ein Beitrag zum Thema
Unmittelbarkeit und Reflexion. In: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte 2 (1986), S. 47-69;
Barbara Baumüller: Bogenrippen-und Schlingrippengewölbe der Spätgotik in Bayern und Österreich. Mün-
chen 1989; Klaus Jan Philipp: Zur Herleitung der Gewölbe des Prager Veitsdoms. In: Kritische Berichte 13
(1985), S. 45-54; Norbert Nußbaum: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik. Entwicklung und Bauformen.
Köln 1985; Leo Helten: Kathedralen für Bürger. Utrecht 1994, S. I22ff.; Norbert Nußbaum: Das gotische
Gewölbe: eine Geschichte seiner Form und Konstruktion. München 1999.
3 Müller (Anm. 2), S. 51.
Zu zwei Gewölben Madern Gertheners in Frankfurt am Main'
Man is an animal suspended in webs of
significance he himself has spun.
Clifford Geertz
I
Aus der gotischen Wölbtechnik wird im 14. und 15. Jahrhundert eine Wölbkunst. Die
historische Dimension dieses Vorgangs darf als bekannt vorausgesetzt werden;1 2 zahlreiche
Probleme bestehen aber nach wie vor im Hinblick auf die ästhetischen, strukturge-
schichtlichen und ikonologischen Belange dieser Teilgeschichte des gotischen Bauens. Seit
den Anfängen, seit Peter Parier und seinen Prager Bauten gilt, daß ein bis dato formal und
funktional eingebundenes Element des gotischen Architektursystems freigesetzt und in
eine Phase der selbständigen Entwicklung entlassen wird.
Diesen Prozeß muß man nicht dem Selbstlauf der Stilgeschichte überlassen. Die Auf-
forderung, »die spätgotische Zierarchitektur als Ergebnis eines Spiels [zu] betrachten, das
nach bestimmten Regeln abläuft«,3 trifft das Richtige, aber nicht das Ganze. Zwar sind,
was den Zeitraum von 1350 bis 1450/60 anbelangt, die Chancen gering, das Formgesche-
hen auf eine abbildende oder nur erscheinungshafte Aquivalenzbeziehung hinsteuern zu
1 Meine Thesen zu den Frankfurter Gewölben habe ich zuerst 1992 im Städelschen Museumsverein vorge-
tragen. Nach Abschluß des Manuskripts erschien Ute Germund: Konstruktion und Dekoration als Gestal-
tungsprinzipien im spätgotischen Kirchenbau. (Manuskripte zur Kunstwissenschaft in der Wernerschen Ver-
lagsgesellschaft 53) Worms 1997.
2 Die ältere Literatur zum Thema spätgotische Wölbkunst ist durch die folgenden neueren Publikationen zu
ergänzen, die z. T. ganz neue Dimensionen erschlossen haben: Joachim Büchner: Über die dekorative Aus-
malung spätgotischer Kirchenräume in Altbayern. In: Mouseion. Studien aus Kunst und Geschichte. Fest-
schrift für Otto Förster. Köln 1960, S. 184-193; Karl Oettinger: Laube, Garten und Wald. Zu einer Theorie
der süddeutschen Sakralkunst 1470—1520. In: Festschrift für Hans Sedlmayr. München 1962, S. 201—228;
Joachim Büchner: Ast-, Laub- und Maßwerkgewölbe der endenden Spätgotik in Deutschland. Zum Ver-
hältnis von Architektur, dekorativer Malerei und Bauplastik. In: Festschrift Karl Oettinger. Erlangen 1967,
S. 265-302; Friedrich Möbius: Beobachtungen zur Ikonologie des spätgotischen Gewölbes in Sachsen und
Böhmen. In: Evolution generale et d^veloppements r^gionaux en histoire de l’art. (Actes du XXIle Congr&s
international d’histoire de l’art) Budapest 1972, Bd. 1, S. 557-567; Norbert Nußbaum: Spätgotische Drei-
stützenbauten in Bayern und Österreich. Diss. Köln 1982; Werner Müller: Über die Grenzen der Inter-
pretierbarkeit spätgotischer Gewölbe durch die traditionelle Kunstwissenschaft: Ein Beitrag zum Thema
Unmittelbarkeit und Reflexion. In: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte 2 (1986), S. 47-69;
Barbara Baumüller: Bogenrippen-und Schlingrippengewölbe der Spätgotik in Bayern und Österreich. Mün-
chen 1989; Klaus Jan Philipp: Zur Herleitung der Gewölbe des Prager Veitsdoms. In: Kritische Berichte 13
(1985), S. 45-54; Norbert Nußbaum: Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik. Entwicklung und Bauformen.
Köln 1985; Leo Helten: Kathedralen für Bürger. Utrecht 1994, S. I22ff.; Norbert Nußbaum: Das gotische
Gewölbe: eine Geschichte seiner Form und Konstruktion. München 1999.
3 Müller (Anm. 2), S. 51.