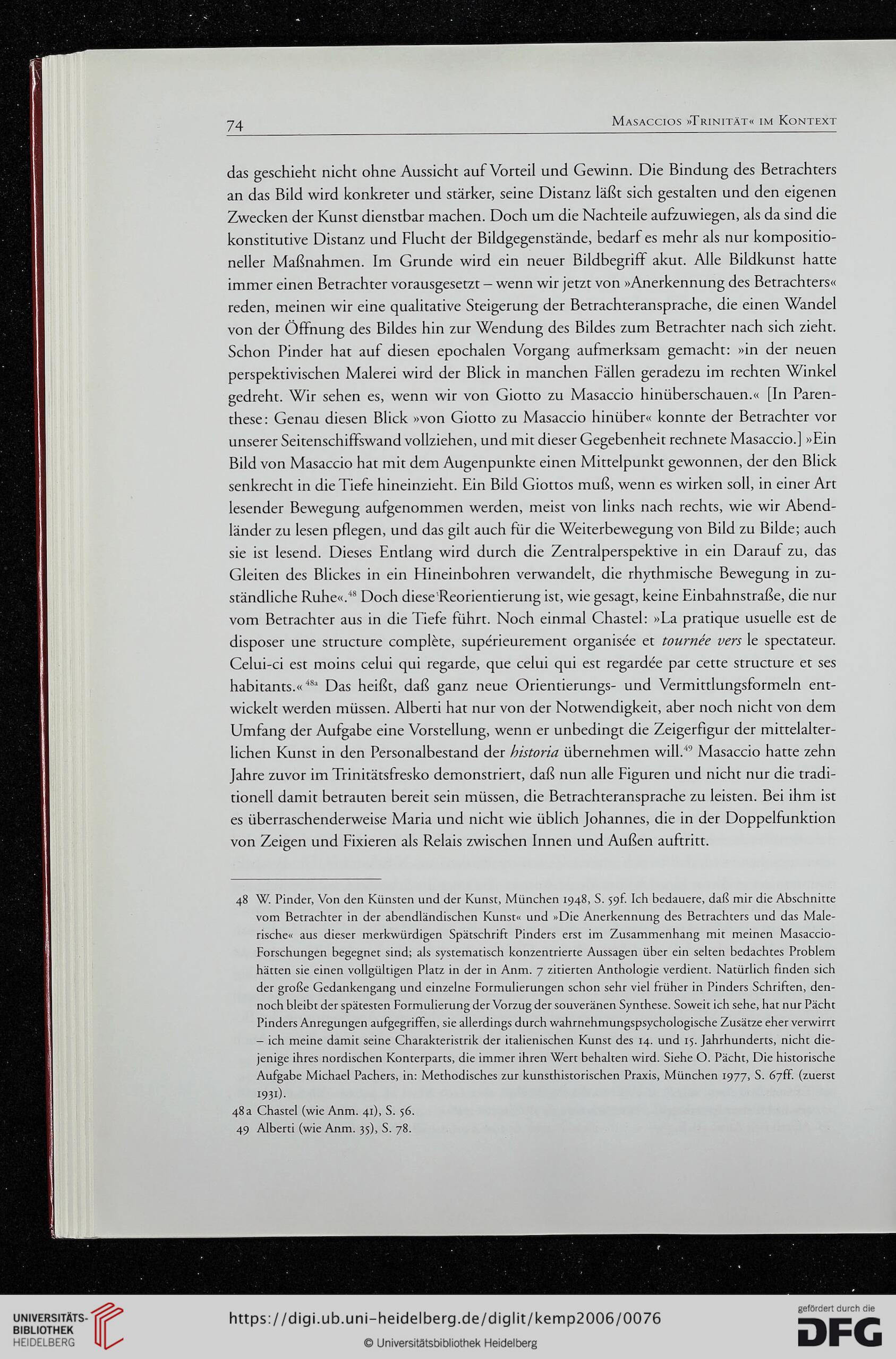74
Masaccios »Trinität« im Kontext
das geschieht nicht ohne Aussicht auf Vorteil und Gewinn. Die Bindung des Betrachters
an das Bild wird konkreter und stärker, seine Distanz läßt sich gestalten und den eigenen
Zwecken der Kunst dienstbar machen. Doch um die Nachteile aufzuwiegen, als da sind die
konstitutive Distanz und Flucht der Bildgegenstände, bedarf es mehr als nur kompositio-
neller Maßnahmen. Im Grunde wird ein neuer Bildbegriff akut. Alle Bildkunst hatte
immer einen Betrachter vorausgesetzt - wenn wir jetzt von »Anerkennung des Betrachters«
reden, meinen wir eine qualitative Steigerung der Betrachteransprache, die einen Wandel
von der Öffnung des Bildes hin zur Wendung des Bildes zum Betrachter nach sich zieht.
Schon Pinder hat auf diesen epochalen Vorgang aufmerksam gemacht: »in der neuen
perspektivischen Malerei wird der Blick in manchen Fällen geradezu im rechten Winkel
gedreht. Wir sehen es, wenn wir von Giotto zu Masaccio hinüberschauen.« [In Paren-
these: Genau diesen Blick »von Giotto zu Masaccio hinüber« konnte der Betrachter vor
unserer Seitenschiffswand vollziehen, und mit dieser Gegebenheit rechnete Masaccio.] »Ein
Bild von Masaccio hat mit dem Augenpunkte einen Mittelpunkt gewonnen, der den Blick
senkrecht in die Tiefe hineinzieht. Ein Bild Giottos muß, wenn es wirken soll, in einer Art
lesender Bewegung aufgenommen werden, meist von links nach rechts, wie wir Abend-
länder zu lesen pflegen, und das gilt auch für die Weiterbewegung von Bild zu Bilde; auch
sie ist lesend. Dieses Entlang wird durch die Zentralperspektive in ein Darauf zu, das
Gleiten des Blickes in ein Hineinbohren verwandelt, die rhythmische Bewegung in zu-
ständliche Ruhe«.48 49 Doch diese Reorientierung ist, wie gesagt, keine Einbahnstraße, die nur
vom Betrachter aus in die Tiefe führt. Noch einmal Chastel: »La pratique usuelle est de
disposer une structure complete, superieurement organisee et tournee vers le spectateur.
Celui-ci est moins celui qui regarde, que celui qui est regardee par cette structure et ses
habitants.«48a Das heißt, daß ganz neue Orientierungs- und Vermittlungsformeln ent-
wickelt werden müssen. Alberti hat nur von der Notwendigkeit, aber noch nicht von dem
Umfang der Aufgabe eine Vorstellung, wenn er unbedingt die Zeigerfigur der mittelalter-
lichen Kunst in den Personalbestand der historia übernehmen will.4’ Masaccio hatte zehn
Jahre zuvor im Trinitätsfresko demonstriert, daß nun alle Figuren und nicht nur die tradi-
tionell damit betrauten bereit sein müssen, die Betrachteransprache zu leisten. Bei ihm ist
es überraschenderweise Maria und nicht wie üblich Johannes, die in der Doppelfunktion
von Zeigen und Fixieren als Relais zwischen Innen und Außen auftritt.
48 W. Pinder, Von den Künsten und der Kunst, München 1948, S. 59h Ich bedauere, daß mir die Abschnitte
vom Betrachter in der abendländischen Kunst« und »Die Anerkennung des Betrachters und das Male-
rische« aus dieser merkwürdigen Spätschrift Pinders erst im Zusammenhang mit meinen Masaccio-
Forschungen begegnet sind; als systematisch konzentrierte Aussagen über ein selten bedachtes Problem
hätten sie einen vollgültigen Platz in der in Anm. 7 zitierten Anthologie verdient. Natürlich finden sich
der große Gedankengang und einzelne Formulierungen schon sehr viel früher in Pinders Schriften, den-
noch bleibt der spätesten Formulierung der Vorzug der souveränen Synthese. Soweit ich sehe, hat nur Pächt
Pinders Anregungen aufgegriffen, sie allerdings durch wahrnehmungspsychologische Zusätze eher verwirrt
— ich meine damit seine Charakteristik der italienischen Kunst des 14. und 15. Jahrhunderts, nicht die-
jenige ihres nordischen Konterparts, die immer ihren Wert behalten wird. Siehe O. Pächt, Die historische
Aufgabe Michael Pachers, in: Methodisches zur kunsthistorischen Praxis, München 1977, S. Gyff. (zuerst
I93i)-
48a Chastel (wie Anm. 41), S. 56.
49 Alberti (wie Anm. 35), S. 78.
Masaccios »Trinität« im Kontext
das geschieht nicht ohne Aussicht auf Vorteil und Gewinn. Die Bindung des Betrachters
an das Bild wird konkreter und stärker, seine Distanz läßt sich gestalten und den eigenen
Zwecken der Kunst dienstbar machen. Doch um die Nachteile aufzuwiegen, als da sind die
konstitutive Distanz und Flucht der Bildgegenstände, bedarf es mehr als nur kompositio-
neller Maßnahmen. Im Grunde wird ein neuer Bildbegriff akut. Alle Bildkunst hatte
immer einen Betrachter vorausgesetzt - wenn wir jetzt von »Anerkennung des Betrachters«
reden, meinen wir eine qualitative Steigerung der Betrachteransprache, die einen Wandel
von der Öffnung des Bildes hin zur Wendung des Bildes zum Betrachter nach sich zieht.
Schon Pinder hat auf diesen epochalen Vorgang aufmerksam gemacht: »in der neuen
perspektivischen Malerei wird der Blick in manchen Fällen geradezu im rechten Winkel
gedreht. Wir sehen es, wenn wir von Giotto zu Masaccio hinüberschauen.« [In Paren-
these: Genau diesen Blick »von Giotto zu Masaccio hinüber« konnte der Betrachter vor
unserer Seitenschiffswand vollziehen, und mit dieser Gegebenheit rechnete Masaccio.] »Ein
Bild von Masaccio hat mit dem Augenpunkte einen Mittelpunkt gewonnen, der den Blick
senkrecht in die Tiefe hineinzieht. Ein Bild Giottos muß, wenn es wirken soll, in einer Art
lesender Bewegung aufgenommen werden, meist von links nach rechts, wie wir Abend-
länder zu lesen pflegen, und das gilt auch für die Weiterbewegung von Bild zu Bilde; auch
sie ist lesend. Dieses Entlang wird durch die Zentralperspektive in ein Darauf zu, das
Gleiten des Blickes in ein Hineinbohren verwandelt, die rhythmische Bewegung in zu-
ständliche Ruhe«.48 49 Doch diese Reorientierung ist, wie gesagt, keine Einbahnstraße, die nur
vom Betrachter aus in die Tiefe führt. Noch einmal Chastel: »La pratique usuelle est de
disposer une structure complete, superieurement organisee et tournee vers le spectateur.
Celui-ci est moins celui qui regarde, que celui qui est regardee par cette structure et ses
habitants.«48a Das heißt, daß ganz neue Orientierungs- und Vermittlungsformeln ent-
wickelt werden müssen. Alberti hat nur von der Notwendigkeit, aber noch nicht von dem
Umfang der Aufgabe eine Vorstellung, wenn er unbedingt die Zeigerfigur der mittelalter-
lichen Kunst in den Personalbestand der historia übernehmen will.4’ Masaccio hatte zehn
Jahre zuvor im Trinitätsfresko demonstriert, daß nun alle Figuren und nicht nur die tradi-
tionell damit betrauten bereit sein müssen, die Betrachteransprache zu leisten. Bei ihm ist
es überraschenderweise Maria und nicht wie üblich Johannes, die in der Doppelfunktion
von Zeigen und Fixieren als Relais zwischen Innen und Außen auftritt.
48 W. Pinder, Von den Künsten und der Kunst, München 1948, S. 59h Ich bedauere, daß mir die Abschnitte
vom Betrachter in der abendländischen Kunst« und »Die Anerkennung des Betrachters und das Male-
rische« aus dieser merkwürdigen Spätschrift Pinders erst im Zusammenhang mit meinen Masaccio-
Forschungen begegnet sind; als systematisch konzentrierte Aussagen über ein selten bedachtes Problem
hätten sie einen vollgültigen Platz in der in Anm. 7 zitierten Anthologie verdient. Natürlich finden sich
der große Gedankengang und einzelne Formulierungen schon sehr viel früher in Pinders Schriften, den-
noch bleibt der spätesten Formulierung der Vorzug der souveränen Synthese. Soweit ich sehe, hat nur Pächt
Pinders Anregungen aufgegriffen, sie allerdings durch wahrnehmungspsychologische Zusätze eher verwirrt
— ich meine damit seine Charakteristik der italienischen Kunst des 14. und 15. Jahrhunderts, nicht die-
jenige ihres nordischen Konterparts, die immer ihren Wert behalten wird. Siehe O. Pächt, Die historische
Aufgabe Michael Pachers, in: Methodisches zur kunsthistorischen Praxis, München 1977, S. Gyff. (zuerst
I93i)-
48a Chastel (wie Anm. 41), S. 56.
49 Alberti (wie Anm. 35), S. 78.