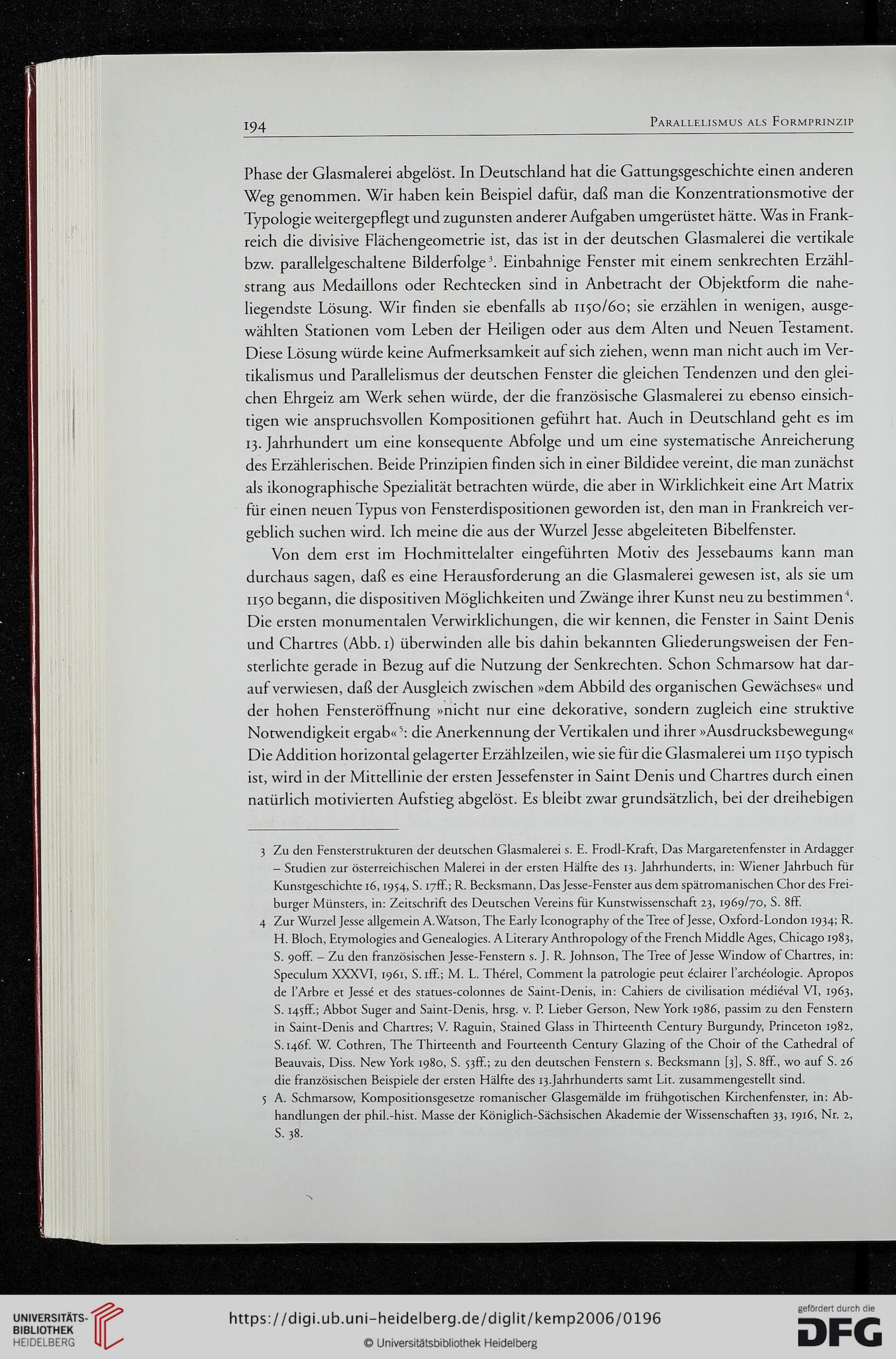194
Parallelismus als Formprinzip
Phase der Glasmalerei abgelöst. In Deutschland hat die Gattungsgeschichte einen anderen
Weg genommen. Wir haben kein Beispiel dafür, daß man die Konzentrationsmotive der
Typologie weitergepflegt und zugunsten anderer Aufgaben umgerüstet hätte. Was in Frank-
reich die divisive Flächengeometrie ist, das ist in der deutschen Glasmalerei die vertikale
bzw. parallelgeschaltene Bilderfolge3 4. Einbahnige Fenster mit einem senkrechten Erzähl-
strang aus Medaillons oder Rechtecken sind in Anbetracht der Objektform die nahe-
liegendste Lösung. Wir finden sie ebenfalls ab 1150/60; sie erzählen in wenigen, ausge-
wählten Stationen vom Leben der Heiligen oder aus dem Alten und Neuen Testament.
Diese Lösung würde keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn man nicht auch im Ver-
tikalismus und Parallelismus der deutschen Fenster die gleichen Tendenzen und den glei-
chen Ehrgeiz am Werk sehen würde, der die französische Glasmalerei zu ebenso einsich-
tigen wie anspruchsvollen Kompositionen geführt hat. Auch in Deutschland geht es im
13. Jahrhundert um eine konsequente Abfolge und um eine systematische Anreicherung
des Erzählerischen. Beide Prinzipien finden sich in einer Bildidee vereint, die man zunächst
als ikonographische Spezialität betrachten würde, die aber in Wirklichkeit eine Art Matrix
für einen neuen Typus von Fensterdispositionen geworden ist, den man in Frankreich ver-
geblich suchen wird. Ich meine die aus der Wurzel Jesse abgeleiteten Bibelfenster.
Von dem erst im Hochmittelalter eingeführten Motiv des Jessebaums kann man
durchaus sagen, daß es eine Herausforderung an die Glasmalerei gewesen ist, als sie um
1150 begann, die dispositiven Möglichkeiten und Zwänge ihrer Kunst neu zu bestimmen1.
Die ersten monumentalen Verwirklichungen, die wir kennen, die Fenster in Saint Denis
und Chartres (Abb. 1) überwinden alle bis dahin bekannten Gliederungsweisen der Fen-
sterlichte gerade in Bezug auf die Nutzung der Senkrechten. Schon Schmarsow hat dar-
auf verwiesen, daß der Ausgleich zwischen »dem Abbild des organischen Gewächses« und
der hohen Fensteröffnung »nicht nur eine dekorative, sondern zugleich eine struktive
Notwendigkeit ergab«5: die Anerkennung der Vertikalen und ihrer »Ausdrucksbewegung«
Die Addition horizontal gelagerter Erzählzeilen, wie sie für die Glasmalerei um 1150 typisch
ist, wird in der Mittellinie der ersten Jessefenster in Saint Denis und Chartres durch einen
natürlich motivierten Aufstieg abgelöst. Es bleibt zwar grundsätzlich, bei der dreihebigen
3 Zu den Fensterstrukturen der deutschen Glasmalerei s. E. Frodl-Kraft, Das Margaretenfenster in Ardagger
- Studien zur österreichischen Malerei in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in: Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte 16,1954, S. lyfif; R. Becksmann, Das Jesse-Fenster aus dem spätromanischen Chor des Frei-
burger Münsters, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 23, 1969/70, S. 8ff.
4 Zur Wurzel Jesse allgemein A. Watson, The Early Iconography of the Tree of Jesse, Oxford-London 1934; R.
H. Bloch, Etymologies and Genealogies. A Literary Anthropology of the French Middle Ages, Chicago 1983,
S. 9off. - Zu den französischen Jesse-Fenstern s. J. R. Johnson, The Tree of Jesse Window of Chartres, in:
Speculum XXXVI, 1961, S.iff.; M. L. Therel, Comment la patrologie peut eclairer l’archeologie. Apropos
de l’Arbre et Jesse et des statues-colonnes de Saint-Denis, in: Cahiers de civilisation medieval VI, 1963,
S. 145fr.; Abbot Suger and Saint-Denis, hrsg. v. P. Lieber Gerson, New York 1986, passim zu den Fenstern
in Saint-Denis and Chartres; V. Raguin, Stained Glass in Thirteenth Century Burgundy, Princeton 1982,
S. 146h W. Cothren, The Thirteenth and Fourteenth Century Glazing of the Choir of the Cathedral of
Beauvais, Diss. New York 1980, S. 53fr.; zu den deutschen Fenstern s. Becksmann [3], S. 8ff, wo auf S. 26
die französischen Beispiele der ersten Hälfte des 13 Jahrhunderts samt Lit. zusammengestellt sind.
5 A. Schmarsow, Kompositionsgesetze romanischer Glasgemälde im frühgotischen Kirchenfenster, in: Ab-
handlungen der phil.-hist. Masse der Königlich-Sächsischen Akademie der Wissenschaften 33, 1916, Nr. 2,
S. 38.
Parallelismus als Formprinzip
Phase der Glasmalerei abgelöst. In Deutschland hat die Gattungsgeschichte einen anderen
Weg genommen. Wir haben kein Beispiel dafür, daß man die Konzentrationsmotive der
Typologie weitergepflegt und zugunsten anderer Aufgaben umgerüstet hätte. Was in Frank-
reich die divisive Flächengeometrie ist, das ist in der deutschen Glasmalerei die vertikale
bzw. parallelgeschaltene Bilderfolge3 4. Einbahnige Fenster mit einem senkrechten Erzähl-
strang aus Medaillons oder Rechtecken sind in Anbetracht der Objektform die nahe-
liegendste Lösung. Wir finden sie ebenfalls ab 1150/60; sie erzählen in wenigen, ausge-
wählten Stationen vom Leben der Heiligen oder aus dem Alten und Neuen Testament.
Diese Lösung würde keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn man nicht auch im Ver-
tikalismus und Parallelismus der deutschen Fenster die gleichen Tendenzen und den glei-
chen Ehrgeiz am Werk sehen würde, der die französische Glasmalerei zu ebenso einsich-
tigen wie anspruchsvollen Kompositionen geführt hat. Auch in Deutschland geht es im
13. Jahrhundert um eine konsequente Abfolge und um eine systematische Anreicherung
des Erzählerischen. Beide Prinzipien finden sich in einer Bildidee vereint, die man zunächst
als ikonographische Spezialität betrachten würde, die aber in Wirklichkeit eine Art Matrix
für einen neuen Typus von Fensterdispositionen geworden ist, den man in Frankreich ver-
geblich suchen wird. Ich meine die aus der Wurzel Jesse abgeleiteten Bibelfenster.
Von dem erst im Hochmittelalter eingeführten Motiv des Jessebaums kann man
durchaus sagen, daß es eine Herausforderung an die Glasmalerei gewesen ist, als sie um
1150 begann, die dispositiven Möglichkeiten und Zwänge ihrer Kunst neu zu bestimmen1.
Die ersten monumentalen Verwirklichungen, die wir kennen, die Fenster in Saint Denis
und Chartres (Abb. 1) überwinden alle bis dahin bekannten Gliederungsweisen der Fen-
sterlichte gerade in Bezug auf die Nutzung der Senkrechten. Schon Schmarsow hat dar-
auf verwiesen, daß der Ausgleich zwischen »dem Abbild des organischen Gewächses« und
der hohen Fensteröffnung »nicht nur eine dekorative, sondern zugleich eine struktive
Notwendigkeit ergab«5: die Anerkennung der Vertikalen und ihrer »Ausdrucksbewegung«
Die Addition horizontal gelagerter Erzählzeilen, wie sie für die Glasmalerei um 1150 typisch
ist, wird in der Mittellinie der ersten Jessefenster in Saint Denis und Chartres durch einen
natürlich motivierten Aufstieg abgelöst. Es bleibt zwar grundsätzlich, bei der dreihebigen
3 Zu den Fensterstrukturen der deutschen Glasmalerei s. E. Frodl-Kraft, Das Margaretenfenster in Ardagger
- Studien zur österreichischen Malerei in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in: Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte 16,1954, S. lyfif; R. Becksmann, Das Jesse-Fenster aus dem spätromanischen Chor des Frei-
burger Münsters, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 23, 1969/70, S. 8ff.
4 Zur Wurzel Jesse allgemein A. Watson, The Early Iconography of the Tree of Jesse, Oxford-London 1934; R.
H. Bloch, Etymologies and Genealogies. A Literary Anthropology of the French Middle Ages, Chicago 1983,
S. 9off. - Zu den französischen Jesse-Fenstern s. J. R. Johnson, The Tree of Jesse Window of Chartres, in:
Speculum XXXVI, 1961, S.iff.; M. L. Therel, Comment la patrologie peut eclairer l’archeologie. Apropos
de l’Arbre et Jesse et des statues-colonnes de Saint-Denis, in: Cahiers de civilisation medieval VI, 1963,
S. 145fr.; Abbot Suger and Saint-Denis, hrsg. v. P. Lieber Gerson, New York 1986, passim zu den Fenstern
in Saint-Denis and Chartres; V. Raguin, Stained Glass in Thirteenth Century Burgundy, Princeton 1982,
S. 146h W. Cothren, The Thirteenth and Fourteenth Century Glazing of the Choir of the Cathedral of
Beauvais, Diss. New York 1980, S. 53fr.; zu den deutschen Fenstern s. Becksmann [3], S. 8ff, wo auf S. 26
die französischen Beispiele der ersten Hälfte des 13 Jahrhunderts samt Lit. zusammengestellt sind.
5 A. Schmarsow, Kompositionsgesetze romanischer Glasgemälde im frühgotischen Kirchenfenster, in: Ab-
handlungen der phil.-hist. Masse der Königlich-Sächsischen Akademie der Wissenschaften 33, 1916, Nr. 2,
S. 38.