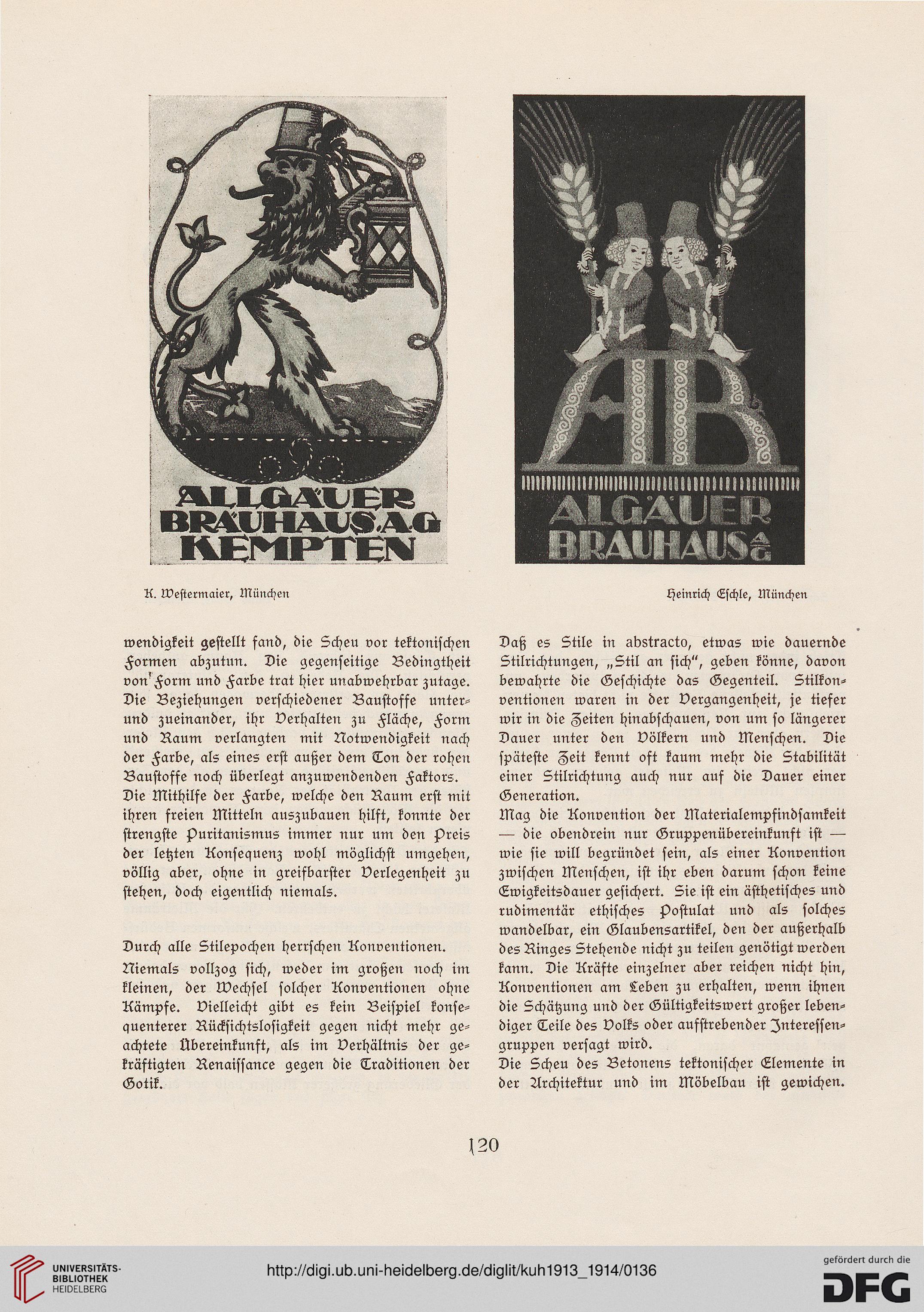K. Westermaier, München
Heinrich Lschle, München
wendigkeit gestellt fand, die Scheu vor tektonischen
formen abzutnn. Die gegenseitige Bedingtheit
von'Form und Farbe trat hier unabwehrbar zutage.
Die Beziehungen verschiedener Baustoffe unter-
und zueinander, ihr Verhalten zu Fläche, Form
und Raum verlangten mit Notwendigkeit nach
der Farbe, als eines erst außer dem Ton der rohen
Baustoffe noch überlegt anzuwendenden Faktors.
Die Mithilfe der Farbe, welche den Raum erst mit
ihren freien Mitteln auszubauen hilft, konnte der
strengste Puritanismus immer nur um den Preis
der letzten Konsequenz wohl möglichst umgehen,
völlig aber, ohne in greifbarster Verlegenheit zu
stehen, doch eigentlich niemals.
Durch alle Stilepochen herrschen Konventionen.
Niemals vollzog sich, weder im großen noch im
kleinen, der Wechsel solcher Konventionen ohne
Kämpfe, vielleicht gibt es kein Beispiel konse-
quenterer Rücksichtslosigkeit gegen nicht mehr ge-
achtete Übereinkunft, als im Verhältnis der ge-
kräftigten Renaissance gegen die Traditionen der
Gotik.
Daß es Stile in abstracto, etwas wie dauernde
Stilrichtungen, „Stil an sich", geben könne, davon
bewahrte die Geschichte das Gegenteil. Stilkon-
ventionen waren in der Vergangenheit, je tiefer
wir in die Zeiten hinabschauen, von um so längerer
Dauer unter den Völkern und Menschen. Die
späteste Zeit kennt oft kaum mehr die Stabilität
einer Stilrichtung auch nur auf die Dauer einer
Generation.
Mag die Konvention der Materialempfindsamkeit
— die obendrein nur Gruppenübereinkunft ist —
wie sie will begründet sein, als einer Konvention
zwischen Menschen, ist ihr eben darum schon keine
Lwigkeitsdauer gesichert. Sie ist ein ästhetisches und
rudimentär ethisches Postulat und als solches
wandelbar, ein Glaubensartikel, den der außerhalb
des Ringes Stehende nicht zu teilen genötigt werden
kann. Die Kräfte einzelner aber reichen nicht hin,
Konventionen am Leben zu erhalten, wenn ihnen
die Schätzung und der Gültigkeitswert großer leben-
diger Teile des Volks oder aufstrebender Interessen-
gruppen versagt wird.
Die Scheu des Betonens tektonischer Elemente in
der Architektur und im Möbelbau ist gewichen.
\20
Heinrich Lschle, München
wendigkeit gestellt fand, die Scheu vor tektonischen
formen abzutnn. Die gegenseitige Bedingtheit
von'Form und Farbe trat hier unabwehrbar zutage.
Die Beziehungen verschiedener Baustoffe unter-
und zueinander, ihr Verhalten zu Fläche, Form
und Raum verlangten mit Notwendigkeit nach
der Farbe, als eines erst außer dem Ton der rohen
Baustoffe noch überlegt anzuwendenden Faktors.
Die Mithilfe der Farbe, welche den Raum erst mit
ihren freien Mitteln auszubauen hilft, konnte der
strengste Puritanismus immer nur um den Preis
der letzten Konsequenz wohl möglichst umgehen,
völlig aber, ohne in greifbarster Verlegenheit zu
stehen, doch eigentlich niemals.
Durch alle Stilepochen herrschen Konventionen.
Niemals vollzog sich, weder im großen noch im
kleinen, der Wechsel solcher Konventionen ohne
Kämpfe, vielleicht gibt es kein Beispiel konse-
quenterer Rücksichtslosigkeit gegen nicht mehr ge-
achtete Übereinkunft, als im Verhältnis der ge-
kräftigten Renaissance gegen die Traditionen der
Gotik.
Daß es Stile in abstracto, etwas wie dauernde
Stilrichtungen, „Stil an sich", geben könne, davon
bewahrte die Geschichte das Gegenteil. Stilkon-
ventionen waren in der Vergangenheit, je tiefer
wir in die Zeiten hinabschauen, von um so längerer
Dauer unter den Völkern und Menschen. Die
späteste Zeit kennt oft kaum mehr die Stabilität
einer Stilrichtung auch nur auf die Dauer einer
Generation.
Mag die Konvention der Materialempfindsamkeit
— die obendrein nur Gruppenübereinkunft ist —
wie sie will begründet sein, als einer Konvention
zwischen Menschen, ist ihr eben darum schon keine
Lwigkeitsdauer gesichert. Sie ist ein ästhetisches und
rudimentär ethisches Postulat und als solches
wandelbar, ein Glaubensartikel, den der außerhalb
des Ringes Stehende nicht zu teilen genötigt werden
kann. Die Kräfte einzelner aber reichen nicht hin,
Konventionen am Leben zu erhalten, wenn ihnen
die Schätzung und der Gültigkeitswert großer leben-
diger Teile des Volks oder aufstrebender Interessen-
gruppen versagt wird.
Die Scheu des Betonens tektonischer Elemente in
der Architektur und im Möbelbau ist gewichen.
\20