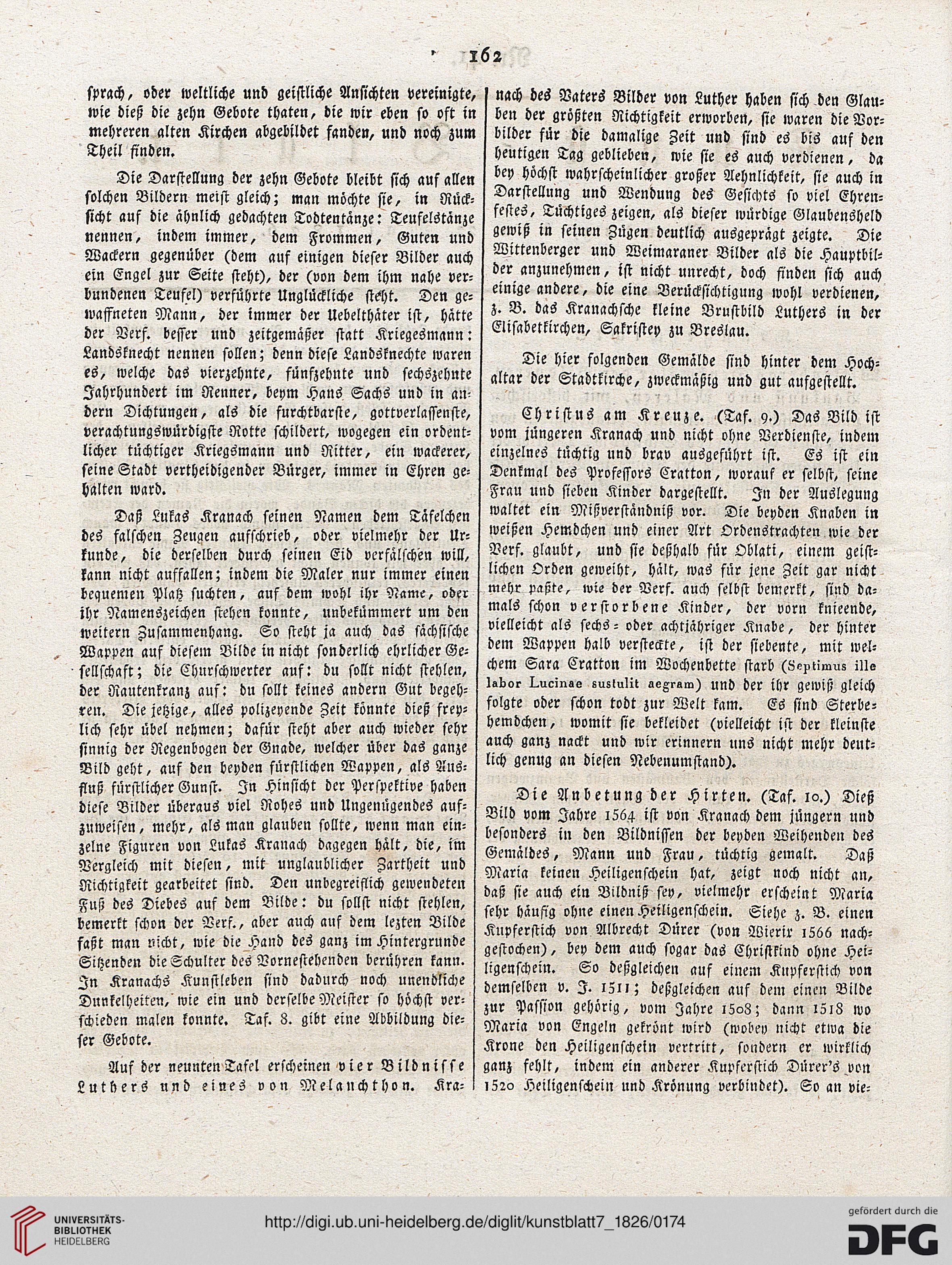sprach, oder weltliche und geistliche Ansichten vereinigte,
wie dieß die zehn Gebote thaten, die wir eben so oft in
mehreren alten Kirchen abgebildet fanden, und noch zum
Theil finden.
Die Darstellung der zehn Gebote bleibt sich auf allen
solchen Bildern meist gleich; man möchte sie, in Rück-
sicht auf die ähnlich gedachten Todtentänze: Teufelstanze
nennen, indem immer, dem Frommen, Guten und
Wackern gegenüber (dem auf einigen dieser Bilder auch
ein Engel zur Seite steht), der (von dem ihm nahe ver-
bundenen Teufel) verführte Unglückliche steht. Den ge-
waffneten Mann, der immer der Uebelthäter ist, hätte
der Verf. besser und zeitgemäßer statt Kriegesmann:
Landsknecht nennen sollen; denn diese Landsknechte waren
es, welche das vierzehnte, fünfzehnte und sechszchnte
Jahrhundert im Nenner, beym Hans Sachs und in an-
dern Dichtungen, als die furchtbarste, gottverlassenste,
verachtungswürdigste Rotte schildert, wogegen ein ordent-
licher tüchtiger Kriegsmann und Ritter, ein wackerer,
seine Stadt vertheidigender Bürger, immer in Ehren ge-
halten ward.
Daß Lukas Kranach seinen Namen dem Täfelchen
des falschen Zeugen aufschrieb, oder vielmehr der Ur-
kunde, die derselben durch seinen Eid verfälschen will,
kann nicht auffallen; indem die Maler nur immer einen
bequemen Platz suchten, auf dem wohl ihr Name, oder
Ihr Namenszeichen stehen konnte, unbekümmert um den
weitern Zusammenhang. So steht ja auch das sächsische
Wappen auf diesem Bilde in nicht sonderlich ehrlicher Ge-
sellschaft; die Churschwerter auf: du sollt nicht stehlen,
der Rautenkranz auf: du sollt keines andern Gut begeh-
ren. Die jetzige, alles polizeyende Zeit könnte dieß frep-
lich sehr übel nehmen; dafür steht aber auch wieder sehr
sinnig der Regenbogen der Gnade, welcher über das ganze
Bild geht, auf den bepden fürstlichen Wappen, als Aus-
fluß fürstlicher Gunst. In Hinsicht der Perspektive haben
diese Bilder überaus viel Rohes und Ungenügendes auf-
zuweifen, mehr, als man glauben sollte, wenn man ein-
zelne Figuren von Lukas Kranach dagegen hält, die, im
Vergleich mit diesen, mit unglaublicher Zartheit und
Nichtigkeit gearbeitet sind. Den unbegreiflich gewendeten
Fuß des Diebes auf dem Bilde: du sollst nicht stehlen,
bemerkt schon der Verf., aber auch auf dem lezten Bilde
faßt man nickt, wie die Hand des ganz im Hintergründe
Sitzenden die Schulter des Vornestehenden berühren kann.
Zn" Kranachö Kunstleben sind dadurch noch unendliche
Dunkelheiten, wie ein und derselbe Meister so höchst ver-
schieden malen konnte. Taf. 8. gibt eine Abbildung die-
ser Gebote.
Auf der neunten Tafel erscheinen vier Bildnisse
Luthers und eines von Melanchthon. Kra-
nach des Vaters Bilder von Luther haben sich den Glau-
ben der größten Nichtigkeit erworben, sie waren die Vor-
bilder für die damalige Zeit und sind es bis auf den
heutigen Tag geblieben, wie sie es auch verdienen, da
bey höchst wahrscheinlicher großer Aehnlichkeit, sie auch in
Darstellung und Wendung des Gesichts so viel Ehren-
festes, Tüchtiges zeigen, als dieser würdige Glaubensheld
gewiß in seinen Zügen deutlich ausgeprägt zeigte. Die
Wittenberger und Weimaraner Bilder als die Hauptbil-
der anzunehmen, ist nicht unrecht, doch finden sich auch
einige andere, die eine Berücksichtigung wohl verdienen,
z. V. das Kranachsche kleine Brustbild Luthers in der
Elisabetkirchen, Sakristep zu Breslau.
Die hier folgenden Gemälde sind hinter dem Hoch-
altar der Stadtkirche, zweckmäßig und gut ausgestellt.
Christus am Kreuze. (Taf. y.) Das Bild ist
vom jüngeren Kranach und nicht ohne Verdienste, indem
einzelnes tüchtig und brav ausgeführt ist. Es ist ein
Denkmal des Professors Cratton, worauf er selbst, seine
Frau und sieben Kinder dargestellt. 2» der Auslegung
waltet ein Mißverständniß vor. Die bepden Knaben in
weißen Hemdchen und einer Art Ordenstrachten wie der
Vers, glaubt, und sie deßhalb für Oblati, einem geist-
lichen Orden geweiht, hält, was für jene Zeit gar nicht
mehr paßte, wie der Vers, auch selbst bemerkt, sind da-
mals schon verstorbene Kinder, der vorn knieende,
vielleicht als sechs - oder achtjähriger Knabe, der hinter
dem Wappen halb versteckte, ist der siebente, mit wel-
chem Sara Cratton im Wochenbette starb (Septimus ille
labor Lucinae suslulit acgram) und der ihr gewiß gleich
folgte oder schon todt zur Welt kam. Es sind Sterbe-
hemdchen, womit sie bekleidet (vielleicht ist der kleinste
auch ganz nackt und wir erinnern uns nicht mehr deut-
lich genug an diesen Nebenumstand).
Die Anbetung der Hirten. (Taf. io.) Dieß
Bild vom Jahre 1564 ist von Kranach dem jüngern und
besonders in den Bildnissen der bepden Weihenden des
Gemäldes, Mann und Frau, tüchtig gemalt. Daß
Maria keinen Heiligenschein hat, zeigt noch nicht an,
daß sie auch ein Bildniß sey, vielmehr erscheint Maria
sehr häufig ohne einen Heiligenschein. Siehe z. B. einen
Kupferstich von Albrecht Dürer (von Wierir 1566 nach-
gestochen) , bey dem auch sogar das Christkind ohne Hei-
ligenschein. So deßgleichen auf einem Kupferstich von
demselben v. 2- lßii; deßgleichen auf dem einen Bilde
zur Passion gehörig, vom Jahre i5o8; dann 1Z18 wo
Maria von Engeln gekrönt wird (wobep nicht ctlva die
Krone den Heiligenschein vertritt, sondern er wirklich
ganz fehlt, indem ein anderer Kupferstich Dürer's von
1520 Heiligenschein und Krönung verbindet). So an vie-
wie dieß die zehn Gebote thaten, die wir eben so oft in
mehreren alten Kirchen abgebildet fanden, und noch zum
Theil finden.
Die Darstellung der zehn Gebote bleibt sich auf allen
solchen Bildern meist gleich; man möchte sie, in Rück-
sicht auf die ähnlich gedachten Todtentänze: Teufelstanze
nennen, indem immer, dem Frommen, Guten und
Wackern gegenüber (dem auf einigen dieser Bilder auch
ein Engel zur Seite steht), der (von dem ihm nahe ver-
bundenen Teufel) verführte Unglückliche steht. Den ge-
waffneten Mann, der immer der Uebelthäter ist, hätte
der Verf. besser und zeitgemäßer statt Kriegesmann:
Landsknecht nennen sollen; denn diese Landsknechte waren
es, welche das vierzehnte, fünfzehnte und sechszchnte
Jahrhundert im Nenner, beym Hans Sachs und in an-
dern Dichtungen, als die furchtbarste, gottverlassenste,
verachtungswürdigste Rotte schildert, wogegen ein ordent-
licher tüchtiger Kriegsmann und Ritter, ein wackerer,
seine Stadt vertheidigender Bürger, immer in Ehren ge-
halten ward.
Daß Lukas Kranach seinen Namen dem Täfelchen
des falschen Zeugen aufschrieb, oder vielmehr der Ur-
kunde, die derselben durch seinen Eid verfälschen will,
kann nicht auffallen; indem die Maler nur immer einen
bequemen Platz suchten, auf dem wohl ihr Name, oder
Ihr Namenszeichen stehen konnte, unbekümmert um den
weitern Zusammenhang. So steht ja auch das sächsische
Wappen auf diesem Bilde in nicht sonderlich ehrlicher Ge-
sellschaft; die Churschwerter auf: du sollt nicht stehlen,
der Rautenkranz auf: du sollt keines andern Gut begeh-
ren. Die jetzige, alles polizeyende Zeit könnte dieß frep-
lich sehr übel nehmen; dafür steht aber auch wieder sehr
sinnig der Regenbogen der Gnade, welcher über das ganze
Bild geht, auf den bepden fürstlichen Wappen, als Aus-
fluß fürstlicher Gunst. In Hinsicht der Perspektive haben
diese Bilder überaus viel Rohes und Ungenügendes auf-
zuweifen, mehr, als man glauben sollte, wenn man ein-
zelne Figuren von Lukas Kranach dagegen hält, die, im
Vergleich mit diesen, mit unglaublicher Zartheit und
Nichtigkeit gearbeitet sind. Den unbegreiflich gewendeten
Fuß des Diebes auf dem Bilde: du sollst nicht stehlen,
bemerkt schon der Verf., aber auch auf dem lezten Bilde
faßt man nickt, wie die Hand des ganz im Hintergründe
Sitzenden die Schulter des Vornestehenden berühren kann.
Zn" Kranachö Kunstleben sind dadurch noch unendliche
Dunkelheiten, wie ein und derselbe Meister so höchst ver-
schieden malen konnte. Taf. 8. gibt eine Abbildung die-
ser Gebote.
Auf der neunten Tafel erscheinen vier Bildnisse
Luthers und eines von Melanchthon. Kra-
nach des Vaters Bilder von Luther haben sich den Glau-
ben der größten Nichtigkeit erworben, sie waren die Vor-
bilder für die damalige Zeit und sind es bis auf den
heutigen Tag geblieben, wie sie es auch verdienen, da
bey höchst wahrscheinlicher großer Aehnlichkeit, sie auch in
Darstellung und Wendung des Gesichts so viel Ehren-
festes, Tüchtiges zeigen, als dieser würdige Glaubensheld
gewiß in seinen Zügen deutlich ausgeprägt zeigte. Die
Wittenberger und Weimaraner Bilder als die Hauptbil-
der anzunehmen, ist nicht unrecht, doch finden sich auch
einige andere, die eine Berücksichtigung wohl verdienen,
z. V. das Kranachsche kleine Brustbild Luthers in der
Elisabetkirchen, Sakristep zu Breslau.
Die hier folgenden Gemälde sind hinter dem Hoch-
altar der Stadtkirche, zweckmäßig und gut ausgestellt.
Christus am Kreuze. (Taf. y.) Das Bild ist
vom jüngeren Kranach und nicht ohne Verdienste, indem
einzelnes tüchtig und brav ausgeführt ist. Es ist ein
Denkmal des Professors Cratton, worauf er selbst, seine
Frau und sieben Kinder dargestellt. 2» der Auslegung
waltet ein Mißverständniß vor. Die bepden Knaben in
weißen Hemdchen und einer Art Ordenstrachten wie der
Vers, glaubt, und sie deßhalb für Oblati, einem geist-
lichen Orden geweiht, hält, was für jene Zeit gar nicht
mehr paßte, wie der Vers, auch selbst bemerkt, sind da-
mals schon verstorbene Kinder, der vorn knieende,
vielleicht als sechs - oder achtjähriger Knabe, der hinter
dem Wappen halb versteckte, ist der siebente, mit wel-
chem Sara Cratton im Wochenbette starb (Septimus ille
labor Lucinae suslulit acgram) und der ihr gewiß gleich
folgte oder schon todt zur Welt kam. Es sind Sterbe-
hemdchen, womit sie bekleidet (vielleicht ist der kleinste
auch ganz nackt und wir erinnern uns nicht mehr deut-
lich genug an diesen Nebenumstand).
Die Anbetung der Hirten. (Taf. io.) Dieß
Bild vom Jahre 1564 ist von Kranach dem jüngern und
besonders in den Bildnissen der bepden Weihenden des
Gemäldes, Mann und Frau, tüchtig gemalt. Daß
Maria keinen Heiligenschein hat, zeigt noch nicht an,
daß sie auch ein Bildniß sey, vielmehr erscheint Maria
sehr häufig ohne einen Heiligenschein. Siehe z. B. einen
Kupferstich von Albrecht Dürer (von Wierir 1566 nach-
gestochen) , bey dem auch sogar das Christkind ohne Hei-
ligenschein. So deßgleichen auf einem Kupferstich von
demselben v. 2- lßii; deßgleichen auf dem einen Bilde
zur Passion gehörig, vom Jahre i5o8; dann 1Z18 wo
Maria von Engeln gekrönt wird (wobep nicht ctlva die
Krone den Heiligenschein vertritt, sondern er wirklich
ganz fehlt, indem ein anderer Kupferstich Dürer's von
1520 Heiligenschein und Krönung verbindet). So an vie-