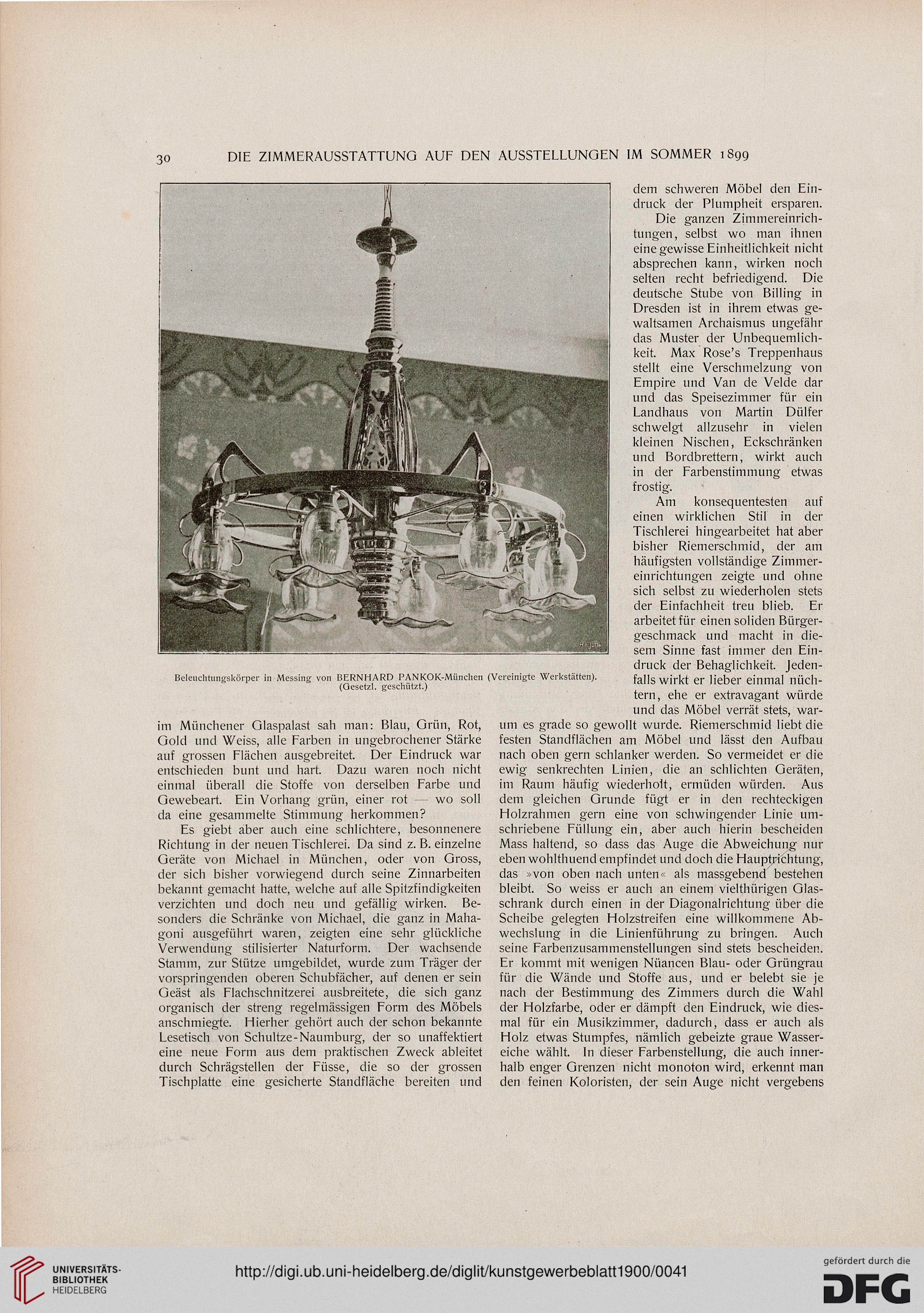30
DIE ZIMMERAUSSTATTUNG AUF DEN AUSSTELLUNGEN IM SOMMER 1899
Beleuchtungskörper in Messing von BERNHARD PANKOK-München (Vereinigte Werkstätten),
(Oesetzl. geschützt.)
im Münchener Glaspalast sah man: Blau, Grün, Rot,
Gold und Weiss, alle Farben in ungebrochener Stärke
auf grossen Flächen ausgebreitet. Der Eindruck war
entschieden bunt und hart. Dazu waren noch nicht
einmal überall die Stoffe von derselben Farbe und
Gewebeart. Ein Vorhang grün, einer rot wo soll
da eine gesammelte Stimmung herkommen?
Es giebt aber auch eine schlichtere, besonnenere
Richtung in der neuen Tischlerei. Da sind z. B. einzelne
Geräte von Michael in München, oder von Gross,
der sich bisher vorwiegend durch seine Zinnarbeiten
bekannt gemacht hatte, welche auf alle Spitzfindigkeiten
verzichten und doch neu und gefällig wirken. Be-
sonders die Schränke von Michael, die ganz in Maha-
goni ausgeführt waren, zeigten eine sehr glückliche
Verwendung stilisierter Naturform. Der wachsende
Stamm, zur Stütze umgebildet, wurde zum Träger der
vorspringenden oberen Schubfächer, auf denen er sein
Geäst als Flachschnitzerei ausbreitete, die sich ganz
organisch der streng regelmässigen Form des Möbels
anschmiegte. Hierher gehört auch der schon bekannte
Lesetisch von Schultze-Naumburg, der so unaffektiert
eine neue Form aus dem praktischen Zweck ableitet
durch Schrägstellen der Füsse, die so der grossen
Tischplatte eine gesicherte Standfläche bereiten und
dem schweren Möbel den Ein-
druck der Plumpheit ersparen.
Die ganzen Zimmereinrich-
tungen, selbst wo man ihnen
eine gewisse Einheitlichkeit nicht
absprechen kann, wirken noch
selten recht befriedigend. Die
deutsche Stube von Billing in
Dresden ist in ihrem etwas ge-
waltsamen Archaismus ungefähr
das Muster der Unbequemlich-
keit. Max Rose's Treppenhaus
stellt eine Verschmelzung von
Empire und Van de Velde dar
und das Speisezimmer für ein
Landhaus von Martin Dülfer
schwelgt allzusehr in vielen
kleinen Nischen, Eckschränken
und Bordbrettern, wirkt auch
in der Farbenstimmung etwas
frostig.
Am konsequentesten auf
einen wirklichen Stil in der
Tischlerei hingearbeitet hat aber
bisher Riemerschmid, der am
häufigsten vollständige Zimmer-
einrichtungen zeigte und ohne
sich selbst zu wiederholen stets
der Einfachheit treu blieb. Er
arbeitet für einen soliden Bürger-
geschmack und macht in die-
sem Sinne fast immer den Ein-
druck der Behaglichkeit. Jeden-
falls wirkt er lieber einmal nüch-
tern, ehe er extravagant würde
und das Möbel verrät stets, war-
um es grade so gewollt wurde. Riemerschmid liebt die
festen Standflächen am Möbel und lässt den Aufbau
nach oben gern schlanker werden. So vermeidet er die
ewig senkrechten Linien, die an schlichten Geräten,
im Raum häufig wiederholt, ermüden würden. Aus
dem gleichen Grunde fügt er in den rechteckigen
Holzrahmen gern eine von schwingender Linie um-
schriebene Füllung ein, aber auch hierin bescheiden
Mass haltend, so dass das Auge die Abweichung nur
eben wohlthuend empfindet und doch die Hauptrichtung,
das »von oben nach unten« als massgebend bestehen
bleibt. So weiss er auch an einem vielthürigen Glas-
schrank durch einen in der Diagonalrichtung über die
Scheibe gelegten Holzstreifen eine willkommene Ab-
wechslung in die Linienführung zu bringen. Auch
seine Farbenzusammenstellungen sind stets bescheiden.
Er kommt mit wenigen Nuancen Blau- oder Grüngrau
für die Wände und Stoffe aus, und er belebt sie je
nach der Bestimmung des Zimmers durch die Wahl
der Holzfarbe, oder er dämpft den Eindruck, wie dies-
mal für ein Musikzimmer, dadurch, dass er auch als
Holz etwas Stumpfes, nämlich gebeizte graue Wasser-
eiche wählt. In dieser Farbenstellung, die auch inner-
halb enger Grenzen nicht monoton wird, erkennt man
den feinen Koloristen, der sein Auge nicht vergebens
DIE ZIMMERAUSSTATTUNG AUF DEN AUSSTELLUNGEN IM SOMMER 1899
Beleuchtungskörper in Messing von BERNHARD PANKOK-München (Vereinigte Werkstätten),
(Oesetzl. geschützt.)
im Münchener Glaspalast sah man: Blau, Grün, Rot,
Gold und Weiss, alle Farben in ungebrochener Stärke
auf grossen Flächen ausgebreitet. Der Eindruck war
entschieden bunt und hart. Dazu waren noch nicht
einmal überall die Stoffe von derselben Farbe und
Gewebeart. Ein Vorhang grün, einer rot wo soll
da eine gesammelte Stimmung herkommen?
Es giebt aber auch eine schlichtere, besonnenere
Richtung in der neuen Tischlerei. Da sind z. B. einzelne
Geräte von Michael in München, oder von Gross,
der sich bisher vorwiegend durch seine Zinnarbeiten
bekannt gemacht hatte, welche auf alle Spitzfindigkeiten
verzichten und doch neu und gefällig wirken. Be-
sonders die Schränke von Michael, die ganz in Maha-
goni ausgeführt waren, zeigten eine sehr glückliche
Verwendung stilisierter Naturform. Der wachsende
Stamm, zur Stütze umgebildet, wurde zum Träger der
vorspringenden oberen Schubfächer, auf denen er sein
Geäst als Flachschnitzerei ausbreitete, die sich ganz
organisch der streng regelmässigen Form des Möbels
anschmiegte. Hierher gehört auch der schon bekannte
Lesetisch von Schultze-Naumburg, der so unaffektiert
eine neue Form aus dem praktischen Zweck ableitet
durch Schrägstellen der Füsse, die so der grossen
Tischplatte eine gesicherte Standfläche bereiten und
dem schweren Möbel den Ein-
druck der Plumpheit ersparen.
Die ganzen Zimmereinrich-
tungen, selbst wo man ihnen
eine gewisse Einheitlichkeit nicht
absprechen kann, wirken noch
selten recht befriedigend. Die
deutsche Stube von Billing in
Dresden ist in ihrem etwas ge-
waltsamen Archaismus ungefähr
das Muster der Unbequemlich-
keit. Max Rose's Treppenhaus
stellt eine Verschmelzung von
Empire und Van de Velde dar
und das Speisezimmer für ein
Landhaus von Martin Dülfer
schwelgt allzusehr in vielen
kleinen Nischen, Eckschränken
und Bordbrettern, wirkt auch
in der Farbenstimmung etwas
frostig.
Am konsequentesten auf
einen wirklichen Stil in der
Tischlerei hingearbeitet hat aber
bisher Riemerschmid, der am
häufigsten vollständige Zimmer-
einrichtungen zeigte und ohne
sich selbst zu wiederholen stets
der Einfachheit treu blieb. Er
arbeitet für einen soliden Bürger-
geschmack und macht in die-
sem Sinne fast immer den Ein-
druck der Behaglichkeit. Jeden-
falls wirkt er lieber einmal nüch-
tern, ehe er extravagant würde
und das Möbel verrät stets, war-
um es grade so gewollt wurde. Riemerschmid liebt die
festen Standflächen am Möbel und lässt den Aufbau
nach oben gern schlanker werden. So vermeidet er die
ewig senkrechten Linien, die an schlichten Geräten,
im Raum häufig wiederholt, ermüden würden. Aus
dem gleichen Grunde fügt er in den rechteckigen
Holzrahmen gern eine von schwingender Linie um-
schriebene Füllung ein, aber auch hierin bescheiden
Mass haltend, so dass das Auge die Abweichung nur
eben wohlthuend empfindet und doch die Hauptrichtung,
das »von oben nach unten« als massgebend bestehen
bleibt. So weiss er auch an einem vielthürigen Glas-
schrank durch einen in der Diagonalrichtung über die
Scheibe gelegten Holzstreifen eine willkommene Ab-
wechslung in die Linienführung zu bringen. Auch
seine Farbenzusammenstellungen sind stets bescheiden.
Er kommt mit wenigen Nuancen Blau- oder Grüngrau
für die Wände und Stoffe aus, und er belebt sie je
nach der Bestimmung des Zimmers durch die Wahl
der Holzfarbe, oder er dämpft den Eindruck, wie dies-
mal für ein Musikzimmer, dadurch, dass er auch als
Holz etwas Stumpfes, nämlich gebeizte graue Wasser-
eiche wählt. In dieser Farbenstellung, die auch inner-
halb enger Grenzen nicht monoton wird, erkennt man
den feinen Koloristen, der sein Auge nicht vergebens