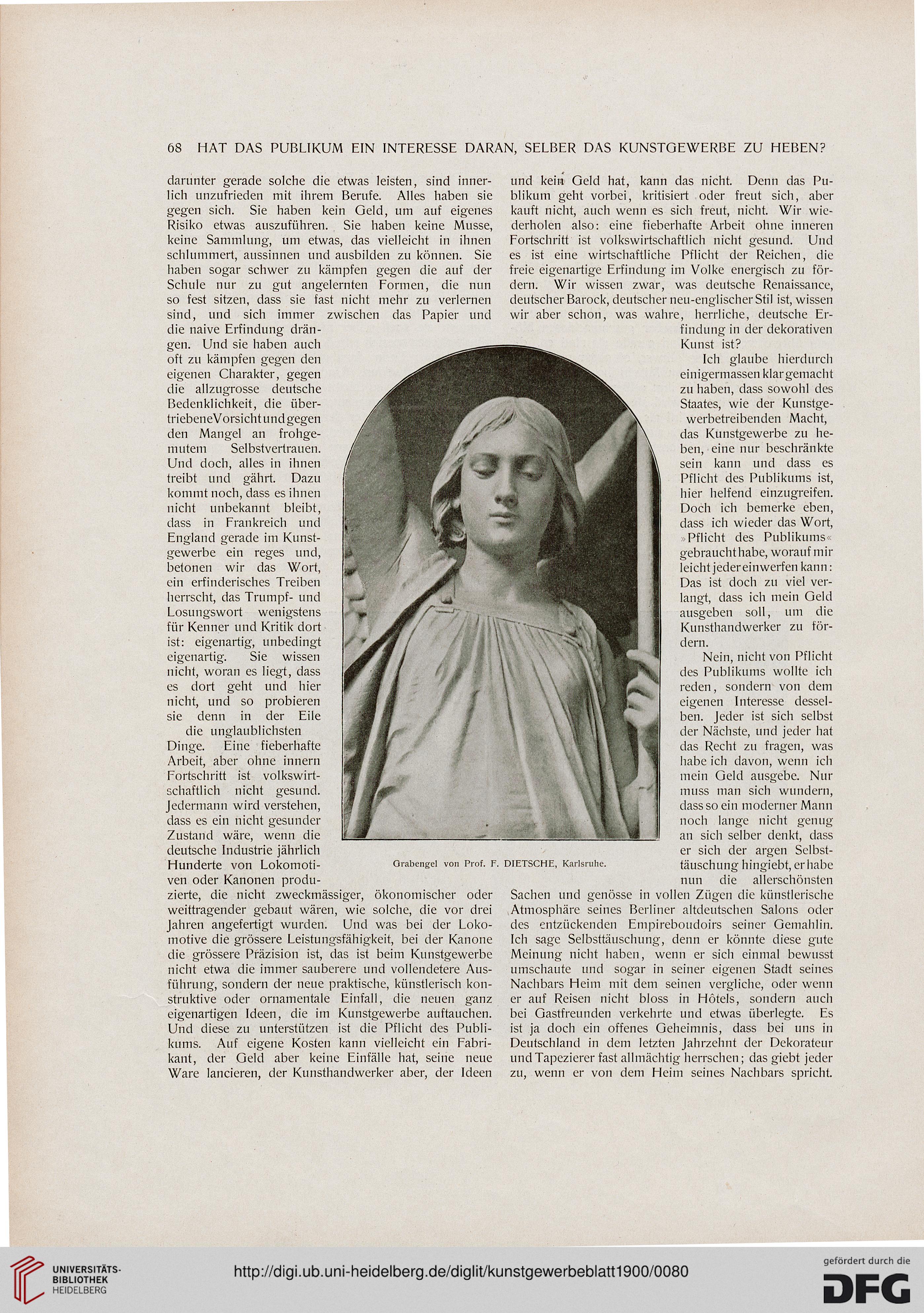68 HAT DAS PUBLIKUM EIN INTERESSE DARAN, SELBER DAS KUNSTGEWERBE ZU HEBEN?
darunter gerade solche die etwas leisten, sind inner-
lich unzufrieden mit ihrem Berufe. Alles haben sie
gegen sich. Sie haben kein Geld, um auf eigenes
Risiko etwas auszuführen. Sie haben keine Müsse,
keine Sammlung, um etwas, das vielleicht in ihnen
schlummert, aussinnen und ausbilden zu können. Sie
haben sogar schwer zu kämpfen gegen die auf der
Schule nur zu gut angelernten Formen, die nun
so fest sitzen, dass sie fast nicht mehr zu verlernen
sind, und sich immer zwischen das Papier und
die naive Erfindung drän-
gen. Und sie haben auch
oft zu kämpfen gegen den
eigenen Charakter, gegen
die allzugrosse deutsche
Bedenklichkeit, die über-
triebeneVorsicht und gegen
den Mangel an frohge-
mutem Selbstvertrauen.
Und doch, alles in ihnen
treibt und gährt. Dazu
kommt noch, dass es ihnen
nicht unbekannt bleibt,
dass in Frankreich und
England gerade im Kunst-
gewerbe ein reges und,
betonen wir das Wort,
ein erfinderisches Treiben
herrscht, das Trumpf- und
Losungswort wenigstens
für Kenner und Kritik dort
ist: eigenartig, unbedingt
eigenartig. Sie wissen
nicht, woran es liegt, dass
es dort geht und hier
nicht, und so probieren
sie denn in der Eile
die unglaublichsten
Dinge. Eine fieberhafte
Arbeit, aber ohne innern
Fortschritt ist volkswirt-
schaftlich nicht gesund.
Jedermann wird verstehen,
dass es ein nicht gesunder
Zustand wäre, wenn die
deutsche Industrie jährlich
Hunderte von Lokomoti-
ven oder Kanonen produ-
zierte, die nicht zweckmässiger, ökonomischer oder
weittragender gebaut wären, wie solche, die vor drei
Jahren angefertigt wurden. Und was bei der Loko-
motive die grössere Leistungsfähigkeit, bei der Kanone
die grössere Präzision ist, das ist beim Kunstgewerbe
nicht etwa die immer sauberere und vollendetere Aus-
führung, sondern der neue praktische, künstlerisch kon-
struktive oder ornamentale Einfall, die neuen ganz
eigenartigen Ideen, die im Kunstgewerbe auftauchen.
Und diese zu unterstützen ist die Pflicht des Publi-
kums. Auf eigene Kosten kann vielleicht ein Fabri-
kant, der Geld aber keine Einfälle hat, seine neue
Ware lancieren, der Kunsthandwerker aber, der Ideen
Grabcngel von Prof. F. DIETSCHE, Karlsruhe.
und kein Geld hat, kann das nicht. Denn das Pu-
blikum geht vorbei, kritisiert oder freut sich, aber
kauft nicht, auch wenn es sich freut, nicht. Wir wie-
derholen also: eine fieberhafte Arbeit ohne inneren
Fortschritt ist volkswirtschaftlich nicht gesund. Und
es ist eine wirtschaftliche Pflicht der Reichen, die
freie eigenartige Erfindung im Volke energisch zu för-
dern. Wir wissen zwar, was deutsche Renaissance,
deutscher Barock, deutscher neu-englischer Stil ist, wissen
wir aber schon, was wahre, herrliche, deutsche Er-
findung in der dekorativen
Kunst ist?
Ich glaube hierdurch
einigermassen klargemacht
zu haben, dass sowohl des
Staates, wie der Kunstge-
werbetreibenden Macht,
das Kunstgewerbe zu he-
ben, eine nur beschränkte
sein kann und dass es
Pflicht des Publikums ist,
hier helfend einzugreifen.
Doch ich bemerke eben,
dass ich wieder das Wort,
»Pflicht des Publikums«
gebraucht habe, worauf mir
leicht jedereinwerfen kann:
Das ist doch zu viel ver-
langt, dass ich mein Geld
ausgeben soll, um die
Kunsthandwerker zu för-
dern.
Nein, nicht von Pflicht
des Publikums wollte ich
reden, sondern von dem
eigenen Interesse dessel-
ben. Jeder ist sich selbst
der Nächste, und jeder hat
das Recht zu fragen, was
habe ich davon, wenn ich
mein Geld ausgebe. Nur
muss man sich wundern,
dass so ein moderner Mann
noch lange nicht genug
an sich selber denkt, dass
er sich der argen Selbst-
täuschung hingiebt, er habe
nun die allerschönsten
Sachen und genösse in vollen Zügen die künstlerische
Atmosphäre seines Berliner altdeutschen Salons oder
des entzückenden Empireboudoirs seiner Gemahlin.
Ich sage Selbsttäuschung, denn er könnte diese gute
Meinung nicht haben, wenn er sich einmal bewusst
umschaute und sogar in seiner eigenen Stadt seines
Nachbars Heim mit dem seinen vergliche, oder wenn
er auf Reisen nicht bloss in Hotels, sondern auch
bei Gastfreunden verkehrte und etwas überlegte. Es
ist ja doch ein offenes Geheimnis, dass bei uns in
Deutschland in dem letzten Jahrzehnt der Dekorateur
und Tapezierer fast allmächtig herrschen; das giebt jeder
zu, wenn er von dem Heim seines Nachbars spricht.
darunter gerade solche die etwas leisten, sind inner-
lich unzufrieden mit ihrem Berufe. Alles haben sie
gegen sich. Sie haben kein Geld, um auf eigenes
Risiko etwas auszuführen. Sie haben keine Müsse,
keine Sammlung, um etwas, das vielleicht in ihnen
schlummert, aussinnen und ausbilden zu können. Sie
haben sogar schwer zu kämpfen gegen die auf der
Schule nur zu gut angelernten Formen, die nun
so fest sitzen, dass sie fast nicht mehr zu verlernen
sind, und sich immer zwischen das Papier und
die naive Erfindung drän-
gen. Und sie haben auch
oft zu kämpfen gegen den
eigenen Charakter, gegen
die allzugrosse deutsche
Bedenklichkeit, die über-
triebeneVorsicht und gegen
den Mangel an frohge-
mutem Selbstvertrauen.
Und doch, alles in ihnen
treibt und gährt. Dazu
kommt noch, dass es ihnen
nicht unbekannt bleibt,
dass in Frankreich und
England gerade im Kunst-
gewerbe ein reges und,
betonen wir das Wort,
ein erfinderisches Treiben
herrscht, das Trumpf- und
Losungswort wenigstens
für Kenner und Kritik dort
ist: eigenartig, unbedingt
eigenartig. Sie wissen
nicht, woran es liegt, dass
es dort geht und hier
nicht, und so probieren
sie denn in der Eile
die unglaublichsten
Dinge. Eine fieberhafte
Arbeit, aber ohne innern
Fortschritt ist volkswirt-
schaftlich nicht gesund.
Jedermann wird verstehen,
dass es ein nicht gesunder
Zustand wäre, wenn die
deutsche Industrie jährlich
Hunderte von Lokomoti-
ven oder Kanonen produ-
zierte, die nicht zweckmässiger, ökonomischer oder
weittragender gebaut wären, wie solche, die vor drei
Jahren angefertigt wurden. Und was bei der Loko-
motive die grössere Leistungsfähigkeit, bei der Kanone
die grössere Präzision ist, das ist beim Kunstgewerbe
nicht etwa die immer sauberere und vollendetere Aus-
führung, sondern der neue praktische, künstlerisch kon-
struktive oder ornamentale Einfall, die neuen ganz
eigenartigen Ideen, die im Kunstgewerbe auftauchen.
Und diese zu unterstützen ist die Pflicht des Publi-
kums. Auf eigene Kosten kann vielleicht ein Fabri-
kant, der Geld aber keine Einfälle hat, seine neue
Ware lancieren, der Kunsthandwerker aber, der Ideen
Grabcngel von Prof. F. DIETSCHE, Karlsruhe.
und kein Geld hat, kann das nicht. Denn das Pu-
blikum geht vorbei, kritisiert oder freut sich, aber
kauft nicht, auch wenn es sich freut, nicht. Wir wie-
derholen also: eine fieberhafte Arbeit ohne inneren
Fortschritt ist volkswirtschaftlich nicht gesund. Und
es ist eine wirtschaftliche Pflicht der Reichen, die
freie eigenartige Erfindung im Volke energisch zu för-
dern. Wir wissen zwar, was deutsche Renaissance,
deutscher Barock, deutscher neu-englischer Stil ist, wissen
wir aber schon, was wahre, herrliche, deutsche Er-
findung in der dekorativen
Kunst ist?
Ich glaube hierdurch
einigermassen klargemacht
zu haben, dass sowohl des
Staates, wie der Kunstge-
werbetreibenden Macht,
das Kunstgewerbe zu he-
ben, eine nur beschränkte
sein kann und dass es
Pflicht des Publikums ist,
hier helfend einzugreifen.
Doch ich bemerke eben,
dass ich wieder das Wort,
»Pflicht des Publikums«
gebraucht habe, worauf mir
leicht jedereinwerfen kann:
Das ist doch zu viel ver-
langt, dass ich mein Geld
ausgeben soll, um die
Kunsthandwerker zu för-
dern.
Nein, nicht von Pflicht
des Publikums wollte ich
reden, sondern von dem
eigenen Interesse dessel-
ben. Jeder ist sich selbst
der Nächste, und jeder hat
das Recht zu fragen, was
habe ich davon, wenn ich
mein Geld ausgebe. Nur
muss man sich wundern,
dass so ein moderner Mann
noch lange nicht genug
an sich selber denkt, dass
er sich der argen Selbst-
täuschung hingiebt, er habe
nun die allerschönsten
Sachen und genösse in vollen Zügen die künstlerische
Atmosphäre seines Berliner altdeutschen Salons oder
des entzückenden Empireboudoirs seiner Gemahlin.
Ich sage Selbsttäuschung, denn er könnte diese gute
Meinung nicht haben, wenn er sich einmal bewusst
umschaute und sogar in seiner eigenen Stadt seines
Nachbars Heim mit dem seinen vergliche, oder wenn
er auf Reisen nicht bloss in Hotels, sondern auch
bei Gastfreunden verkehrte und etwas überlegte. Es
ist ja doch ein offenes Geheimnis, dass bei uns in
Deutschland in dem letzten Jahrzehnt der Dekorateur
und Tapezierer fast allmächtig herrschen; das giebt jeder
zu, wenn er von dem Heim seines Nachbars spricht.