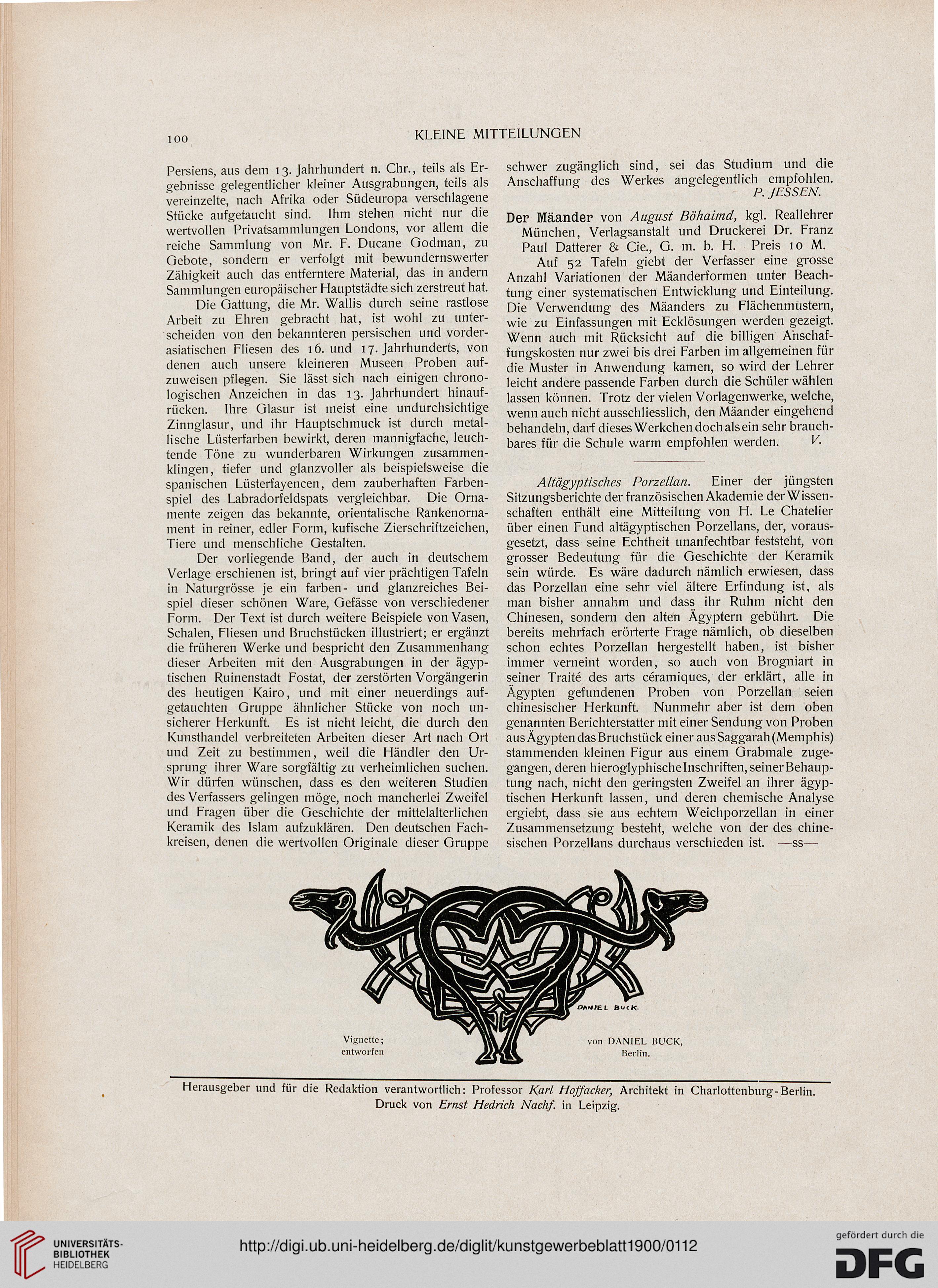100
KLEINE MITTEILUNGEN
Persiens, aus dem 13. Jahrhundert n. Chr., teils als Er-
gebnisse gelegentlicher kleiner Ausgrabungen, teils als
vereinzelte, nach Afrika oder Südeuropa verschlagene
Stücke aufgetaucht sind. Ihm stehen nicht nur die
wertvollen Privatsammlungen Londons, vor allem die
reiche Sammlung von Mr. F. Ducane Godman, zu
Gebote, sondern er verfolgt mit bewundernswerter
Zähigkeit auch das entferntere Material, das in andern
Sammlungen europäischer Hauptstädte sich zerstreut hat.
Die Gattung, die Mr. Wallis durch seine rastlose
Arbeit zu Ehren gebracht hat, ist wohl zu unter-
scheiden von den bekannteren persischen und vorder-
asiatischen Fliesen des 16. und 17. Jahrhunderts, von
denen auch unsere kleineren Museen Proben auf-
zuweisen pflegen. Sie lässt sich nach einigen chrono-
logischen Anzeichen in das 13. Jahrhundert hinauf-
rücken. Ihre Glasur ist meist eine undurchsichtige
Zinnglasur, und ihr Hauptschmuck ist durch metal-
lische Lüsterfarben bewirkt, deren mannigfache, leuch-
tende Töne zu wunderbaren Wirkungen zusammen-
klingen, tiefer und glanzvoller als beispielsweise die
spanischen Lüsterfayencen, dem zauberhaften Farben-
spiel des Labradorfeldspats vergleichbar. Die Orna-
mente zeigen das bekannte, orientalische Rankenorna-
ment in reiner, edler Form, kufische Zierschriftzeichen,
Tiere und menschliche Gestalten.
Der vorliegende Band, der auch in deutschem
Verlage erschienen ist, bringt auf vier prächtigen Tafeln
in Naturgrösse je ein färben- und glanzreiches Bei-
spiel dieser schönen Ware, Gefässe von verschiedener
Form. Der Text ist durch weitere Beispiele von Vasen,
Schalen, Fliesen und Bruchstücken illustriert; er ergänzt
die früheren Werke und bespricht den Zusammenhang
dieser Arbeiten mit den Ausgrabungen in der ägyp-
tischen Ruinenstadt Fostat, der zerstörten Vorgängerin
des heutigen Kairo, und mit einer neuerdings auf-
getauchten Gruppe ähnlicher Stücke von noch un-
sicherer Herkunft. Es ist nicht leicht, die durch den
Kunsthandel verbreiteten Arbeiten dieser Art nach Ort
und Zeit zu bestimmen, weil die Händler den Ur-
sprung ihrer Ware sorgfältig zu verheimlichen suchen.
Wir dürfen wünschen, dass es den weiteren Studien
des Verfassers gelingen möge, noch mancherlei Zweifel
und Fragen über die Geschichte der mittelalterlichen
Keramik des Islam aufzuklären. Den deutschen Fach-
kreisen, denen die wertvollen Originale dieser Gruppe
schwer zugänglich sind, sei das Studium und die
Anschaffung des Werkes angelegentlich empfohlen.
P. JESSEN.
Der Mäander von August Böhaimd, kgl. Reallehrer
München, Verlagsanstalt und Druckerei Dr. Franz
Paul Datterer & Cie., G. m. b. H. Preis 10 M.
Auf 52 Tafeln giebt der Verfasser eine grosse
Anzahl Variationen der Mäanderformen unter Beach-
tung einer systematischen Entwicklung und Einteilung.
Die Verwendung des Mäanders zu Flächenmustern,
wie zu Einfassungen mit Ecklösungen werden gezeigt.
Wenn auch mit Rücksicht auf die billigen Anschaf-
fungskosten nur zwei bis drei Farben im allgemeinen für
die Muster in Anwendung kamen, so wird der Lehrer
leicht andere passende Farben durch die Schüler wählen
lassen können. Trotz der vielen Vorlagenwerke, welche,
wenn auch nicht ausschliesslich, den Mäander eingehend
behandeln, darf dieses Werkchen doch als ein sehr brauch-
bares für die Schule warm empfohlen werden. I7-
Altägyptisches Porzellan. Einer der jüngsten
Sitzungsberichte der französischen Akademie der Wissen-
schaften enthält eine Mitteilung von H. Le Chatelier
über einen Fund altägyptischen Porzellans, der, voraus-
gesetzt, dass seine Echtheit unanfechtbar feststeht, von
grosser Bedeutung für die Geschichte der Keramik
sein würde. Es wäre dadurch nämlich erwiesen, dass
das Porzellan eine sehr viel ältere Erfindung ist, als
man bisher annahm und dass ihr Ruhm nicht den
Chinesen, sondern den alten Ägyptern gebührt. Die
bereits mehrfach erörterte Frage nämlich, ob dieselben
schon echtes Porzellan hergestellt haben, ist bisher
immer verneint worden, so auch von Brogniart in
seiner Traite des arts ceramiques, der erklärt, alle in
Ägypten gefundenen Proben von Porzellan seien
chinesischer Herkunft. Nunmehr aber ist dem oben
genannten Berichterstatter mit einer Sendung von Proben
aus Ägypten das Bruchstück einer aus Saggarah (Memphis)
stammenden kleinen Figur aus einem Grabmale zuge-
gangen, deren hieroglyphische Inschriften, seiner Behaup-
tung nach, nicht den geringsten Zweifel an ihrer ägyp-
tischen Herkunft lassen, und deren chemische Analyse
ergiebt, dass sie aus echtem Weichporzellan in einer
Zusammensetzung besteht, welche von der des chine-
sischen Porzellans durchaus verschieden ist. —ss—
Vignette;
entworfen
von DANIEL BÜCK,
Berlin.
Herausgeber und für die Redaktion verantwortlich: Professor Karl Hoffacker, Architekt in Charlottenburg-Berlin.
Druck von Ernst Hedrich Nach/, in Leipzig.
KLEINE MITTEILUNGEN
Persiens, aus dem 13. Jahrhundert n. Chr., teils als Er-
gebnisse gelegentlicher kleiner Ausgrabungen, teils als
vereinzelte, nach Afrika oder Südeuropa verschlagene
Stücke aufgetaucht sind. Ihm stehen nicht nur die
wertvollen Privatsammlungen Londons, vor allem die
reiche Sammlung von Mr. F. Ducane Godman, zu
Gebote, sondern er verfolgt mit bewundernswerter
Zähigkeit auch das entferntere Material, das in andern
Sammlungen europäischer Hauptstädte sich zerstreut hat.
Die Gattung, die Mr. Wallis durch seine rastlose
Arbeit zu Ehren gebracht hat, ist wohl zu unter-
scheiden von den bekannteren persischen und vorder-
asiatischen Fliesen des 16. und 17. Jahrhunderts, von
denen auch unsere kleineren Museen Proben auf-
zuweisen pflegen. Sie lässt sich nach einigen chrono-
logischen Anzeichen in das 13. Jahrhundert hinauf-
rücken. Ihre Glasur ist meist eine undurchsichtige
Zinnglasur, und ihr Hauptschmuck ist durch metal-
lische Lüsterfarben bewirkt, deren mannigfache, leuch-
tende Töne zu wunderbaren Wirkungen zusammen-
klingen, tiefer und glanzvoller als beispielsweise die
spanischen Lüsterfayencen, dem zauberhaften Farben-
spiel des Labradorfeldspats vergleichbar. Die Orna-
mente zeigen das bekannte, orientalische Rankenorna-
ment in reiner, edler Form, kufische Zierschriftzeichen,
Tiere und menschliche Gestalten.
Der vorliegende Band, der auch in deutschem
Verlage erschienen ist, bringt auf vier prächtigen Tafeln
in Naturgrösse je ein färben- und glanzreiches Bei-
spiel dieser schönen Ware, Gefässe von verschiedener
Form. Der Text ist durch weitere Beispiele von Vasen,
Schalen, Fliesen und Bruchstücken illustriert; er ergänzt
die früheren Werke und bespricht den Zusammenhang
dieser Arbeiten mit den Ausgrabungen in der ägyp-
tischen Ruinenstadt Fostat, der zerstörten Vorgängerin
des heutigen Kairo, und mit einer neuerdings auf-
getauchten Gruppe ähnlicher Stücke von noch un-
sicherer Herkunft. Es ist nicht leicht, die durch den
Kunsthandel verbreiteten Arbeiten dieser Art nach Ort
und Zeit zu bestimmen, weil die Händler den Ur-
sprung ihrer Ware sorgfältig zu verheimlichen suchen.
Wir dürfen wünschen, dass es den weiteren Studien
des Verfassers gelingen möge, noch mancherlei Zweifel
und Fragen über die Geschichte der mittelalterlichen
Keramik des Islam aufzuklären. Den deutschen Fach-
kreisen, denen die wertvollen Originale dieser Gruppe
schwer zugänglich sind, sei das Studium und die
Anschaffung des Werkes angelegentlich empfohlen.
P. JESSEN.
Der Mäander von August Böhaimd, kgl. Reallehrer
München, Verlagsanstalt und Druckerei Dr. Franz
Paul Datterer & Cie., G. m. b. H. Preis 10 M.
Auf 52 Tafeln giebt der Verfasser eine grosse
Anzahl Variationen der Mäanderformen unter Beach-
tung einer systematischen Entwicklung und Einteilung.
Die Verwendung des Mäanders zu Flächenmustern,
wie zu Einfassungen mit Ecklösungen werden gezeigt.
Wenn auch mit Rücksicht auf die billigen Anschaf-
fungskosten nur zwei bis drei Farben im allgemeinen für
die Muster in Anwendung kamen, so wird der Lehrer
leicht andere passende Farben durch die Schüler wählen
lassen können. Trotz der vielen Vorlagenwerke, welche,
wenn auch nicht ausschliesslich, den Mäander eingehend
behandeln, darf dieses Werkchen doch als ein sehr brauch-
bares für die Schule warm empfohlen werden. I7-
Altägyptisches Porzellan. Einer der jüngsten
Sitzungsberichte der französischen Akademie der Wissen-
schaften enthält eine Mitteilung von H. Le Chatelier
über einen Fund altägyptischen Porzellans, der, voraus-
gesetzt, dass seine Echtheit unanfechtbar feststeht, von
grosser Bedeutung für die Geschichte der Keramik
sein würde. Es wäre dadurch nämlich erwiesen, dass
das Porzellan eine sehr viel ältere Erfindung ist, als
man bisher annahm und dass ihr Ruhm nicht den
Chinesen, sondern den alten Ägyptern gebührt. Die
bereits mehrfach erörterte Frage nämlich, ob dieselben
schon echtes Porzellan hergestellt haben, ist bisher
immer verneint worden, so auch von Brogniart in
seiner Traite des arts ceramiques, der erklärt, alle in
Ägypten gefundenen Proben von Porzellan seien
chinesischer Herkunft. Nunmehr aber ist dem oben
genannten Berichterstatter mit einer Sendung von Proben
aus Ägypten das Bruchstück einer aus Saggarah (Memphis)
stammenden kleinen Figur aus einem Grabmale zuge-
gangen, deren hieroglyphische Inschriften, seiner Behaup-
tung nach, nicht den geringsten Zweifel an ihrer ägyp-
tischen Herkunft lassen, und deren chemische Analyse
ergiebt, dass sie aus echtem Weichporzellan in einer
Zusammensetzung besteht, welche von der des chine-
sischen Porzellans durchaus verschieden ist. —ss—
Vignette;
entworfen
von DANIEL BÜCK,
Berlin.
Herausgeber und für die Redaktion verantwortlich: Professor Karl Hoffacker, Architekt in Charlottenburg-Berlin.
Druck von Ernst Hedrich Nach/, in Leipzig.