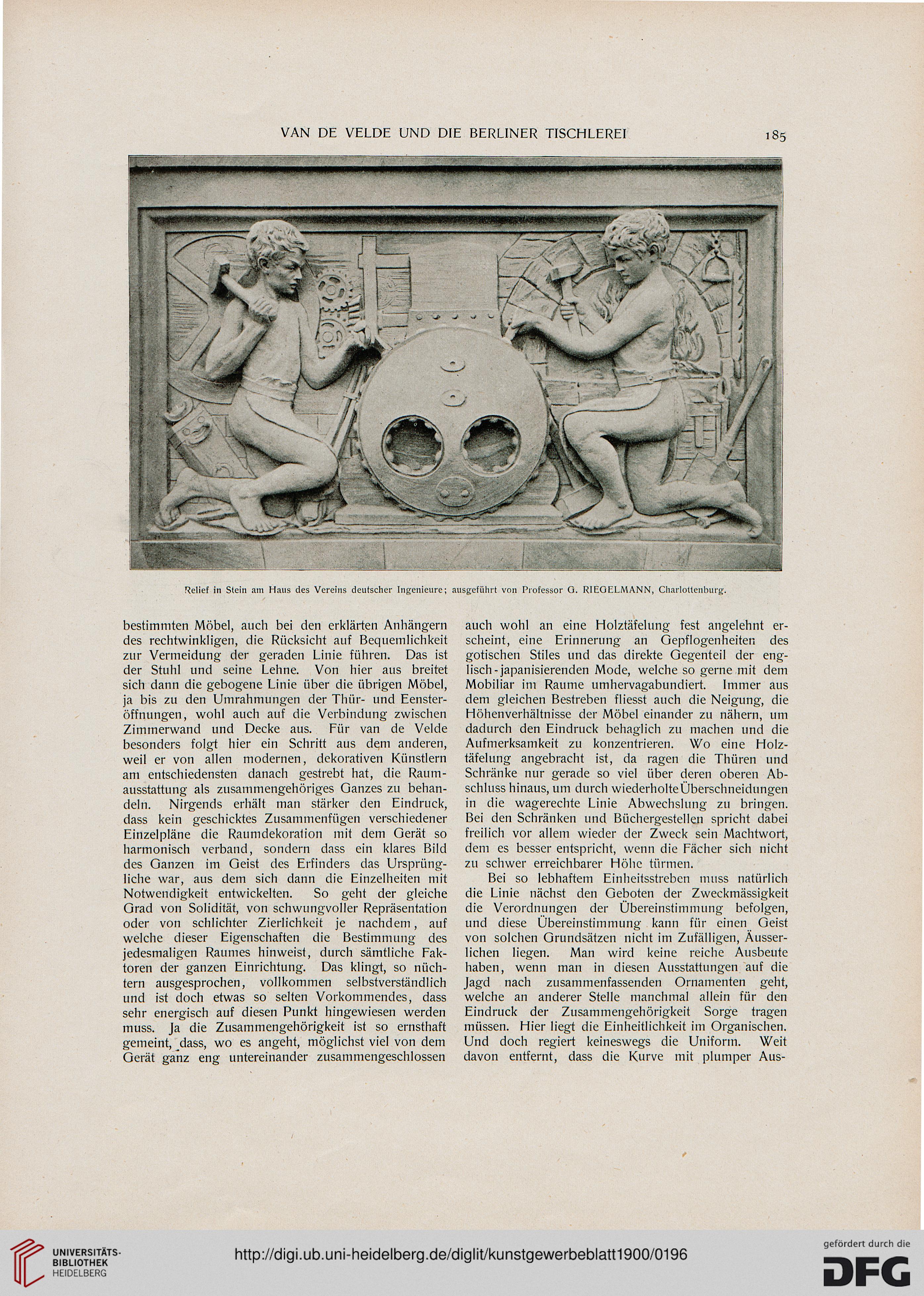VAN DE VELDE UND DIE BERLINER TISCHLEREI
185
Relief in Stein am Haus des Vereins deutscher Ingenieure; ausgeführt von Professor G. RIEGELMANN, Charlotlenburg.
bestimmten Möbel, auch bei den erklärten Anhängern
des rechtwinkligen, die Rücksicht auf Bequemlichkeit
zur Vermeidung der geraden Linie führen. Das ist
der Stuhl und seine Lehne. Von hier aus breitet
sich dann die gebogene Linie über die übrigen Möbel,
ja bis zu den Umrahmungen der Thür- und Eenster-
öffnungen, wohl auch auf die Verbindung zwischen
Zimmerwand und Decke aus. Für van de Velde
besonders folgt hier ein Schritt aus dem anderen,
weil er von allen modernen, dekorativen Künstlern
am entschiedensten danach gestrebt hat, die Raum-
ausstattung als zusammengehöriges Ganzes zu behan-
deln. Nirgends erhält man stärker den Eindruck,
dass kein geschicktes Zusammenfügen verschiedener
Einzelpläne die Raumdekoralion mit dem Gerät so
harmonisch verband, sondern dass ein klares Bild
des Ganzen im Geist des Erfinders das Ursprüng-
liche war, aus dem sich dann die Einzelheiten mit
Notwendigkeit entwickelten. So geht der gleiche
Grad von Solidität, von schwungvoller Repräsentation
oder von schlichter Zierlichkeit je nachdem, auf
welche dieser Eigenschaften die Bestimmung des
jedesmaligen Raumes hinweist, durch sämtliche Fak-
toren der ganzen Einrichtung. Das klingt, so nüch-
tern ausgesprochen, vollkommen selbstverständlich
und ist doch etwas so selten Vorkommendes, dass
sehr energisch auf diesen Punkt hingewiesen werden
muss. Ja die Zusammengehörigkeit ist so ernsthaft
gemeint, dass, wo es angeht, möglichst viel von dem
Gerät ganz eng untereinander zusammengeschlossen
auch wohl an eine Holztäfelung fest angelehnt er-
scheint, eine Erinnerung an Gepflogenheiten des
gotischen Stiles und das direkte Gegenteil der eng-
lisch-japanisierenden Mode, welche so gerne mit dem
Mobiliar im Räume umhervagabundiert. Immer aus
dem gleichen Bestreben fliesst auch die Neigung, die
Höllenverhältnisse der Möbel einander zu nähern, um
dadurch den Eindruck behaglich zu machen und die
Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Wo eine Holz-
täfelung angebracht ist, da ragen die Thüren und
Schränke nur gerade so viel über deren oberen Ab-
schluss hinaus, um durch wiederholte Überschneidungen
in die wagerechte Linie Abwechslung zu bringen.
Bei den Schränken und Büchergestellen spricht dabei
freilich vor allem wieder der Zweck sein Machtwort,
dem es besser entspricht, wenn die Fächer sich nicht
zu schwer erreichbarer Höhe türmen.
Bei so lebhaftem Einheitsstreben muss natürlich
die Linie nächst den Geboten der Zweckmässigkeit
die Verordnungen der Übereinstimmung befolgen,
und diese Übereinstimmung kann für einen Geist
von solchen Grundsätzen nicht im Zufälligen, Äusser-
lichen liegen. Man wird keine reiche Ausbeute
haben, wenn man in diesen Ausstattungen auf die
Jagd nach zusammenfassenden Ornamenten geht,
welche an anderer Stelle manchmal allein für den
Eindruck der Zusammengehörigkeit Sorge tragen
müssen. Hier liegt die Einheitlichkeit im Organischen.
Und doch regiert keineswegs die Uniform. Weit
davon entfernt, dass die Kurve mit plumper Aus-
185
Relief in Stein am Haus des Vereins deutscher Ingenieure; ausgeführt von Professor G. RIEGELMANN, Charlotlenburg.
bestimmten Möbel, auch bei den erklärten Anhängern
des rechtwinkligen, die Rücksicht auf Bequemlichkeit
zur Vermeidung der geraden Linie führen. Das ist
der Stuhl und seine Lehne. Von hier aus breitet
sich dann die gebogene Linie über die übrigen Möbel,
ja bis zu den Umrahmungen der Thür- und Eenster-
öffnungen, wohl auch auf die Verbindung zwischen
Zimmerwand und Decke aus. Für van de Velde
besonders folgt hier ein Schritt aus dem anderen,
weil er von allen modernen, dekorativen Künstlern
am entschiedensten danach gestrebt hat, die Raum-
ausstattung als zusammengehöriges Ganzes zu behan-
deln. Nirgends erhält man stärker den Eindruck,
dass kein geschicktes Zusammenfügen verschiedener
Einzelpläne die Raumdekoralion mit dem Gerät so
harmonisch verband, sondern dass ein klares Bild
des Ganzen im Geist des Erfinders das Ursprüng-
liche war, aus dem sich dann die Einzelheiten mit
Notwendigkeit entwickelten. So geht der gleiche
Grad von Solidität, von schwungvoller Repräsentation
oder von schlichter Zierlichkeit je nachdem, auf
welche dieser Eigenschaften die Bestimmung des
jedesmaligen Raumes hinweist, durch sämtliche Fak-
toren der ganzen Einrichtung. Das klingt, so nüch-
tern ausgesprochen, vollkommen selbstverständlich
und ist doch etwas so selten Vorkommendes, dass
sehr energisch auf diesen Punkt hingewiesen werden
muss. Ja die Zusammengehörigkeit ist so ernsthaft
gemeint, dass, wo es angeht, möglichst viel von dem
Gerät ganz eng untereinander zusammengeschlossen
auch wohl an eine Holztäfelung fest angelehnt er-
scheint, eine Erinnerung an Gepflogenheiten des
gotischen Stiles und das direkte Gegenteil der eng-
lisch-japanisierenden Mode, welche so gerne mit dem
Mobiliar im Räume umhervagabundiert. Immer aus
dem gleichen Bestreben fliesst auch die Neigung, die
Höllenverhältnisse der Möbel einander zu nähern, um
dadurch den Eindruck behaglich zu machen und die
Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Wo eine Holz-
täfelung angebracht ist, da ragen die Thüren und
Schränke nur gerade so viel über deren oberen Ab-
schluss hinaus, um durch wiederholte Überschneidungen
in die wagerechte Linie Abwechslung zu bringen.
Bei den Schränken und Büchergestellen spricht dabei
freilich vor allem wieder der Zweck sein Machtwort,
dem es besser entspricht, wenn die Fächer sich nicht
zu schwer erreichbarer Höhe türmen.
Bei so lebhaftem Einheitsstreben muss natürlich
die Linie nächst den Geboten der Zweckmässigkeit
die Verordnungen der Übereinstimmung befolgen,
und diese Übereinstimmung kann für einen Geist
von solchen Grundsätzen nicht im Zufälligen, Äusser-
lichen liegen. Man wird keine reiche Ausbeute
haben, wenn man in diesen Ausstattungen auf die
Jagd nach zusammenfassenden Ornamenten geht,
welche an anderer Stelle manchmal allein für den
Eindruck der Zusammengehörigkeit Sorge tragen
müssen. Hier liegt die Einheitlichkeit im Organischen.
Und doch regiert keineswegs die Uniform. Weit
davon entfernt, dass die Kurve mit plumper Aus-