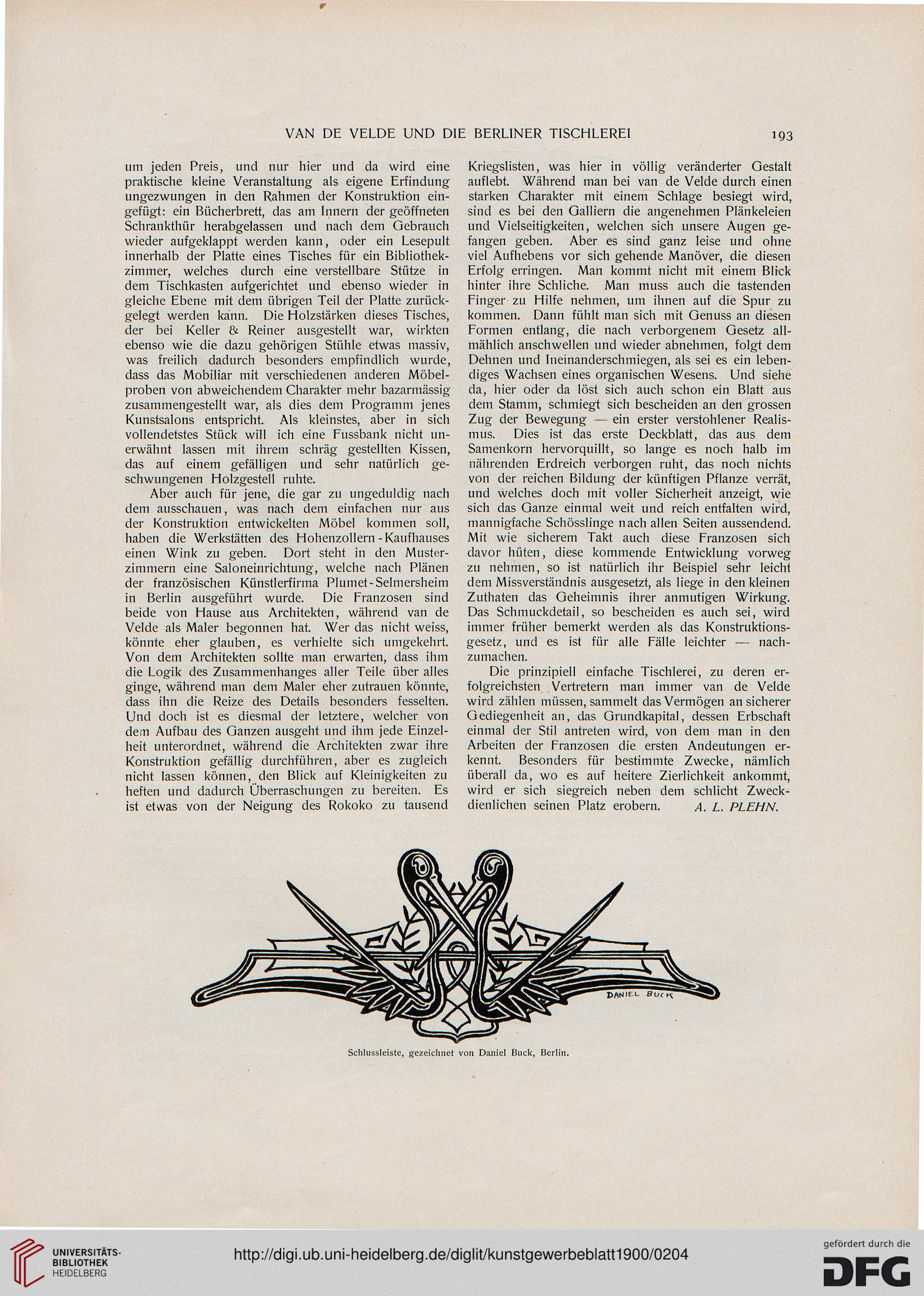VAN DE VELDE UND DIE BERLINER TISCHLEREI
193
um jeden Preis, und nur hier und da wird eine
praktische kleine Veranstaltung als eigene Erfindung
ungezwungen in den Rahmen der Konstruktion ein-
gefügt: ein Bücherbrett, das am Innern der geöffneten
Schrankthür herabgelassen und nach dem Gebrauch
wieder aufgeklappt werden kann, oder ein Lesepult
innerhalb der Platte eines Tisches für ein Bibliothek-
zimmer, welches durch eine verstellbare Stütze in
dem Tischkasten aufgerichtet und ebenso wieder in
gleiche Ebene mit dem übrigen Teil der Platte zurück-
gelegt werden kann. Die Holzstärken dieses Tisches,
der bei Keller & Reiner ausgestellt war, wirkten
ebenso wie die dazu gehörigen Stühle etwas massiv,
was freilich dadurch besonders empfindlich wurde,
dass das Mobiliar mit verschiedenen anderen Möbel-
proben von abweichendem Charakter mehr bazarmässig
zusammengestellt war, als dies dem Programm jenes
Kunstsalons entspricht. Als kleinstes, aber in sich
vollendetstes Stück will ich eine Fussbank nicht un-
erwähnt lassen mit ihrem schräg gestellten Kissen,
das auf einem gefälligen und sehr natürlich ge-
schwungenen Holzgestell ruhte.
Aber auch für jene, die gar zu ungeduldig nach
dem ausschauen, was nach dem einfachen nur aus
der Konstruktion entwickelten Möbel kommen soll,
haben die Werkstätten des Hohenzollern - Kaufhauses
einen Wink zu geben. Dort steht in den Muster-
zimmern eine Saloneinrichtung, welche nach Plänen
der französischen Künstlerfirma Plumet-Selmersheim
in Berlin ausgeführt wurde. Die Franzosen sind
beide von Hause aus Architekten, während van de
Velde als Maler begonnen hat. Wer das nicht weiss,
könnte eher glauben, es verhielte sich umgekehrt.
Von dem Architekten sollte man erwarten, dass ihm
die Logik des Zusammenhanges aller Teile über alles
ginge, während man dem Maler eher zutrauen könnte,
dass ihn die Reize des Details besonders fesselten.
Und doch ist es diesmal der letztere, welcher von
dem Aufbau des Ganzen ausgeht und ihm jede Einzel-
heit unterordnet, während die Architekten zwar ihre
Konstruktion gefällig durchführen, aber es zugleich
nicht lassen können, den Blick auf Kleinigkeiten zu
heften und dadurch Überraschungen zu bereiten. Es
ist etwas von der Neigung des Rokoko zu tausend
Kriegslisten, was hier in völlig veränderter Gestalt
auflebt. Während man bei van de Velde durch einen
starken Charakter mit einem Schlage besiegt wird,
sind es bei den Galliern die angenehmen Plänkeleien
und Vielseitigkeiten, welchen sich unsere Augen ge-
fangen geben. Aber es sind ganz leise und ohne
viel Aufhebens vor sich gehende Manöver, die diesen
Erfolg erringen. Man kommt nicht mit einem Blick
hinter ihre Schliche. Man muss auch die tastenden
Finger zu Hilfe nehmen, um ihnen auf die Spur zu
kommen. Dann fühlt man sich mit Genuss an diesen
Formen entlang, die nach verborgenem Gesetz all-
mählich anschwellen und wieder abnehmen, folgt dem
Dehnen und Ineinanderschmiegen, als sei es ein leben-
diges Wachsen eines organischen Wesens. Und siehe
da, hier oder da löst sich auch schon ein Blatt aus
dem Stamm, schmiegt sich bescheiden an den grossen
Zug der Bewegung — ein erster verstohlener Realis-
mus. Dies ist das erste Deckblatt, das aus dem
Samenkorn hervorquillt, so lange es noch halb im
nährenden Erdreich verborgen ruht, das noch nichts
von der reichen Bildung der künftigen Pflanze verrät,
und welches doch mit voller Sicherheit anzeigt, wie
sich das Ganze einmal weit und reich entfalten wird,
mannigfache Schösslinge nach allen Seiten aussendend.
Mit wie sicherem Takt auch diese Franzosen sich
davor hüten, diese kommende Entwicklung vorweg
zu nehmen, so ist natürlich ihr Beispiel sehr leicht
dem Missverständnis ausgesetzt, als liege in den kleinen
Zuthaten das Geheimnis ihrer anmutigen Wirkung.
Das Schmuckdetail, so bescheiden es auch sei, wird
immer früher bemerkt werden als das Konstruktions-
gesetz, und es ist für alle Fälle leichter — nach-
zumachen.
Die prinzipiell einfache Tischlerei, zu deren er-
folgreichsten Vertretern man immer van de Velde
wird zählen müssen, sammelt das Vermögen an sicherer
Gediegenheit an, das Grundkapital, dessen Erbschaft
einmal der Stil antreten wird, von dem man in den
Arbeiten der Franzosen die ersten Andeutungen er-
kennt. Besonders für bestimmte Zwecke, nämlich
überall da, wo es auf heitere Zierlichkeit ankommt,
wird er sich siegreich neben dem schlicht Zweck-
dienlichen seinen Platz erobern. A. L. PLEHN.
Schlussleiste, gezeichnet von Daniel Bück, Berlin.
193
um jeden Preis, und nur hier und da wird eine
praktische kleine Veranstaltung als eigene Erfindung
ungezwungen in den Rahmen der Konstruktion ein-
gefügt: ein Bücherbrett, das am Innern der geöffneten
Schrankthür herabgelassen und nach dem Gebrauch
wieder aufgeklappt werden kann, oder ein Lesepult
innerhalb der Platte eines Tisches für ein Bibliothek-
zimmer, welches durch eine verstellbare Stütze in
dem Tischkasten aufgerichtet und ebenso wieder in
gleiche Ebene mit dem übrigen Teil der Platte zurück-
gelegt werden kann. Die Holzstärken dieses Tisches,
der bei Keller & Reiner ausgestellt war, wirkten
ebenso wie die dazu gehörigen Stühle etwas massiv,
was freilich dadurch besonders empfindlich wurde,
dass das Mobiliar mit verschiedenen anderen Möbel-
proben von abweichendem Charakter mehr bazarmässig
zusammengestellt war, als dies dem Programm jenes
Kunstsalons entspricht. Als kleinstes, aber in sich
vollendetstes Stück will ich eine Fussbank nicht un-
erwähnt lassen mit ihrem schräg gestellten Kissen,
das auf einem gefälligen und sehr natürlich ge-
schwungenen Holzgestell ruhte.
Aber auch für jene, die gar zu ungeduldig nach
dem ausschauen, was nach dem einfachen nur aus
der Konstruktion entwickelten Möbel kommen soll,
haben die Werkstätten des Hohenzollern - Kaufhauses
einen Wink zu geben. Dort steht in den Muster-
zimmern eine Saloneinrichtung, welche nach Plänen
der französischen Künstlerfirma Plumet-Selmersheim
in Berlin ausgeführt wurde. Die Franzosen sind
beide von Hause aus Architekten, während van de
Velde als Maler begonnen hat. Wer das nicht weiss,
könnte eher glauben, es verhielte sich umgekehrt.
Von dem Architekten sollte man erwarten, dass ihm
die Logik des Zusammenhanges aller Teile über alles
ginge, während man dem Maler eher zutrauen könnte,
dass ihn die Reize des Details besonders fesselten.
Und doch ist es diesmal der letztere, welcher von
dem Aufbau des Ganzen ausgeht und ihm jede Einzel-
heit unterordnet, während die Architekten zwar ihre
Konstruktion gefällig durchführen, aber es zugleich
nicht lassen können, den Blick auf Kleinigkeiten zu
heften und dadurch Überraschungen zu bereiten. Es
ist etwas von der Neigung des Rokoko zu tausend
Kriegslisten, was hier in völlig veränderter Gestalt
auflebt. Während man bei van de Velde durch einen
starken Charakter mit einem Schlage besiegt wird,
sind es bei den Galliern die angenehmen Plänkeleien
und Vielseitigkeiten, welchen sich unsere Augen ge-
fangen geben. Aber es sind ganz leise und ohne
viel Aufhebens vor sich gehende Manöver, die diesen
Erfolg erringen. Man kommt nicht mit einem Blick
hinter ihre Schliche. Man muss auch die tastenden
Finger zu Hilfe nehmen, um ihnen auf die Spur zu
kommen. Dann fühlt man sich mit Genuss an diesen
Formen entlang, die nach verborgenem Gesetz all-
mählich anschwellen und wieder abnehmen, folgt dem
Dehnen und Ineinanderschmiegen, als sei es ein leben-
diges Wachsen eines organischen Wesens. Und siehe
da, hier oder da löst sich auch schon ein Blatt aus
dem Stamm, schmiegt sich bescheiden an den grossen
Zug der Bewegung — ein erster verstohlener Realis-
mus. Dies ist das erste Deckblatt, das aus dem
Samenkorn hervorquillt, so lange es noch halb im
nährenden Erdreich verborgen ruht, das noch nichts
von der reichen Bildung der künftigen Pflanze verrät,
und welches doch mit voller Sicherheit anzeigt, wie
sich das Ganze einmal weit und reich entfalten wird,
mannigfache Schösslinge nach allen Seiten aussendend.
Mit wie sicherem Takt auch diese Franzosen sich
davor hüten, diese kommende Entwicklung vorweg
zu nehmen, so ist natürlich ihr Beispiel sehr leicht
dem Missverständnis ausgesetzt, als liege in den kleinen
Zuthaten das Geheimnis ihrer anmutigen Wirkung.
Das Schmuckdetail, so bescheiden es auch sei, wird
immer früher bemerkt werden als das Konstruktions-
gesetz, und es ist für alle Fälle leichter — nach-
zumachen.
Die prinzipiell einfache Tischlerei, zu deren er-
folgreichsten Vertretern man immer van de Velde
wird zählen müssen, sammelt das Vermögen an sicherer
Gediegenheit an, das Grundkapital, dessen Erbschaft
einmal der Stil antreten wird, von dem man in den
Arbeiten der Franzosen die ersten Andeutungen er-
kennt. Besonders für bestimmte Zwecke, nämlich
überall da, wo es auf heitere Zierlichkeit ankommt,
wird er sich siegreich neben dem schlicht Zweck-
dienlichen seinen Platz erobern. A. L. PLEHN.
Schlussleiste, gezeichnet von Daniel Bück, Berlin.