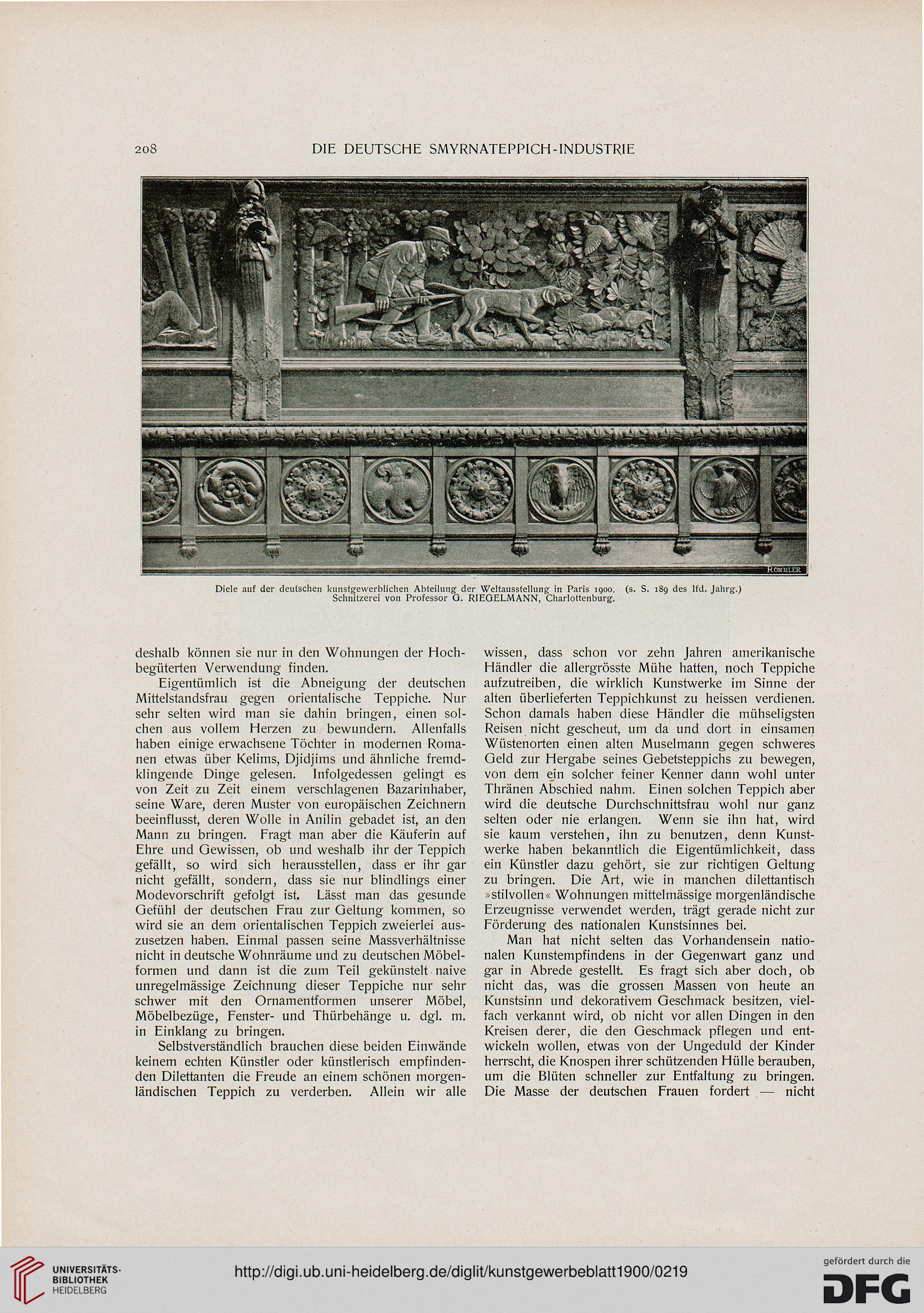208
DIE DEUTSCHE SMYRNATEPPICH-INDUSTRIE
Diele auf der deutschen kunstgewerblichen Abteilung der Weltausstellung in Paris igoo.
Schnitzerei von Professor O. RIEGELMANN, Charlotteuburg.
(s. S. 189 des lfd. Jahrg.)
deshalb können sie nur in den Wohnungen der Hoch-
begüterten Verwendung finden.
Eigentümlich ist die Abneigung der deutschen
Mittelstandsfrau gegen orientalische Teppiche. Nur
sehr selten wird man sie dahin bringen, einen sol-
chen aus vollem Herzen zu bewundern. Allenfalls
haben einige erwachsene Töchter in modernen Roma-
nen etwas über Kelims, Djidjims und ähnliche fremd-
klingende Dinge gelesen. Infolgedessen gelingt es
von Zeit zu Zeit einem verschlagenen Bazarinhaber,
seine Ware, deren Muster von europäischen Zeichnern
beeinflusst, deren Wolle in Anilin gebadet ist, an den
Mann zu bringen. Fragt man aber die Käuferin auf
Ehre und Gewissen, ob und weshalb ihr der Teppich
gefällt, so wird sich herausstellen, dass er ihr gar
nicht gefällt, sondern, dass sie nur blindlings einer
Modevorschrift gefolgt ist. Lässt man das gesunde
Gefühl der deutschen Frau zur Geltung kommen, so
wird sie an dem orientalischen Teppich zweierlei aus-
zusetzen haben. Einmal passen seine Massverhältnisse
nicht in deutsche Wohnräume und zu deutschen Möbel-
formen und dann ist die zum Teil gekünstelt naive
unregelmässige Zeichnung dieser Teppiche nur sehr
schwer mit den Ornamentformen unserer Möbel,
Möbelbezüge, Fenster- und Thürbehänge u. dgl. m.
in Einklang zu bringen.
Selbstverständlich brauchen diese beiden Einwände
keinem echten Künstler oder künstlerisch empfinden-
den Dilettanten die Freude an einem schönen morgen-
ländischen Teppich zu verderben. Allein wir alle
wissen, dass schon vor zehn Jahren amerikanische
Händler die allergrösste Mühe hatten, noch Teppiche
aufzutreiben, die wirklich Kunstwerke im Sinne der
alten überlieferten Teppichkunst zu heissen verdienen.
Schon damals haben diese Händler die mühseligsten
Reisen nicht gescheut, um da und dort in einsamen
Wiistenorten einen alten Muselmann gegen schweres
Geld zur Hergabe seines Gebetsteppichs zu bewegen,
von dem ein solcher feiner Kenner dann wohl unter
Thränen Abschied nahm. Einen solchen Teppich aber
wird die deutsche Durchschnittsfrau wohl nur ganz
selten oder nie erlangen. Wenn sie ihn hat, wird
sie kaum verstehen, ihn zu benutzen, denn Kunst-
werke haben bekanntlich die Eigentümlichkeit, dass
ein Künstler dazu gehört, sie zur richtigen Geltung
zu bringen. Die Art, wie in manchen dilettantisch
»stilvollen« Wohnungen mittel massige morgenländische
Erzeugnisse verwendet werden, trägt gerade nicht zur
Förderung des nationalen Kunstsinnes bei.
Man hat nicht selten das Vorhandensein natio-
nalen Kunstempfindens in der Gegenwart ganz und
gar in Abrede gestellt. Es fragt sich aber doch, ob
nicht das, was die grossen Massen von heute an
Kunstsinn und dekorativem Geschmack besitzen, viel-
fach verkannt wird, ob nicht vor allen Dingen in den
Kreisen derer, die den Geschmack pflegen und ent-
wickeln wollen, etwas von der Ungeduld der Kinder
herrscht, die Knospen ihrer schützenden Hülle berauben,
um die Blüten schneller zur Entfaltung zu bringen.
Die Masse der deutschen Frauen fordert — nicht
DIE DEUTSCHE SMYRNATEPPICH-INDUSTRIE
Diele auf der deutschen kunstgewerblichen Abteilung der Weltausstellung in Paris igoo.
Schnitzerei von Professor O. RIEGELMANN, Charlotteuburg.
(s. S. 189 des lfd. Jahrg.)
deshalb können sie nur in den Wohnungen der Hoch-
begüterten Verwendung finden.
Eigentümlich ist die Abneigung der deutschen
Mittelstandsfrau gegen orientalische Teppiche. Nur
sehr selten wird man sie dahin bringen, einen sol-
chen aus vollem Herzen zu bewundern. Allenfalls
haben einige erwachsene Töchter in modernen Roma-
nen etwas über Kelims, Djidjims und ähnliche fremd-
klingende Dinge gelesen. Infolgedessen gelingt es
von Zeit zu Zeit einem verschlagenen Bazarinhaber,
seine Ware, deren Muster von europäischen Zeichnern
beeinflusst, deren Wolle in Anilin gebadet ist, an den
Mann zu bringen. Fragt man aber die Käuferin auf
Ehre und Gewissen, ob und weshalb ihr der Teppich
gefällt, so wird sich herausstellen, dass er ihr gar
nicht gefällt, sondern, dass sie nur blindlings einer
Modevorschrift gefolgt ist. Lässt man das gesunde
Gefühl der deutschen Frau zur Geltung kommen, so
wird sie an dem orientalischen Teppich zweierlei aus-
zusetzen haben. Einmal passen seine Massverhältnisse
nicht in deutsche Wohnräume und zu deutschen Möbel-
formen und dann ist die zum Teil gekünstelt naive
unregelmässige Zeichnung dieser Teppiche nur sehr
schwer mit den Ornamentformen unserer Möbel,
Möbelbezüge, Fenster- und Thürbehänge u. dgl. m.
in Einklang zu bringen.
Selbstverständlich brauchen diese beiden Einwände
keinem echten Künstler oder künstlerisch empfinden-
den Dilettanten die Freude an einem schönen morgen-
ländischen Teppich zu verderben. Allein wir alle
wissen, dass schon vor zehn Jahren amerikanische
Händler die allergrösste Mühe hatten, noch Teppiche
aufzutreiben, die wirklich Kunstwerke im Sinne der
alten überlieferten Teppichkunst zu heissen verdienen.
Schon damals haben diese Händler die mühseligsten
Reisen nicht gescheut, um da und dort in einsamen
Wiistenorten einen alten Muselmann gegen schweres
Geld zur Hergabe seines Gebetsteppichs zu bewegen,
von dem ein solcher feiner Kenner dann wohl unter
Thränen Abschied nahm. Einen solchen Teppich aber
wird die deutsche Durchschnittsfrau wohl nur ganz
selten oder nie erlangen. Wenn sie ihn hat, wird
sie kaum verstehen, ihn zu benutzen, denn Kunst-
werke haben bekanntlich die Eigentümlichkeit, dass
ein Künstler dazu gehört, sie zur richtigen Geltung
zu bringen. Die Art, wie in manchen dilettantisch
»stilvollen« Wohnungen mittel massige morgenländische
Erzeugnisse verwendet werden, trägt gerade nicht zur
Förderung des nationalen Kunstsinnes bei.
Man hat nicht selten das Vorhandensein natio-
nalen Kunstempfindens in der Gegenwart ganz und
gar in Abrede gestellt. Es fragt sich aber doch, ob
nicht das, was die grossen Massen von heute an
Kunstsinn und dekorativem Geschmack besitzen, viel-
fach verkannt wird, ob nicht vor allen Dingen in den
Kreisen derer, die den Geschmack pflegen und ent-
wickeln wollen, etwas von der Ungeduld der Kinder
herrscht, die Knospen ihrer schützenden Hülle berauben,
um die Blüten schneller zur Entfaltung zu bringen.
Die Masse der deutschen Frauen fordert — nicht