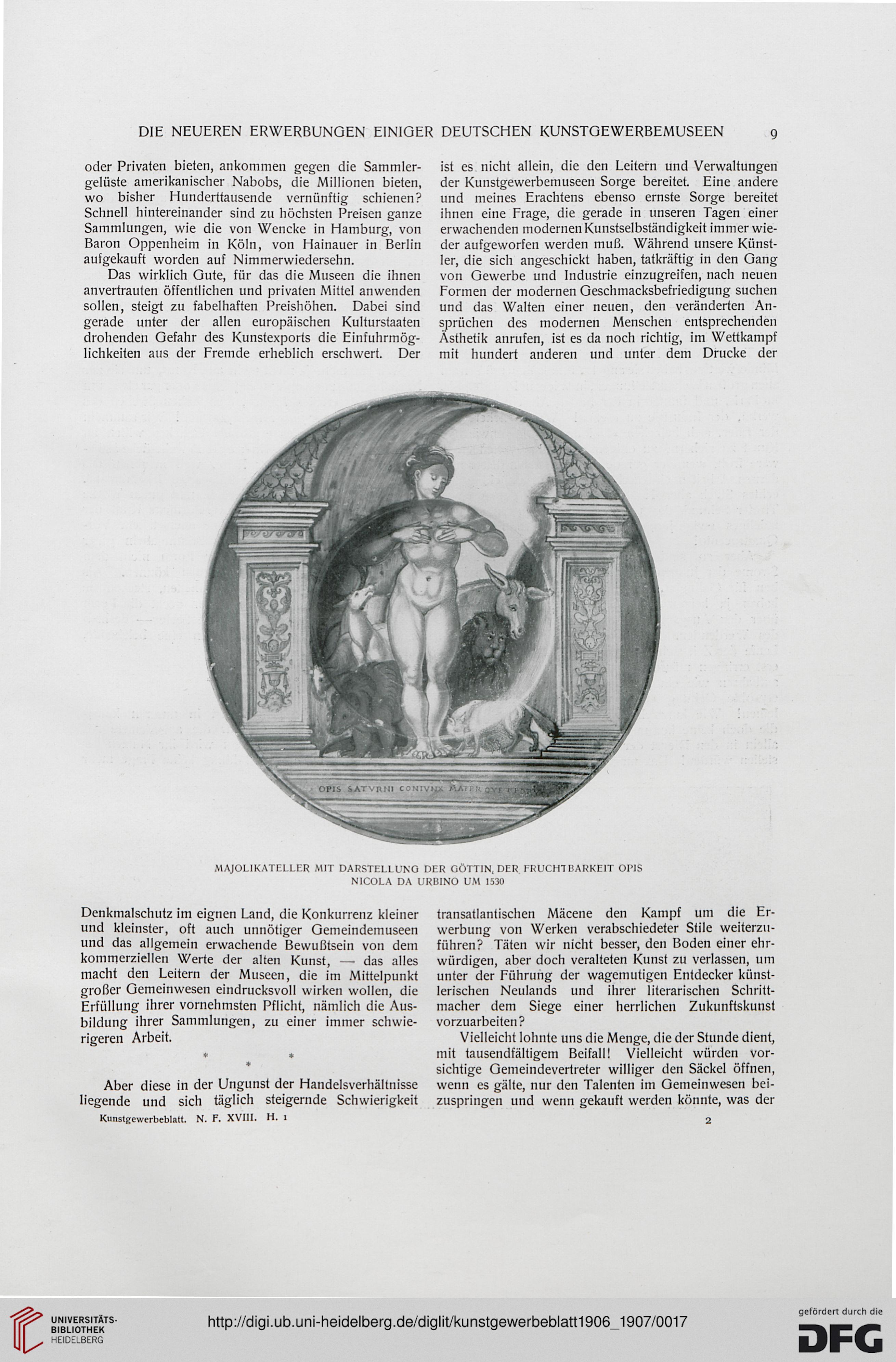DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEMUSEEN
oder Privaten bieten, ankommen gegen die Sammler-
gelüste amerikanischer Nabobs, die Millionen bieten,
wo bisher Hunderttausende vernünftig schienen?
Schnell hintereinander sind zu höchsten Preisen ganze
Sammlungen, wie die von Wencke in Hamburg, von
Baron Oppenheim in Köln, von Hainauer in Berlin
aufgekauft worden auf Nimmerwiedersehn.
Das wirklich Gute, für das die Museen die ihnen
anvertrauten öffentlichen und privaten Mittel anwenden
sollen, steigt zu fabelhaften Preishöhen. Dabei sind
gerade unter der allen europäischen Kulturstaaten
drohenden Gefahr des Kunstexports die Einfuhrmög-
lichkeiten aus der Fremde erheblich erschwert. Der
ist es nicht allein, die den Leitern und Verwaltungen
der Kunstgewerbemuseen Sorge bereitet. Eine andere
und meines Erachtens ebenso ernste Sorge bereitet
ihnen eine Frage, die gerade in unseren Tagen einer
erwachenden modernen Kunstselbständigkeit immer wie-
der aufgeworfen werden muß. Während unsere Künst-
ler, die sich angeschickt haben, tatkräftig in den Gang
von Gewerbe und Industrie einzugreifen, nach neuen
Formen der modernen Geschmacksbefriedigung suchen
und das Walten einer neuen, den veränderten An-
sprüchen des modernen Menschen entsprechenden
Ästhetik anrufen, ist es da noch richtig, im Wettkampf
mit hundert anderen und unter dem Drucke der
MAJOLIKATELLER MIT DARSTELLUNO DER GÖTTIN, DER FRUCHT RARKEIT OI'IS
NICOLA DA URBINO UM 1530
Denkmalschutz im eignen Land, die Konkurrenz kleiner
und kleinster, oft auch unnötiger Gemeindemuseen
und das allgemein erwachende Bewußtsein von dem
kommerziellen Werte der alten Kunst, — das alles
macht den Leitern der Museen, die im Mittelpunkt
großer Gemeinwesen eindrucksvoll wirken wollen, die
Erfüllung ihrer vornehmsten Pflicht, nämlich die Aus-
bildung ihrer Sammlungen, zu einer immer schwie-
rigeren Arbeit.
Aber diese in der Ungunst der Handelsverhältnisse
liegende und sich täglich steigernde Schwierigkeit
Kunstgewcrbeblatt. N. F. XVIII. H. l
transatlantischen Mäcene den Kampf um die Er-
werbung von Werken verabschiedeter Stile weiterzu-
führen? Täten wir nicht besser, den Boden einer ehr-
würdigen, aber doch veralteten Kunst zu verlassen, um
unter der Führung der wagemutigen Entdecker künst-
lerischen Neulands und ihrer literarischen Schritt-
macher dem Siege einer herrlichen Zukunftskunst
vorzuarbeiten?
Vielleicht lohnte uns die Menge, die der Stunde dient,
mit tausendfältigem Beifall! Vielleicht würden vor-
sichtige Gemeindevertreter williger den Säckel öffnen,
wenn es gälte, nur den Talenten im Gemeinwesen bei-
zuspringen und wenn gekauft werden könnte, was der
oder Privaten bieten, ankommen gegen die Sammler-
gelüste amerikanischer Nabobs, die Millionen bieten,
wo bisher Hunderttausende vernünftig schienen?
Schnell hintereinander sind zu höchsten Preisen ganze
Sammlungen, wie die von Wencke in Hamburg, von
Baron Oppenheim in Köln, von Hainauer in Berlin
aufgekauft worden auf Nimmerwiedersehn.
Das wirklich Gute, für das die Museen die ihnen
anvertrauten öffentlichen und privaten Mittel anwenden
sollen, steigt zu fabelhaften Preishöhen. Dabei sind
gerade unter der allen europäischen Kulturstaaten
drohenden Gefahr des Kunstexports die Einfuhrmög-
lichkeiten aus der Fremde erheblich erschwert. Der
ist es nicht allein, die den Leitern und Verwaltungen
der Kunstgewerbemuseen Sorge bereitet. Eine andere
und meines Erachtens ebenso ernste Sorge bereitet
ihnen eine Frage, die gerade in unseren Tagen einer
erwachenden modernen Kunstselbständigkeit immer wie-
der aufgeworfen werden muß. Während unsere Künst-
ler, die sich angeschickt haben, tatkräftig in den Gang
von Gewerbe und Industrie einzugreifen, nach neuen
Formen der modernen Geschmacksbefriedigung suchen
und das Walten einer neuen, den veränderten An-
sprüchen des modernen Menschen entsprechenden
Ästhetik anrufen, ist es da noch richtig, im Wettkampf
mit hundert anderen und unter dem Drucke der
MAJOLIKATELLER MIT DARSTELLUNO DER GÖTTIN, DER FRUCHT RARKEIT OI'IS
NICOLA DA URBINO UM 1530
Denkmalschutz im eignen Land, die Konkurrenz kleiner
und kleinster, oft auch unnötiger Gemeindemuseen
und das allgemein erwachende Bewußtsein von dem
kommerziellen Werte der alten Kunst, — das alles
macht den Leitern der Museen, die im Mittelpunkt
großer Gemeinwesen eindrucksvoll wirken wollen, die
Erfüllung ihrer vornehmsten Pflicht, nämlich die Aus-
bildung ihrer Sammlungen, zu einer immer schwie-
rigeren Arbeit.
Aber diese in der Ungunst der Handelsverhältnisse
liegende und sich täglich steigernde Schwierigkeit
Kunstgewcrbeblatt. N. F. XVIII. H. l
transatlantischen Mäcene den Kampf um die Er-
werbung von Werken verabschiedeter Stile weiterzu-
führen? Täten wir nicht besser, den Boden einer ehr-
würdigen, aber doch veralteten Kunst zu verlassen, um
unter der Führung der wagemutigen Entdecker künst-
lerischen Neulands und ihrer literarischen Schritt-
macher dem Siege einer herrlichen Zukunftskunst
vorzuarbeiten?
Vielleicht lohnte uns die Menge, die der Stunde dient,
mit tausendfältigem Beifall! Vielleicht würden vor-
sichtige Gemeindevertreter williger den Säckel öffnen,
wenn es gälte, nur den Talenten im Gemeinwesen bei-
zuspringen und wenn gekauft werden könnte, was der