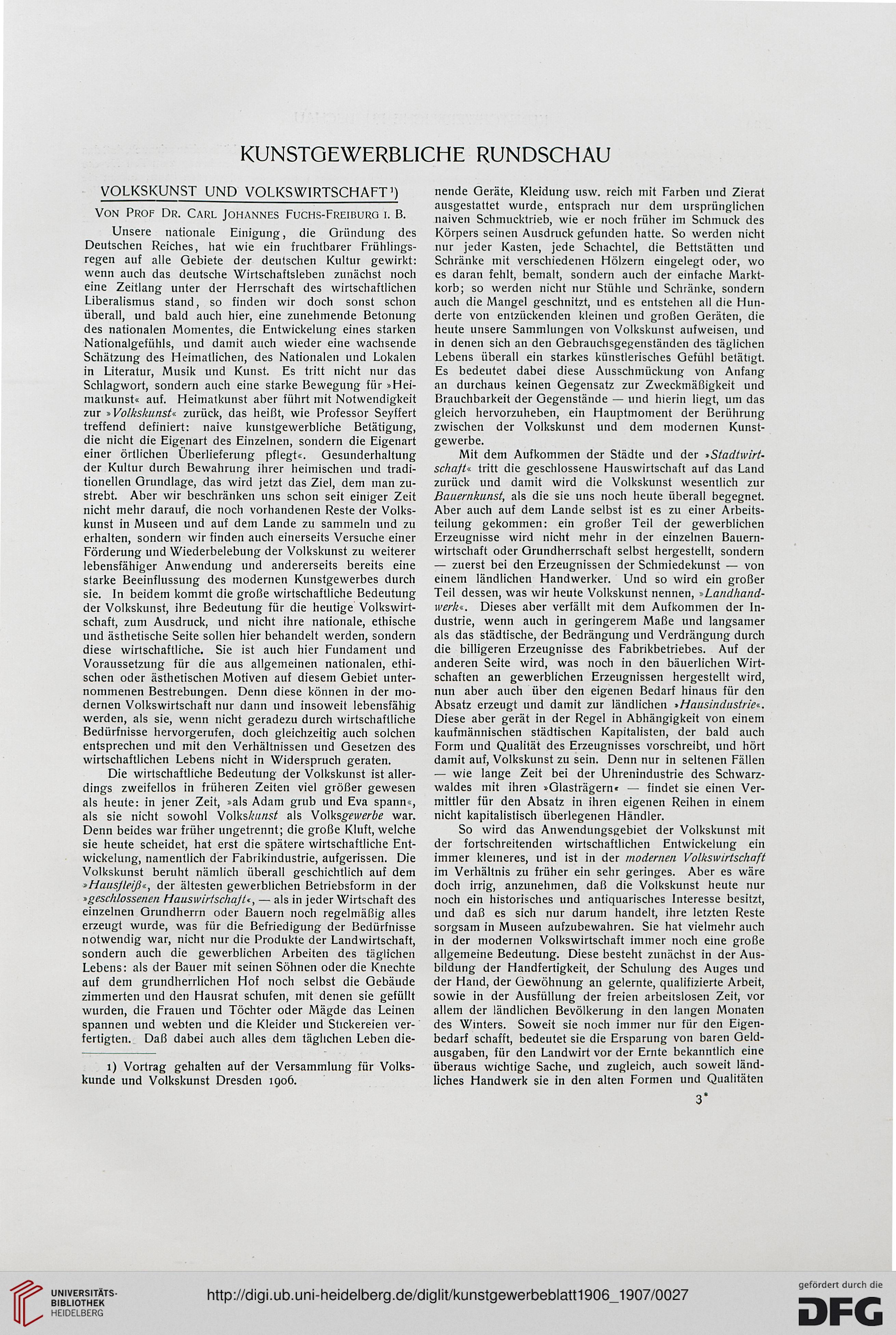KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
VOLKSKUNST UND VOLKSWIRTSCHAFT1)
Von Prof Dr. Carl Johannes Fuchs-Freiburg i. B.
Unsere nationale Einigung, die Gründung des
Deutschen Reiches, hat wie ein fruchtbarer Frühlings-
regen auf alle Gebiete der deutschen Kultur gewirkt:
wenn auch das deutsche Wirtschaftsleben zunächst noch
eine Zeitlang unter der Herrschaft des wirtschaftlichen
Liberalismus stand, so finden wir doch sonst schon
überall, und bald auch hier, eine zunehmende Betonung
des nationalen Momentes, die Entwickelung eines starken
Nationalgefühls, und damit auch wieder eine wachsende
Schätzung des Heimatlichen, des Nationalen und Lokalen
in Literatur, Musik und Kunst. Es tritt nicht nur das
Schlagwort, sondern auch eine starke Bewegung für »Hei-
matkunst« auf. Heimatkunst aber führt mit Notwendigkeit
zur »Volkskunst« zurück, das heißt, wie Professor Seyffert
treffend definiert: naive kunstgewerbliche Betätigung,
die nicht die Eigenart des Einzelnen, sondern die Eigenart
einer örtlichen Überlieferung pflegt«. Gesunderhaltung
der Kultur durch Bewahrung ihrer heimischen und tradi-
tionellen Grundlage, das wird jetzt das Ziel, dem man zu-
strebt. Aber wir beschränken uns schon seit einiger Zeit
nicht mehr darauf, die noch vorhandenen Reste der Volks-
kunst in Museen und auf dem Lande zu sammeln und zu
erhalten, sondern wir finden auch einerseits Versuche einer
Förderung und Wiederbelebung der Volkskunst zu weiterer
lebensfähiger Anwendung und andererseits bereits eine
starke Beeinflussung des modernen Kunstgewerbes durch
sie. In beidem kommt die große wirtschaftliche Bedeutung
der Volkskunst, ihre Bedeutung für die heutige Volkswirt-
schaft, zum Ausdruck, und nicht ihre nationale, ethische
und ästhetische Seite sollen hier behandelt werden, sondern
diese wirtschaftliche. Sie ist auch hier Fundament und
Voraussetzung für die aus allgemeinen nationalen, ethi-
schen oder ästhetischen Motiven auf diesem Gebiet unter-
nommenen Bestrebungen. Denn diese können in der mo-
dernen Volkswirtschaft nur dann und insoweit lebensfähig
werden, als sie, wenn nicht geradezu durch wirtschaftliche
Bedürfnisse hervorgerufen, doch gleichzeitig auch solchen
entsprechen und mit den Verhältnissen und Gesetzen des
wirtschaftlichen Lebens nicht in Widerspruch geraten.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Volkskunst ist aller-
dings zweifellos in früheren Zeiten viel größer gewesen
als heute: in jener Zeit, »als Adam grub und Eva spann«,
als sie nicht sowohl Volkskunst als \oWsgewerbe war.
Denn beides war früher ungetrennt; die große Kluft, welche
sie heute scheidet, hat erst die spätere wirtschaftliche Ent-
wickelung, namentlich der Fabrikindustrie, aufgerissen. Die
Volkskunst beruht nämlich überall geschichtlich auf dem
»Hausßeiß*, der ältesten gewerblichen Betriebsform in der
»geschlossenen Hauswirtschaft*, — als in jeder Wirtschaft des
einzelnen Grundherrn oder Bauern noch regelmäßig alles
erzeugt wurde, was für die Befriedigung der Bedürfnisse
notwendig war, nicht nur die Produkte der Landwirtschaft,
sondern auch die gewerblichen Arbeiten des täglichen
Lebens: als der Bauer mit seinen Söhnen oder die Knechte
auf dem grundherrlichen Hof noch selbst die Gebäude
zimmerten und den Hausrat schufen, mit denen sie gefüllt
wurden, die Frauen und Töchter oder Mägde das Leinen
spannen und webten und die Kleider und Stickereien ver-'
fertigten. Daß dabei auch alles dem täglichen Leben die-
1) Vortrag gehalten auf der Versammlung für Volks-
kunde und Volkskunst Dresden 1906.
nende Geräte, Kleidung usw. reich mit Farben und Zierat
ausgestattet wurde, entsprach nur dem ursprünglichen
naiven Schmucktrieb, wie er noch früher im Schmuck des
Körpers seinen Ausdruck gefunden hatte. So werden nicht
nur jeder Kasten, jede Schachtel, die Bettstätten und
Schränke mit verschiedenen Hölzern eingelegt oder, wo
es daran fehlt, bemalt, sondern auch der einfache Markt-
korb; so werden nicht nur Stühle und Schränke, sondern
auch die Mangel geschnitzt, und es entstehen all die Hun-
derte von entzückenden kleinen und großen Geräten, die
heute unsere Sammlungen von Volkskunst aufweisen, und
in denen sich an den Gebrauchsgegenständen des täglichen
Lebens überall ein starkes künstlerisches Gefühl betätigt.
Es bedeutet dabei diese Ausschmückung von Anfang
an durchaus keinen Gegensatz zur Zweckmäßigkeit und
Brauchbarkeit der Gegenstände — und hierin liegt, um das
gleich hervorzuheben, ein Hauptmoment der Berührung
zwischen der Volkskunst und dem modernen Kunst-
gewerbe.
Mit dem Aufkommen der Städte und der »Stadtwirt-
schaft« tritt die geschlossene Hauswirtschaft auf das Land
zurück und damit wird die Volkskunst wesentlich zur
Bauernkunst, als die sie uns noch heute überall begegnet.
Aber auch auf dem Lande selbst ist es zu einer Arbeits-
teilung gekommen: ein großer Teil der gewerblichen
Erzeugnisse wird nicht mehr in der einzelnen Bauern-
wirtschaft oder Grundherrschaft selbst hergestellt, sondern
— zuerst bei den Erzeugnissen der Schmiedekunst — von
einem ländlichen Handwerker. Und so wird ein großer
Teil dessen, was wir heute Volkskunst nennen, »Landhand-
werk«. Dieses aber verfällt mit dem Aufkommen der In-
dustrie, wenn auch in geringerem Maße und langsamer
als das städtische, der Bedrängung und Verdrängung durch
die billigeren Erzeugnisse des Fabrikbetriebes. Auf der
anderen Seite wird, was noch in den bäuerlichen Wirt-
schaften an gewerblichen Erzeugnissen hergestellt wird,
nun aber auch über den eigenen Bedarf hinaus für den
Absatz erzeugt und damit zur ländlichen »Hausindustrie«.
Diese aber gerät in der Regel in Abhängigkeit von einem
kaufmännischen städtischen Kapitalisten, der bald auch
Form und Qualität des Erzeugnisses vorschreibt, und hört
damit auf, Volkskunst zu sein. Denn nur in seltenen Fällen
— wie lange Zeit bei der Uhrenindustrie des Schwarz-
waldes mit ihren »Glasträgern» — findet sie einen Ver-
mittler für den Absatz in ihren eigenen Reihen in einem
nicht kapitalistisch überlegenen Händler.
So wird das Anwendungsgebiet der Volkskunst mit
der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwickelung ein
immer kleineres, und ist in der modernen Volkswirtschaft
im Verhältnis zu früher ein sehr geringes. Aber es wäre
doch irrig, anzunehmen, daß die Volkskunst heute nur
noch ein historisches und antiquarisches Interesse besitzt,
und daß es sich nur darum handelt, ihre letzten Reste
sorgsam in Museen aufzubewahren. Sie hat vielmehr auch
in der modernen Volkswirtschaft immer noch eine große
allgemeine Bedeutung. Diese besteht zunächst in der Aus-
bildung der Handfertigkeit, der Schulung des Auges und
der Hand, der Gewöhnung an gelernte, qualifizierte Arbeit,
sowie in der Ausfüllung der freien arbeitslosen Zeit, vor
allem der ländlichen Bevölkerung in den langen Monaten
des Winters. Soweit sie noch immer nur für den Eigen-
bedarf schafft, bedeutet sie die Ersparung von baren Geld-
ausgaben, für den Landwirt vor der Ernte bekanntlich eine
überaus wichtige Sache, und zugleich, auch soweit länd-
liches Handwerk sie in den alten Formen und Qualitäten
3*
VOLKSKUNST UND VOLKSWIRTSCHAFT1)
Von Prof Dr. Carl Johannes Fuchs-Freiburg i. B.
Unsere nationale Einigung, die Gründung des
Deutschen Reiches, hat wie ein fruchtbarer Frühlings-
regen auf alle Gebiete der deutschen Kultur gewirkt:
wenn auch das deutsche Wirtschaftsleben zunächst noch
eine Zeitlang unter der Herrschaft des wirtschaftlichen
Liberalismus stand, so finden wir doch sonst schon
überall, und bald auch hier, eine zunehmende Betonung
des nationalen Momentes, die Entwickelung eines starken
Nationalgefühls, und damit auch wieder eine wachsende
Schätzung des Heimatlichen, des Nationalen und Lokalen
in Literatur, Musik und Kunst. Es tritt nicht nur das
Schlagwort, sondern auch eine starke Bewegung für »Hei-
matkunst« auf. Heimatkunst aber führt mit Notwendigkeit
zur »Volkskunst« zurück, das heißt, wie Professor Seyffert
treffend definiert: naive kunstgewerbliche Betätigung,
die nicht die Eigenart des Einzelnen, sondern die Eigenart
einer örtlichen Überlieferung pflegt«. Gesunderhaltung
der Kultur durch Bewahrung ihrer heimischen und tradi-
tionellen Grundlage, das wird jetzt das Ziel, dem man zu-
strebt. Aber wir beschränken uns schon seit einiger Zeit
nicht mehr darauf, die noch vorhandenen Reste der Volks-
kunst in Museen und auf dem Lande zu sammeln und zu
erhalten, sondern wir finden auch einerseits Versuche einer
Förderung und Wiederbelebung der Volkskunst zu weiterer
lebensfähiger Anwendung und andererseits bereits eine
starke Beeinflussung des modernen Kunstgewerbes durch
sie. In beidem kommt die große wirtschaftliche Bedeutung
der Volkskunst, ihre Bedeutung für die heutige Volkswirt-
schaft, zum Ausdruck, und nicht ihre nationale, ethische
und ästhetische Seite sollen hier behandelt werden, sondern
diese wirtschaftliche. Sie ist auch hier Fundament und
Voraussetzung für die aus allgemeinen nationalen, ethi-
schen oder ästhetischen Motiven auf diesem Gebiet unter-
nommenen Bestrebungen. Denn diese können in der mo-
dernen Volkswirtschaft nur dann und insoweit lebensfähig
werden, als sie, wenn nicht geradezu durch wirtschaftliche
Bedürfnisse hervorgerufen, doch gleichzeitig auch solchen
entsprechen und mit den Verhältnissen und Gesetzen des
wirtschaftlichen Lebens nicht in Widerspruch geraten.
Die wirtschaftliche Bedeutung der Volkskunst ist aller-
dings zweifellos in früheren Zeiten viel größer gewesen
als heute: in jener Zeit, »als Adam grub und Eva spann«,
als sie nicht sowohl Volkskunst als \oWsgewerbe war.
Denn beides war früher ungetrennt; die große Kluft, welche
sie heute scheidet, hat erst die spätere wirtschaftliche Ent-
wickelung, namentlich der Fabrikindustrie, aufgerissen. Die
Volkskunst beruht nämlich überall geschichtlich auf dem
»Hausßeiß*, der ältesten gewerblichen Betriebsform in der
»geschlossenen Hauswirtschaft*, — als in jeder Wirtschaft des
einzelnen Grundherrn oder Bauern noch regelmäßig alles
erzeugt wurde, was für die Befriedigung der Bedürfnisse
notwendig war, nicht nur die Produkte der Landwirtschaft,
sondern auch die gewerblichen Arbeiten des täglichen
Lebens: als der Bauer mit seinen Söhnen oder die Knechte
auf dem grundherrlichen Hof noch selbst die Gebäude
zimmerten und den Hausrat schufen, mit denen sie gefüllt
wurden, die Frauen und Töchter oder Mägde das Leinen
spannen und webten und die Kleider und Stickereien ver-'
fertigten. Daß dabei auch alles dem täglichen Leben die-
1) Vortrag gehalten auf der Versammlung für Volks-
kunde und Volkskunst Dresden 1906.
nende Geräte, Kleidung usw. reich mit Farben und Zierat
ausgestattet wurde, entsprach nur dem ursprünglichen
naiven Schmucktrieb, wie er noch früher im Schmuck des
Körpers seinen Ausdruck gefunden hatte. So werden nicht
nur jeder Kasten, jede Schachtel, die Bettstätten und
Schränke mit verschiedenen Hölzern eingelegt oder, wo
es daran fehlt, bemalt, sondern auch der einfache Markt-
korb; so werden nicht nur Stühle und Schränke, sondern
auch die Mangel geschnitzt, und es entstehen all die Hun-
derte von entzückenden kleinen und großen Geräten, die
heute unsere Sammlungen von Volkskunst aufweisen, und
in denen sich an den Gebrauchsgegenständen des täglichen
Lebens überall ein starkes künstlerisches Gefühl betätigt.
Es bedeutet dabei diese Ausschmückung von Anfang
an durchaus keinen Gegensatz zur Zweckmäßigkeit und
Brauchbarkeit der Gegenstände — und hierin liegt, um das
gleich hervorzuheben, ein Hauptmoment der Berührung
zwischen der Volkskunst und dem modernen Kunst-
gewerbe.
Mit dem Aufkommen der Städte und der »Stadtwirt-
schaft« tritt die geschlossene Hauswirtschaft auf das Land
zurück und damit wird die Volkskunst wesentlich zur
Bauernkunst, als die sie uns noch heute überall begegnet.
Aber auch auf dem Lande selbst ist es zu einer Arbeits-
teilung gekommen: ein großer Teil der gewerblichen
Erzeugnisse wird nicht mehr in der einzelnen Bauern-
wirtschaft oder Grundherrschaft selbst hergestellt, sondern
— zuerst bei den Erzeugnissen der Schmiedekunst — von
einem ländlichen Handwerker. Und so wird ein großer
Teil dessen, was wir heute Volkskunst nennen, »Landhand-
werk«. Dieses aber verfällt mit dem Aufkommen der In-
dustrie, wenn auch in geringerem Maße und langsamer
als das städtische, der Bedrängung und Verdrängung durch
die billigeren Erzeugnisse des Fabrikbetriebes. Auf der
anderen Seite wird, was noch in den bäuerlichen Wirt-
schaften an gewerblichen Erzeugnissen hergestellt wird,
nun aber auch über den eigenen Bedarf hinaus für den
Absatz erzeugt und damit zur ländlichen »Hausindustrie«.
Diese aber gerät in der Regel in Abhängigkeit von einem
kaufmännischen städtischen Kapitalisten, der bald auch
Form und Qualität des Erzeugnisses vorschreibt, und hört
damit auf, Volkskunst zu sein. Denn nur in seltenen Fällen
— wie lange Zeit bei der Uhrenindustrie des Schwarz-
waldes mit ihren »Glasträgern» — findet sie einen Ver-
mittler für den Absatz in ihren eigenen Reihen in einem
nicht kapitalistisch überlegenen Händler.
So wird das Anwendungsgebiet der Volkskunst mit
der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwickelung ein
immer kleineres, und ist in der modernen Volkswirtschaft
im Verhältnis zu früher ein sehr geringes. Aber es wäre
doch irrig, anzunehmen, daß die Volkskunst heute nur
noch ein historisches und antiquarisches Interesse besitzt,
und daß es sich nur darum handelt, ihre letzten Reste
sorgsam in Museen aufzubewahren. Sie hat vielmehr auch
in der modernen Volkswirtschaft immer noch eine große
allgemeine Bedeutung. Diese besteht zunächst in der Aus-
bildung der Handfertigkeit, der Schulung des Auges und
der Hand, der Gewöhnung an gelernte, qualifizierte Arbeit,
sowie in der Ausfüllung der freien arbeitslosen Zeit, vor
allem der ländlichen Bevölkerung in den langen Monaten
des Winters. Soweit sie noch immer nur für den Eigen-
bedarf schafft, bedeutet sie die Ersparung von baren Geld-
ausgaben, für den Landwirt vor der Ernte bekanntlich eine
überaus wichtige Sache, und zugleich, auch soweit länd-
liches Handwerk sie in den alten Formen und Qualitäten
3*