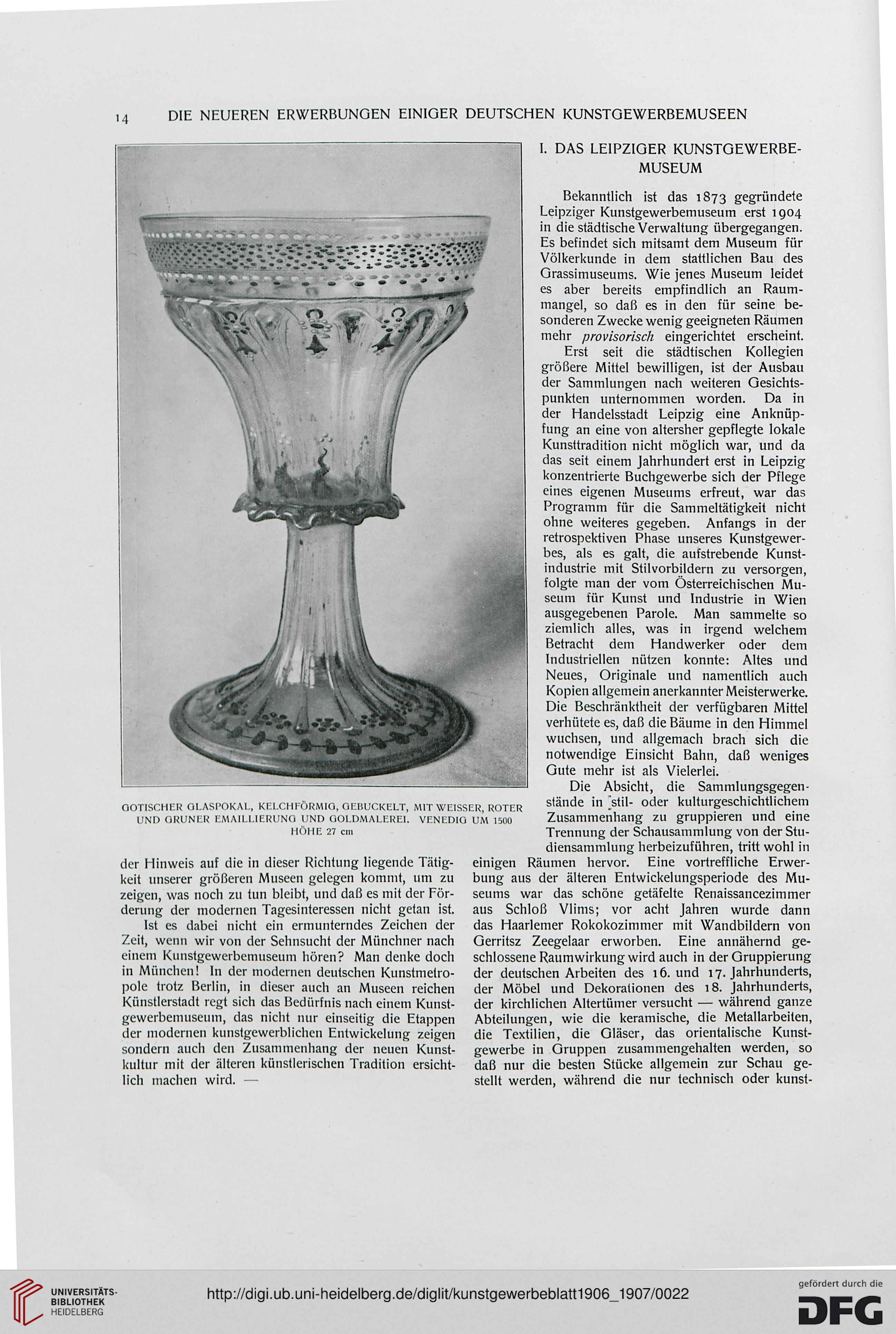14
DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEMUSEEN
GOTISCHER GLASI'OKAL, KELCHLORM1G, GEBUCKELT, MIT WEISSER, ROTER
UND ORUNER EMAILLIERUNO UND GOLDMALEREI. VENEDIG UM 1500
HÖHE 27 cm
der Hinweis auf die in dieser Richtung liegende Tätig-
keit unserer größeren Museen gelegen kommt, um zu
zeigen, was noch zu tun bleibt, und daß es mit der För-
derung der modernen Tagesinteressen nicht getan ist.
Ist es dabei nicht ein ermunterndes Zeichen der
Zeit, wenn wir von der Sehnsucht der Münchner nach
einem Kunstgewerbemuseum hören? Man denke doch
in München! In der modernen deutschen Kunstmetro-
pole trotz Berlin, in dieser auch an Museen reichen
Künstlerstadt regt sich das Bedürfnis nach einem Kunst-
gewerbemuseum, das nicht nur einseitig die Etappen
der modernen kunstgewerblichen Entwickelimg zeigen
sondern auch den Zusammenhang der neuen Kunst-
kultur mit der älteren künstlerischen Tradition ersicht-
lich machen wird. —
I. DAS LEIPZIGER KUNSTGEWERBE-
MUSEUM
Bekanntlich ist das 1873 gegründete
Leipziger Kunstgewerbemuseum erst 1904
in die städtische Verwaltung übergegangen.
Es befindet sich mitsamt dem Museum für
Völkerkunde in dem stattlichen Bau des
Grassimuseums. Wie jenes Museum leidet
es aber bereits empfindlich an Raum-
mangel, so daß es in den für seine be-
sonderen Zwecke wenig geeigneten Räumen
mehr provisorisch eingerichtet erscheint.
Erst seit die städtischen Kollegien
größere Mittel bewilligen, ist der Ausbau
der Sammlungen nach weiteren Gesichts-
punkten unternommen worden. Da in
der Handelsstadt Leipzig eine Anknüp-
fung an eine von altersher gepflegte lokale
Kunsttradition nicht möglich war, und da
das seit einem Jahrhundert erst in Leipzig
konzentrierte Buchgewerbe sich der Pflege
eines eigenen Museums erfreut, war das
Programm für die Sammeltätigkeit nicht
ohne weiteres gegeben. Anfangs in der
retrospektiven Phase unseres Kunstgewer-
bes, als es galt, die aufstrebende Kunst-
industrie mit Stilvorbildern zu versorgen,
folgte man der vom Österreichischen Mu-
seum für Kunst und Industrie in Wien
ausgegebenen Parole. Man sammelte so
ziemlich alles, was in irgend welchem
Betracht dem Handwerker oder dem
Industriellen nützen konnte: Altes und
Neues, Originale und namentlich auch
Kopien allgemein anerkannter Meisterwerke.
Die Beschränktheit der verfügbaren Mittel
verhütete es, daß die Bäume in den Himmel
wuchsen, und allgemach brach sich die
notwendige Einsicht Bahn, daß weniges
Gute mehr ist als Vielerlei.
Die Absicht, die Sammlungsgegen-
stände in ~stil- oder kulturgeschichtlichem
Zusammenhang zu gruppieren und eine
Trennung der Schausammlung von der Stu-
diensammlung herbeizuführen, tritt wohl in
einigen Räumen hervor. Eine vortreffliche Erwer-
bung aus der älteren Entwickelungsperiode des Mu-
seums war das schöne getäfelte Renaissancezimmer
aus Schloß Vlims; vor acht Jahren wurde dann
das Haarlemer Rokokozimmer mit Wandbildern von
Gerritsz Zeegelaar erworben. Eine annähernd ge-
schlossene Raumwirkung wird auch in der Gruppierung
der deutschen Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts,
der Möbel und Dekorationen des 18. Jahrhunderts,
der kirchlichen Altertümer versucht — während ganze
Abteilungen, wie die keramische, die Metallarbeiten,
die Textilien, die Gläser, das orientalische Kunst-
gewerbe in Gruppen zusammengehalten werden, so
daß nur die besten Stücke allgemein zur Schau ge-
stellt werden, während die nur technisch oder kunst-
DIE NEUEREN ERWERBUNGEN EINIGER DEUTSCHEN KUNSTGEWERBEMUSEEN
GOTISCHER GLASI'OKAL, KELCHLORM1G, GEBUCKELT, MIT WEISSER, ROTER
UND ORUNER EMAILLIERUNO UND GOLDMALEREI. VENEDIG UM 1500
HÖHE 27 cm
der Hinweis auf die in dieser Richtung liegende Tätig-
keit unserer größeren Museen gelegen kommt, um zu
zeigen, was noch zu tun bleibt, und daß es mit der För-
derung der modernen Tagesinteressen nicht getan ist.
Ist es dabei nicht ein ermunterndes Zeichen der
Zeit, wenn wir von der Sehnsucht der Münchner nach
einem Kunstgewerbemuseum hören? Man denke doch
in München! In der modernen deutschen Kunstmetro-
pole trotz Berlin, in dieser auch an Museen reichen
Künstlerstadt regt sich das Bedürfnis nach einem Kunst-
gewerbemuseum, das nicht nur einseitig die Etappen
der modernen kunstgewerblichen Entwickelimg zeigen
sondern auch den Zusammenhang der neuen Kunst-
kultur mit der älteren künstlerischen Tradition ersicht-
lich machen wird. —
I. DAS LEIPZIGER KUNSTGEWERBE-
MUSEUM
Bekanntlich ist das 1873 gegründete
Leipziger Kunstgewerbemuseum erst 1904
in die städtische Verwaltung übergegangen.
Es befindet sich mitsamt dem Museum für
Völkerkunde in dem stattlichen Bau des
Grassimuseums. Wie jenes Museum leidet
es aber bereits empfindlich an Raum-
mangel, so daß es in den für seine be-
sonderen Zwecke wenig geeigneten Räumen
mehr provisorisch eingerichtet erscheint.
Erst seit die städtischen Kollegien
größere Mittel bewilligen, ist der Ausbau
der Sammlungen nach weiteren Gesichts-
punkten unternommen worden. Da in
der Handelsstadt Leipzig eine Anknüp-
fung an eine von altersher gepflegte lokale
Kunsttradition nicht möglich war, und da
das seit einem Jahrhundert erst in Leipzig
konzentrierte Buchgewerbe sich der Pflege
eines eigenen Museums erfreut, war das
Programm für die Sammeltätigkeit nicht
ohne weiteres gegeben. Anfangs in der
retrospektiven Phase unseres Kunstgewer-
bes, als es galt, die aufstrebende Kunst-
industrie mit Stilvorbildern zu versorgen,
folgte man der vom Österreichischen Mu-
seum für Kunst und Industrie in Wien
ausgegebenen Parole. Man sammelte so
ziemlich alles, was in irgend welchem
Betracht dem Handwerker oder dem
Industriellen nützen konnte: Altes und
Neues, Originale und namentlich auch
Kopien allgemein anerkannter Meisterwerke.
Die Beschränktheit der verfügbaren Mittel
verhütete es, daß die Bäume in den Himmel
wuchsen, und allgemach brach sich die
notwendige Einsicht Bahn, daß weniges
Gute mehr ist als Vielerlei.
Die Absicht, die Sammlungsgegen-
stände in ~stil- oder kulturgeschichtlichem
Zusammenhang zu gruppieren und eine
Trennung der Schausammlung von der Stu-
diensammlung herbeizuführen, tritt wohl in
einigen Räumen hervor. Eine vortreffliche Erwer-
bung aus der älteren Entwickelungsperiode des Mu-
seums war das schöne getäfelte Renaissancezimmer
aus Schloß Vlims; vor acht Jahren wurde dann
das Haarlemer Rokokozimmer mit Wandbildern von
Gerritsz Zeegelaar erworben. Eine annähernd ge-
schlossene Raumwirkung wird auch in der Gruppierung
der deutschen Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts,
der Möbel und Dekorationen des 18. Jahrhunderts,
der kirchlichen Altertümer versucht — während ganze
Abteilungen, wie die keramische, die Metallarbeiten,
die Textilien, die Gläser, das orientalische Kunst-
gewerbe in Gruppen zusammengehalten werden, so
daß nur die besten Stücke allgemein zur Schau ge-
stellt werden, während die nur technisch oder kunst-