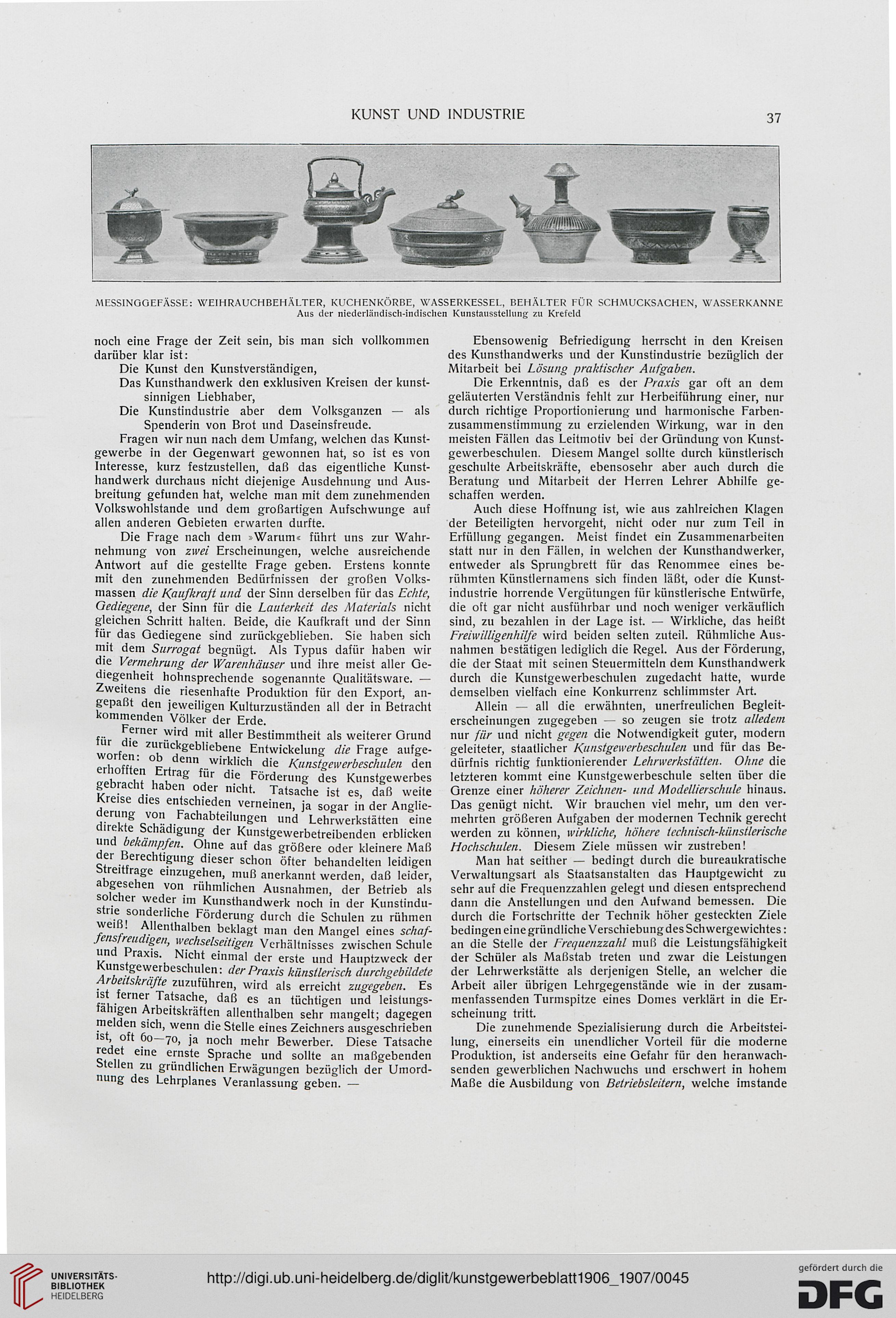KUNST UND INDUSTRIE
37
MESS1NG0EFÄSSE: WEIHRAUCHBEHÄLTER, KUCHENKÖRBE, WASSERKESSEL, BEHÄLTER FÜR SCHAWCKSACHEN, WASSERKANNE
Aus der niederländisch-indischen Kunstausstellung zu Krefeld
noch eine Frage der Zeit sein, bis man sich vollkommen
darüber klar ist:
Die Kunst den Kunstverständigen,
Das Kunsthandwerk den exklusiven Kreisen der kunst-
sinnigen Liebhaber,
Die Kunstindustrie aber dem Volksganzen — als
Spenderin von Brot und Daseinsfreude.
Fragen wir nun nach dem Umfang, welchen das Kunst-
gewerbe in der Gegenwart gewonnen hat, so ist es von
Interesse, kurz festzustellen, daß das eigentliche Kunst-
handwerk durchaus nicht diejenige Ausdehnung und Aus-
breitung gefunden hat, welche man mit dem zunehmenden
Volkswohlstande und dem großartigen Aufschwünge auf
allen anderen Gebieten erwarten durfte.
Die Frage nach dem »Warum« führt uns zur Wahr-
nehmung von zwei Erscheinungen, welche ausreichende
Antwort auf die gestellte Frage geben. Erstens konnte
mit den zunehmenden Bedürfnissen der großen Volks-
massen die Kaufkraft und der Sinn derselben für das Echte,
Gediegene, der Sinn für die Lauterkeit des Materials nicht
gleichen Schritt halten. Beide, die Kaufkraft und der Sinn
für das Gediegene sind zurückgeblieben. Sie haben sich
mit dem Surrogat begnügt. Als Typus dafür haben wir
die Vermehrung der Warenhäuser und ihre meist aller Ge-
diegenheit hohnsprechende sogenannte Qualitätsware. —
Zweitens die riesenhafte Produktion für den Export, an-
gepaßt den jeweiligen Kulturzuständen all der in Betracht
kommenden Völker der Erde.
Ferner wird mit aller Bestimmtheit als weiterer Grund
!!I f zu,ruckgebliebene Entwickelung die Frage aufge-
«wh: r, " Wirklich die Kunstgewerbeschulen den
erhofften Ertrag für die Förderung des Kunstgewerbes
gebracht haben oder nicht. Tatsache ist es, daß weite
Kre.se dies entschieden verneinen, ja sogar in der Anglie-
derung von Fachabteilungen und Lehrwerkstätten eine
direkte Schädigung der Kunstgewerbetreibenden erblicken
und bekämpfen. Ohne auf das größere oder kleinere Maß
der Berechtigung dieser schon öfter behandelten leidigen
btreittrage einzugehen, muß anerkannt werden, daß leider,
abgesehen von rühmlichen Ausnahmen, der Betrieb als
solcher weder im Kunsthandwerk noch in der Kunstindu-
stne sonderliche Förderung durch die Schulen zu rühmen
weiß. Allenthalben beklagt man den Mangel eines schaf-
jens/reudigen, wechselseitigen Verhältnisses zwischen Schule
und 1 raxis. Nicht einmal der erste und Hauptzweck der
Kunstgewerbeschulen: der Praxis künstlerisch durchgebildete
Arbeitskräfte zuzuführen, wird als erreicht zugegeben. Es
ist ferner Tatsache, daß es an tüchtigen und leistungs-
fähigen Arbeitskräften allenthalben sehr mangelt; dagegen
melden sich, wenn die Stelle eines Zeichners ausgeschrieben
ist oft 60-70, ja noch mehr Bewerber. Diese Tatsache
redet eine ernste Sprache und sollte an maßgebenden
Stellen zu gründlichen Erwägungen bezüglich der Umord-
nung des Lehrplanes Veranlassung geben. —
Ebensowenig Befriedigung herrscht in den Kreisen
des Kunsthandwerks und der Kunstindustrie bezüglich der
Mitarbeit bei Lösung praktischer Aufgaben.
Die Erkenntnis, daß es der Praxis gar oft an dem
geläuterten Verständnis fehlt zur Herbeiführung einer, nur
durch richtige Proportionierung und harmonische Farben-
zusammenstimmung zu erzielenden Wirkung, war in den
meisten Fällen das Leitmotiv bei der Gründung von Kunst-
gewerbeschulen. Diesem Mangel sollte durch künstlerisch
geschulte Arbeitskräfte, ebensosehr aber auch durch die
Beratung und Mitarbeit der Herren Lehrer Abhilfe ge-
schaffen werden.
Auch diese Hoffnung ist, wie aus zahlreichen Klagen
der Beteiligten hervorgeht, nicht oder nur zum Teil in
Erfüllung gegangen. Meist findet ein Zusammenarbeiten
statt nur in den Fällen, in welchen der Kunsthandwerker,
entweder als Sprungbrett für das Renommee eines be-
rühmten Künstlernamens sich finden läßt, oder die Kunst-
industrie horrende Vergütungen für künstlerische Entwürfe,
die oft gar nicht ausführbar und noch weniger verkäuflich
sind, zu bezahlen in der Lage ist. — Wirkliche, das heißt
Freiwilligenhilfe wird beiden selten zuteil. Rühmliche Aus-
nahmen bestätigen lediglich die Regel. Aus der Förderung,
die der Staat mit seinen Steuermitteln dem Kunsthandwerk
durch die Kunstgewerbeschulen zugedacht hatte, wurde
demselben vielfach eine Konkurrenz schlimmster Art.
Allein — all die erwähnten, unerfreulichen Begleit-
erscheinungen zugegeben — so zeugen sie trotz alledem
nur für und nicht gegen die Notwendigkeit guter, modern
geleiteter, staatlicher Kunstgewerbeschulen und für das Be-
dürfnis richtig funktionierender Lehrwerkstätten. Ohne die
letzteren kommt eine Kunstgewerbeschule selten über die
Grenze einer höherer Zeichnen- und Modellierschule hinaus.
Das genügt nicht. Wir brauchen viel mehr, um den ver-
mehrten größeren Aufgaben der modernen Technik gerecht
werden zu können, wirkliche, höhere technisch-künstlerische
Hochschulen. Diesem Ziele müssen wir zustreben!
Man hat seither — bedingt durch die bureaukratische
Verwaltungsart als Staatsanstalten das Hauptgewicht zu
sehr auf die Frequenzzahlen gelegt und diesen entsprechend
dann die Anstellungen und den Aufwand bemessen. Die
durch die Fortschritte der Technik höher gesteckten Ziele
bedingen eine gründliche Verschiebung des Schwergewichtes:
an die Stelle der I'requenzzahl muß die Leistungsfähigkeit
der Schüler als Maßstab treten und zwar die Leistungen
der Lehrwerkstätte als derjenigen Stelle, an welcher die
Arbeit ailer übrigen Lehrgegenstände wie in der zusam-
menfassenden Turmspitze eines Domes verklärt in die Er-
scheinung tritt.
Die zunehmende Spezialisierung durch die Arbeitstei-
lung, einerseits ein unendlicher Vorteil für die moderne
Produktion, ist anderseits eine Gefahr für den heranwach-
senden gewerblichen Nachwuchs und erschwert in hohem
Maße die Ausbildung von Betriebsleitern, welche imstande
37
MESS1NG0EFÄSSE: WEIHRAUCHBEHÄLTER, KUCHENKÖRBE, WASSERKESSEL, BEHÄLTER FÜR SCHAWCKSACHEN, WASSERKANNE
Aus der niederländisch-indischen Kunstausstellung zu Krefeld
noch eine Frage der Zeit sein, bis man sich vollkommen
darüber klar ist:
Die Kunst den Kunstverständigen,
Das Kunsthandwerk den exklusiven Kreisen der kunst-
sinnigen Liebhaber,
Die Kunstindustrie aber dem Volksganzen — als
Spenderin von Brot und Daseinsfreude.
Fragen wir nun nach dem Umfang, welchen das Kunst-
gewerbe in der Gegenwart gewonnen hat, so ist es von
Interesse, kurz festzustellen, daß das eigentliche Kunst-
handwerk durchaus nicht diejenige Ausdehnung und Aus-
breitung gefunden hat, welche man mit dem zunehmenden
Volkswohlstande und dem großartigen Aufschwünge auf
allen anderen Gebieten erwarten durfte.
Die Frage nach dem »Warum« führt uns zur Wahr-
nehmung von zwei Erscheinungen, welche ausreichende
Antwort auf die gestellte Frage geben. Erstens konnte
mit den zunehmenden Bedürfnissen der großen Volks-
massen die Kaufkraft und der Sinn derselben für das Echte,
Gediegene, der Sinn für die Lauterkeit des Materials nicht
gleichen Schritt halten. Beide, die Kaufkraft und der Sinn
für das Gediegene sind zurückgeblieben. Sie haben sich
mit dem Surrogat begnügt. Als Typus dafür haben wir
die Vermehrung der Warenhäuser und ihre meist aller Ge-
diegenheit hohnsprechende sogenannte Qualitätsware. —
Zweitens die riesenhafte Produktion für den Export, an-
gepaßt den jeweiligen Kulturzuständen all der in Betracht
kommenden Völker der Erde.
Ferner wird mit aller Bestimmtheit als weiterer Grund
!!I f zu,ruckgebliebene Entwickelung die Frage aufge-
«wh: r, " Wirklich die Kunstgewerbeschulen den
erhofften Ertrag für die Förderung des Kunstgewerbes
gebracht haben oder nicht. Tatsache ist es, daß weite
Kre.se dies entschieden verneinen, ja sogar in der Anglie-
derung von Fachabteilungen und Lehrwerkstätten eine
direkte Schädigung der Kunstgewerbetreibenden erblicken
und bekämpfen. Ohne auf das größere oder kleinere Maß
der Berechtigung dieser schon öfter behandelten leidigen
btreittrage einzugehen, muß anerkannt werden, daß leider,
abgesehen von rühmlichen Ausnahmen, der Betrieb als
solcher weder im Kunsthandwerk noch in der Kunstindu-
stne sonderliche Förderung durch die Schulen zu rühmen
weiß. Allenthalben beklagt man den Mangel eines schaf-
jens/reudigen, wechselseitigen Verhältnisses zwischen Schule
und 1 raxis. Nicht einmal der erste und Hauptzweck der
Kunstgewerbeschulen: der Praxis künstlerisch durchgebildete
Arbeitskräfte zuzuführen, wird als erreicht zugegeben. Es
ist ferner Tatsache, daß es an tüchtigen und leistungs-
fähigen Arbeitskräften allenthalben sehr mangelt; dagegen
melden sich, wenn die Stelle eines Zeichners ausgeschrieben
ist oft 60-70, ja noch mehr Bewerber. Diese Tatsache
redet eine ernste Sprache und sollte an maßgebenden
Stellen zu gründlichen Erwägungen bezüglich der Umord-
nung des Lehrplanes Veranlassung geben. —
Ebensowenig Befriedigung herrscht in den Kreisen
des Kunsthandwerks und der Kunstindustrie bezüglich der
Mitarbeit bei Lösung praktischer Aufgaben.
Die Erkenntnis, daß es der Praxis gar oft an dem
geläuterten Verständnis fehlt zur Herbeiführung einer, nur
durch richtige Proportionierung und harmonische Farben-
zusammenstimmung zu erzielenden Wirkung, war in den
meisten Fällen das Leitmotiv bei der Gründung von Kunst-
gewerbeschulen. Diesem Mangel sollte durch künstlerisch
geschulte Arbeitskräfte, ebensosehr aber auch durch die
Beratung und Mitarbeit der Herren Lehrer Abhilfe ge-
schaffen werden.
Auch diese Hoffnung ist, wie aus zahlreichen Klagen
der Beteiligten hervorgeht, nicht oder nur zum Teil in
Erfüllung gegangen. Meist findet ein Zusammenarbeiten
statt nur in den Fällen, in welchen der Kunsthandwerker,
entweder als Sprungbrett für das Renommee eines be-
rühmten Künstlernamens sich finden läßt, oder die Kunst-
industrie horrende Vergütungen für künstlerische Entwürfe,
die oft gar nicht ausführbar und noch weniger verkäuflich
sind, zu bezahlen in der Lage ist. — Wirkliche, das heißt
Freiwilligenhilfe wird beiden selten zuteil. Rühmliche Aus-
nahmen bestätigen lediglich die Regel. Aus der Förderung,
die der Staat mit seinen Steuermitteln dem Kunsthandwerk
durch die Kunstgewerbeschulen zugedacht hatte, wurde
demselben vielfach eine Konkurrenz schlimmster Art.
Allein — all die erwähnten, unerfreulichen Begleit-
erscheinungen zugegeben — so zeugen sie trotz alledem
nur für und nicht gegen die Notwendigkeit guter, modern
geleiteter, staatlicher Kunstgewerbeschulen und für das Be-
dürfnis richtig funktionierender Lehrwerkstätten. Ohne die
letzteren kommt eine Kunstgewerbeschule selten über die
Grenze einer höherer Zeichnen- und Modellierschule hinaus.
Das genügt nicht. Wir brauchen viel mehr, um den ver-
mehrten größeren Aufgaben der modernen Technik gerecht
werden zu können, wirkliche, höhere technisch-künstlerische
Hochschulen. Diesem Ziele müssen wir zustreben!
Man hat seither — bedingt durch die bureaukratische
Verwaltungsart als Staatsanstalten das Hauptgewicht zu
sehr auf die Frequenzzahlen gelegt und diesen entsprechend
dann die Anstellungen und den Aufwand bemessen. Die
durch die Fortschritte der Technik höher gesteckten Ziele
bedingen eine gründliche Verschiebung des Schwergewichtes:
an die Stelle der I'requenzzahl muß die Leistungsfähigkeit
der Schüler als Maßstab treten und zwar die Leistungen
der Lehrwerkstätte als derjenigen Stelle, an welcher die
Arbeit ailer übrigen Lehrgegenstände wie in der zusam-
menfassenden Turmspitze eines Domes verklärt in die Er-
scheinung tritt.
Die zunehmende Spezialisierung durch die Arbeitstei-
lung, einerseits ein unendlicher Vorteil für die moderne
Produktion, ist anderseits eine Gefahr für den heranwach-
senden gewerblichen Nachwuchs und erschwert in hohem
Maße die Ausbildung von Betriebsleitern, welche imstande