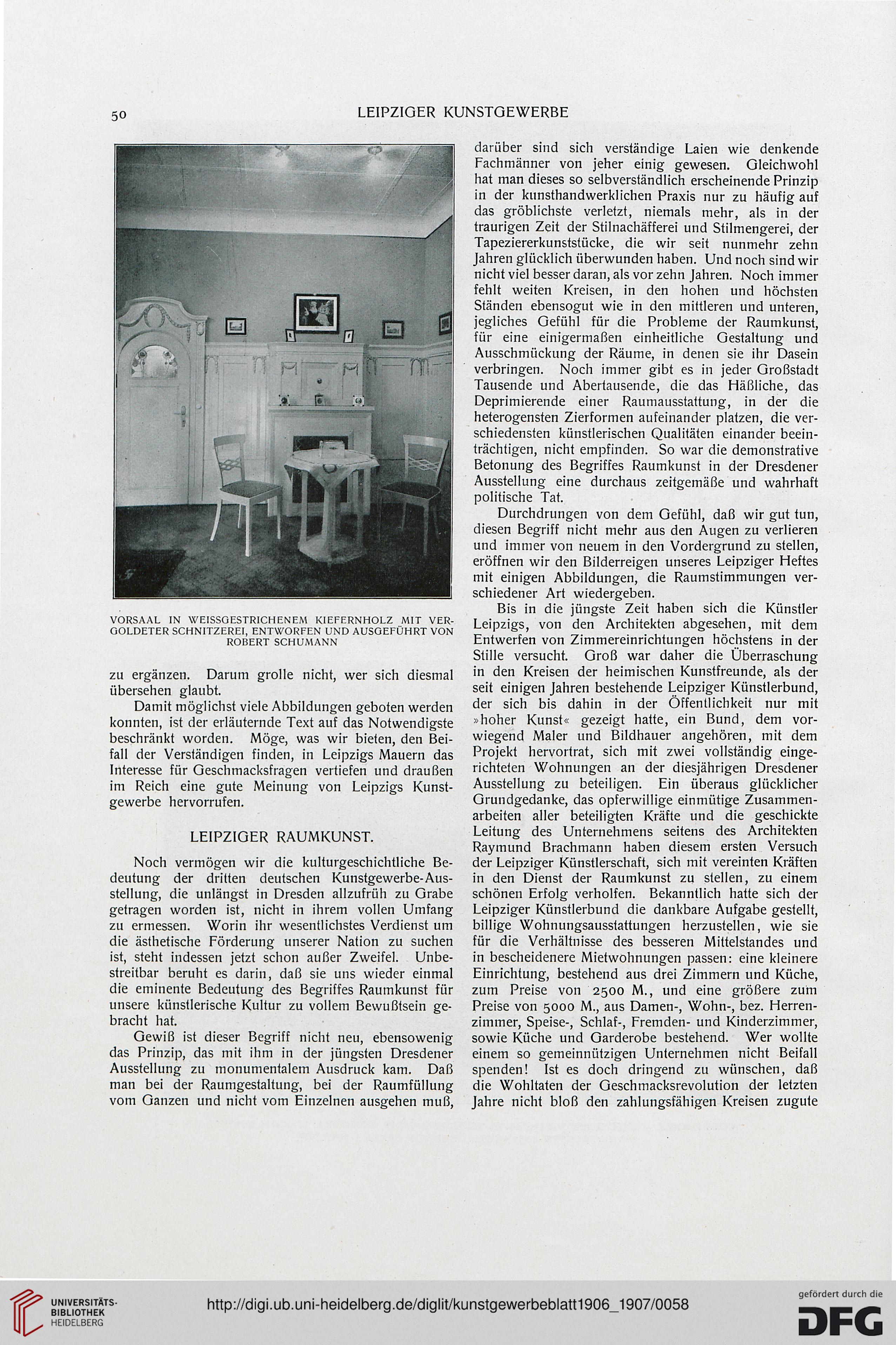50
LEIPZIGER KUNSTGEWERBE
VORSAAL IN WEISSOESTRICHENEM KIEFERNHOLZ MIT VER-
GOLDETER SCHNITZEREI, ENTWORFEN UND AUSGEFÜHRT VON
ROBERT SCHUMANN
zu ergänzen. Darum grolle nicht, wer sich diesmal
übersehen glaubt.
Damit möglichst viele Abbildungen geboten werden
konnten, ist der erläuternde Text auf das Notwendigste
beschränkt worden. Möge, was wir bieten, den Bei-
fall der Verständigen finden, in Leipzigs Mauern das
Interesse für Geschmacksfragen vertiefen und draußen
im Reich eine gute Meinung von Leipzigs Kunst-
gewerbe hervorrufen.
LEIPZIGER RAUMKUNST.
Noch vermögen wir die kulturgeschichtliche Be-
deutung der dritten deutschen Kunstgewerbe-Aus-
stellung, die unlängst in Dresden allzufrüh zu Grabe
getragen worden ist, nicht in ihrem vollen Umfang
zu ermessen. Worin ihr wesentlichstes Verdienst um
die ästhetische Förderung unserer Nation zu suchen
ist, steht indessen jetzt schon außer Zweifel. Unbe-
streitbar beruht es darin, daß sie uns wieder einmal
die eminente Bedeutung des Begriffes Raumkunst für
unsere künstlerische Kultur zu vollem Bewußtsein ge-
bracht hat.
Gewiß ist dieser Begriff nicht neu, ebensowenig
das Prinzip, das mit ihm in der jüngsten Dresdener
Ausstellung zu monumentalem Ausdruck kam. Daß
man bei der Raumgestaltung, bei der Raumfüllung
vom Ganzen und nicht vom Einzelnen ausgehen muß,
darüber sind sich verständige Laien wie denkende
Fachmänner von jeher einig gewesen. Gleichwohl
hat man dieses so selbverständlich erscheinende Prinzip
in der kunsthandwerklichen Praxis nur zu häufig auf
das gröblichste verletzt, niemals mehr, als in der
traurigen Zeit der Stilnachäfferei und Stilmengerei, der
Tapeziererkunststücke, die wir seit nunmehr zehn
Jahren glücklich überwunden haben. Und noch sind wir
nicht viel besser daran, als vor zehn Jahren. Noch immer
fehlt weiten Kreisen, in den hohen und höchsten
Ständen ebensogut wie in den mittleren und unteren,
jegliches Gefühl für die Probleme der Raumkunst,
für eine einigermaßen einheitliche Gestaltung und
Ausschmückung der Räume, in denen sie ihr Dasein
verbringen. Noch immer gibt es in jeder Großstadt
Tausende und Abertausende, die das Häßliche, das
Deprimierende einer Raumausstattung, in der die
heterogensten Zierformen aufeinander platzen, die ver-
schiedensten künstlerischen Qualitäten einander beein-
trächtigen, nicht empfinden. So war die demonstrative
Betonung des Begriffes Raumkunst in der Dresdener
Ausstellung eine durchaus zeitgemäße und wahrhaft
politische Tat.
Durchdrungen von dem Gefühl, daß wir gut tun,
diesen Begriff nicht mehr aus den Augen zu verlieren
und immer von neuem in den Vordergrund zu stellen,
eröffnen wir den Bilderreigen unseres Leipziger Heftes
mit einigen Abbildungen, die Raumstimmungen ver-
schiedener Art wiedergeben.
Bis in die jüngste Zeit haben sich die Künstler
Leipzigs, von den Architekten abgesehen, mit dem
Entwerfen von Zimmereinrichtungen höchstens in der
Stille versucht. Groß war daher die Überraschung
in den Kreisen der heimischen Kunstfreunde, als der
seit einigen Jahren bestehende Leipziger Künstlerbund,
der sich bis dahin in der Öffentlichkeit nur mit
»hoher Kunst« gezeigt hatte, ein Bund, dem vor-
wiegend Maler und Bildhauer angehören, mit dem
Projekt hervortrat, sich mit zwei vollständig einge-
richteten Wohnungen an der diesjährigen Dresdener
Ausstellung zu beteiligen. Ein überaus glücklicher
Grundgedanke, das opferwillige einmütige Zusammen-
arbeiten aller beteiligten Kräfte und die geschickte
Leitung des Unternehmens seitens des Architekten
Raymund Brachmann haben diesem ersten Versuch
der Leipziger Künstlerschaft, sich mit vereinten Kräften
in den Dienst der Raumkunst zu stellen, zu einem
schönen Erfolg verholfen. Bekanntlich hatte sich der
Leipziger Künstlerbund die dankbare Aufgabe gestellt,
billige Wohnungsaussfattungen herzustellen, wie sie
für die Verhältnisse des besseren Mittelstandes und
in bescheidenere Mietwohnungen passen: eine kleinere
Einrichtung, bestehend aus drei Zimmern und Küche,
zum Preise von 2500 M., und eine größere zum
Preise von 5000 M., aus Damen-, Wohn-, bez. Herren-
zimmer, Speise-, Schlaf-, Fremden- und Kinderzimmer,
sowie Küche und Garderobe bestehend. Wer wollte
einem so gemeinnützigen Unternehmen nicht Beifall
spenden! Ist es doch dringend zu wünschen, daß
die Wohltaten der Geschmacksrevolution der letzten
Jahre nicht bloß den zahlungsfähigen Kreisen zugute
LEIPZIGER KUNSTGEWERBE
VORSAAL IN WEISSOESTRICHENEM KIEFERNHOLZ MIT VER-
GOLDETER SCHNITZEREI, ENTWORFEN UND AUSGEFÜHRT VON
ROBERT SCHUMANN
zu ergänzen. Darum grolle nicht, wer sich diesmal
übersehen glaubt.
Damit möglichst viele Abbildungen geboten werden
konnten, ist der erläuternde Text auf das Notwendigste
beschränkt worden. Möge, was wir bieten, den Bei-
fall der Verständigen finden, in Leipzigs Mauern das
Interesse für Geschmacksfragen vertiefen und draußen
im Reich eine gute Meinung von Leipzigs Kunst-
gewerbe hervorrufen.
LEIPZIGER RAUMKUNST.
Noch vermögen wir die kulturgeschichtliche Be-
deutung der dritten deutschen Kunstgewerbe-Aus-
stellung, die unlängst in Dresden allzufrüh zu Grabe
getragen worden ist, nicht in ihrem vollen Umfang
zu ermessen. Worin ihr wesentlichstes Verdienst um
die ästhetische Förderung unserer Nation zu suchen
ist, steht indessen jetzt schon außer Zweifel. Unbe-
streitbar beruht es darin, daß sie uns wieder einmal
die eminente Bedeutung des Begriffes Raumkunst für
unsere künstlerische Kultur zu vollem Bewußtsein ge-
bracht hat.
Gewiß ist dieser Begriff nicht neu, ebensowenig
das Prinzip, das mit ihm in der jüngsten Dresdener
Ausstellung zu monumentalem Ausdruck kam. Daß
man bei der Raumgestaltung, bei der Raumfüllung
vom Ganzen und nicht vom Einzelnen ausgehen muß,
darüber sind sich verständige Laien wie denkende
Fachmänner von jeher einig gewesen. Gleichwohl
hat man dieses so selbverständlich erscheinende Prinzip
in der kunsthandwerklichen Praxis nur zu häufig auf
das gröblichste verletzt, niemals mehr, als in der
traurigen Zeit der Stilnachäfferei und Stilmengerei, der
Tapeziererkunststücke, die wir seit nunmehr zehn
Jahren glücklich überwunden haben. Und noch sind wir
nicht viel besser daran, als vor zehn Jahren. Noch immer
fehlt weiten Kreisen, in den hohen und höchsten
Ständen ebensogut wie in den mittleren und unteren,
jegliches Gefühl für die Probleme der Raumkunst,
für eine einigermaßen einheitliche Gestaltung und
Ausschmückung der Räume, in denen sie ihr Dasein
verbringen. Noch immer gibt es in jeder Großstadt
Tausende und Abertausende, die das Häßliche, das
Deprimierende einer Raumausstattung, in der die
heterogensten Zierformen aufeinander platzen, die ver-
schiedensten künstlerischen Qualitäten einander beein-
trächtigen, nicht empfinden. So war die demonstrative
Betonung des Begriffes Raumkunst in der Dresdener
Ausstellung eine durchaus zeitgemäße und wahrhaft
politische Tat.
Durchdrungen von dem Gefühl, daß wir gut tun,
diesen Begriff nicht mehr aus den Augen zu verlieren
und immer von neuem in den Vordergrund zu stellen,
eröffnen wir den Bilderreigen unseres Leipziger Heftes
mit einigen Abbildungen, die Raumstimmungen ver-
schiedener Art wiedergeben.
Bis in die jüngste Zeit haben sich die Künstler
Leipzigs, von den Architekten abgesehen, mit dem
Entwerfen von Zimmereinrichtungen höchstens in der
Stille versucht. Groß war daher die Überraschung
in den Kreisen der heimischen Kunstfreunde, als der
seit einigen Jahren bestehende Leipziger Künstlerbund,
der sich bis dahin in der Öffentlichkeit nur mit
»hoher Kunst« gezeigt hatte, ein Bund, dem vor-
wiegend Maler und Bildhauer angehören, mit dem
Projekt hervortrat, sich mit zwei vollständig einge-
richteten Wohnungen an der diesjährigen Dresdener
Ausstellung zu beteiligen. Ein überaus glücklicher
Grundgedanke, das opferwillige einmütige Zusammen-
arbeiten aller beteiligten Kräfte und die geschickte
Leitung des Unternehmens seitens des Architekten
Raymund Brachmann haben diesem ersten Versuch
der Leipziger Künstlerschaft, sich mit vereinten Kräften
in den Dienst der Raumkunst zu stellen, zu einem
schönen Erfolg verholfen. Bekanntlich hatte sich der
Leipziger Künstlerbund die dankbare Aufgabe gestellt,
billige Wohnungsaussfattungen herzustellen, wie sie
für die Verhältnisse des besseren Mittelstandes und
in bescheidenere Mietwohnungen passen: eine kleinere
Einrichtung, bestehend aus drei Zimmern und Küche,
zum Preise von 2500 M., und eine größere zum
Preise von 5000 M., aus Damen-, Wohn-, bez. Herren-
zimmer, Speise-, Schlaf-, Fremden- und Kinderzimmer,
sowie Küche und Garderobe bestehend. Wer wollte
einem so gemeinnützigen Unternehmen nicht Beifall
spenden! Ist es doch dringend zu wünschen, daß
die Wohltaten der Geschmacksrevolution der letzten
Jahre nicht bloß den zahlungsfähigen Kreisen zugute