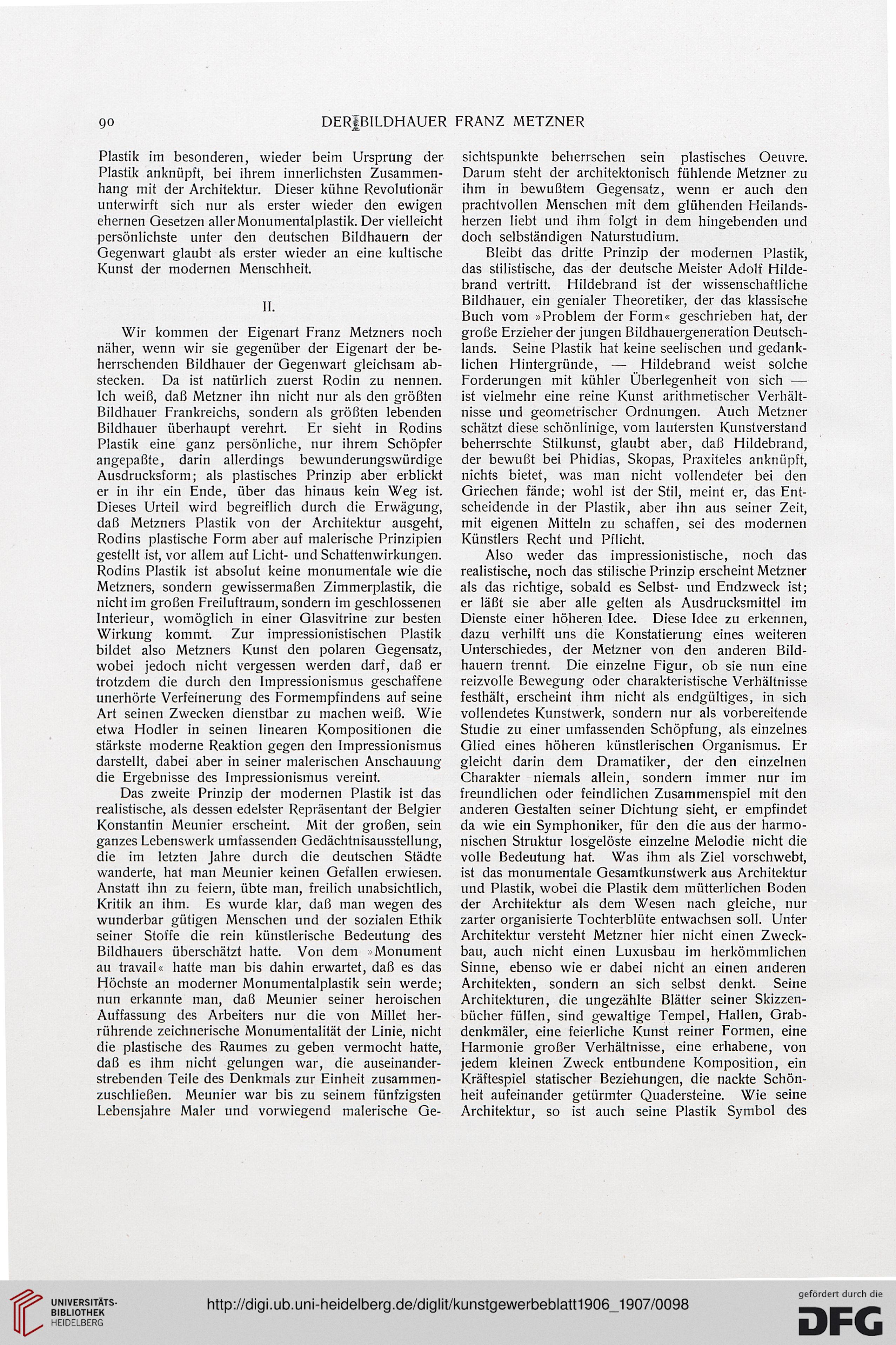go
DERfBILDHAUER FRANZ METZNER
Plastik im besonderen, wieder beim Ursprung der
Plastik anknüpft, bei ihrem innerlichsten Zusammen-
hang mit der Architektur. Dieser kühne Revolutionär
unterwirft sich nur als erster wieder den ewigen
ehernen Gesetzen aller Monumentalplastik. Der vielleicht
persönlichste unter den deutschen Bildhauern der
Gegenwart glaubt als erster wieder an eine kultische
Kunst der modernen Menschheit.
II.
Wir kommen der Eigenart Franz Metzners noch
näher, wenn wir sie gegenüber der Eigenart der be-
herrschenden Bildhauer der Gegenwart gleichsam ab-
stecken. Da ist natürlich zuerst Rodin zu nennen.
Ich weiß, daß Metzner ihn nicht nur als den größten
Bildhauer Frankreichs, sondern als größten lebenden
Bildhauer überhaupt verehrt. Er sieht in Rodins
Plastik eine ganz persönliche, nur ihrem Schöpfer
angepaßte, darin allerdings bewunderungswürdige
Ausdrucksform; als plastisches Prinzip aber erblickt
er in ihr ein Ende, über das hinaus kein Weg ist.
Dieses Urteil wird begreiflich durch die Erwägung,
daß Metzners Plastik von der Architektur ausgeht,
Rodins plastische Form aber auf malerische Prinzipien
gestellt ist, vor allem auf Licht- und Schattenwirkungen.
Rodins Plastik ist absolut keine monumentale wie die
Metzners, sondern gewissermaßen Zimmerplastik, die
nicht im großen Freiluftraum, sondern im geschlossenen
Interieur, womöglich in einer Glasvitrine zur besten
Wirkung kommt. Zur impressionistischen Plastik
bildet also Metzners Kunst den polaren Gegensatz,
wobei jedoch nicht vergessen werden darf, daß er
trotzdem die durch den Impressionismus geschaffene
unerhörte Verfeinerung des Formempfindens auf seine
Art seinen Zwecken dienstbar zu machen weiß. Wie
etwa Hodler in seinen linearen Kompositionen die
stärkste moderne Reaktion gegen den Impressionismus
darstellt, dabei aber in seiner malerischen Anschauung
die Ergebnisse des Impressionismus vereint.
Das zweite Prinzip der modernen Plastik ist das
realistische, als dessen edelster Repräsentant der Belgier
Konstantin Meunier erscheint. Mit der großen, sein
ganzes Lebenswerk umfassenden Gedächtnisausstellung,
die im letzten Jahre durch die deutschen Städte
wanderte, hat man Meunier keinen Gefallen erwiesen.
Anstatt ihn zu feiern, übte man, freilich unabsichtlich,
Kritik an ihm. Es wurde klar, daß man wegen des
wunderbar gütigen Menschen und der sozialen Ethik
seiner Stoffe die rein künstlerische Bedeutung des
Bildhauers überschätzt hatte. Von dem Monument
au travail« hatte man bis dahin erwartet, daß es das
Höchste an moderner Monumentalplastik sein werde;
nun erkannte man, daß Meunier seiner heroischen
Auffassung des Arbeiters nur die von Millet her-
rührende zeichnerische Monumentalität der Linie, nicht
die plastische des Raumes zu geben vermocht hatte,
daß es ihm nicht gelungen war, die auseinander-
strebenden Teile des Denkmals zur Einheit zusammen-
zuschließen. Meunier war bis zu seinem fünfzigsten
Lebensjahre Maler und vorwiegend malerische Ge-
sichtspunkte beherrschen sein plastisches Oeuvre.
Darum steht der architektonisch fühlende Metzner zu
ihm in bewußtem Gegensatz, wenn er auch den
prachtvollen Menschen mit dem glühenden Heilands-
herzen liebt und ihm folgt in dem hingebenden und
doch selbständigen Naturstudium.
Bleibt das dritte Prinzip der modernen Plastik,
das stilistische, das der deutsche Meister Adolf Hilde-
brand vertritt. Hildebrand ist der wissenschaftliche
Bildhauer, ein genialer Theoretiker, der das klassische
Buch vom »Problem der Form« geschrieben hat, der
große Erzieher der jungen Bildhauergeneration Deutsch-
lands. Seine Plastik hat keine seelischen und gedank-
lichen Hintergründe, — Hildebrand weist solche
Forderungen mit kühler Überlegenheit von sich —
ist vielmehr eine reine Kunst arithmetischer Verhält-
nisse und geometrischer Ordnungen. Auch Metzner
schätzt diese schönlinige, vom lautersten Kunstverstand
beherrschte Stilkunst, glaubt aber, daß Hildebrand,
der bewußt bei Phidias, Skopas, Praxiteles anknüpft,
nichts bietet, was man nicht vollendeter bei den
Griechen fände; wohl ist der Stil, meint er, das Ent-
scheidende in der Plastik, aber ihn aus seiner Zeit,
mit eigenen Mitteln zu schaffen, sei des modernen
Künstlers Recht und Pflicht.
Also weder das impressionistische, noch das
realistische, noch das stilische Prinzip erscheint Metzner
als das richtige, sobald es Selbst- und Endzweck ist;
er läßt sie aber alle gelten als Ausdrucksmittel im
Dienste einer höheren Idee. Diese Idee zu erkennen,
dazu verhilft uns die Konstatierung eines weiteren
Unterschiedes, der Metzner von den anderen Bild-
hauern trennt. Die einzelne Figur, ob sie nun eine
reizvolle Bewegung oder charakteristische Verhältnisse
festhält, erscheint ihm nicht als endgültiges, in sich
vollendetes Kunstwerk, sondern nur als vorbereitende
Studie zu einer umfassenden Schöpfung, als einzelnes
Glied eines höheren künstlerischen Organismus. Er
gleicht darin dem Dramatiker, der den einzelnen
Charakter niemals allein, sondern immer nur im
freundlichen oder feindlichen Zusammenspiel mit den
anderen Gestalten seiner Dichtung sieht, er empfindet
da wie ein Symphoniker, für den die aus der harmo-
nischen Struktur losgelöste einzelne Melodie nicht die
volle Bedeutung hat. Was ihm als Ziel vorschwebt,
ist das monumentale Gesamtkunstwerk aus Architektur
und Plastik, wobei die Plastik dem mütterlichen Boden
der Architektur als dem Wesen nach gleiche, nur
zarter organisierte Tochterblüte entwachsen soll. Unter
Architektur versteht Metzner hier nicht einen Zweck-
bau, auch nicht einen Luxusbau im herkömmlichen
Sinne, ebenso wie er dabei nicht an einen anderen
Architekten, sondern an sich selbst denkt. Seine
Architekturen, die ungezählte Blätter seiner Skizzen-
bücher füllen, sind gewaltige Tempel, Hallen, Grab-
denkmäler, eine feierliche Kunst reiner Formen, eine
Harmonie großer Verhältnisse, eine erhabene, von
jedem kleinen Zweck entbundene Komposition, ein
Kräftespiel statischer Beziehungen, die nackte Schön-
heit aufeinander getürmter Quadersteine. Wie seine
Architektur, so ist auch seine Plastik Symbol des
DERfBILDHAUER FRANZ METZNER
Plastik im besonderen, wieder beim Ursprung der
Plastik anknüpft, bei ihrem innerlichsten Zusammen-
hang mit der Architektur. Dieser kühne Revolutionär
unterwirft sich nur als erster wieder den ewigen
ehernen Gesetzen aller Monumentalplastik. Der vielleicht
persönlichste unter den deutschen Bildhauern der
Gegenwart glaubt als erster wieder an eine kultische
Kunst der modernen Menschheit.
II.
Wir kommen der Eigenart Franz Metzners noch
näher, wenn wir sie gegenüber der Eigenart der be-
herrschenden Bildhauer der Gegenwart gleichsam ab-
stecken. Da ist natürlich zuerst Rodin zu nennen.
Ich weiß, daß Metzner ihn nicht nur als den größten
Bildhauer Frankreichs, sondern als größten lebenden
Bildhauer überhaupt verehrt. Er sieht in Rodins
Plastik eine ganz persönliche, nur ihrem Schöpfer
angepaßte, darin allerdings bewunderungswürdige
Ausdrucksform; als plastisches Prinzip aber erblickt
er in ihr ein Ende, über das hinaus kein Weg ist.
Dieses Urteil wird begreiflich durch die Erwägung,
daß Metzners Plastik von der Architektur ausgeht,
Rodins plastische Form aber auf malerische Prinzipien
gestellt ist, vor allem auf Licht- und Schattenwirkungen.
Rodins Plastik ist absolut keine monumentale wie die
Metzners, sondern gewissermaßen Zimmerplastik, die
nicht im großen Freiluftraum, sondern im geschlossenen
Interieur, womöglich in einer Glasvitrine zur besten
Wirkung kommt. Zur impressionistischen Plastik
bildet also Metzners Kunst den polaren Gegensatz,
wobei jedoch nicht vergessen werden darf, daß er
trotzdem die durch den Impressionismus geschaffene
unerhörte Verfeinerung des Formempfindens auf seine
Art seinen Zwecken dienstbar zu machen weiß. Wie
etwa Hodler in seinen linearen Kompositionen die
stärkste moderne Reaktion gegen den Impressionismus
darstellt, dabei aber in seiner malerischen Anschauung
die Ergebnisse des Impressionismus vereint.
Das zweite Prinzip der modernen Plastik ist das
realistische, als dessen edelster Repräsentant der Belgier
Konstantin Meunier erscheint. Mit der großen, sein
ganzes Lebenswerk umfassenden Gedächtnisausstellung,
die im letzten Jahre durch die deutschen Städte
wanderte, hat man Meunier keinen Gefallen erwiesen.
Anstatt ihn zu feiern, übte man, freilich unabsichtlich,
Kritik an ihm. Es wurde klar, daß man wegen des
wunderbar gütigen Menschen und der sozialen Ethik
seiner Stoffe die rein künstlerische Bedeutung des
Bildhauers überschätzt hatte. Von dem Monument
au travail« hatte man bis dahin erwartet, daß es das
Höchste an moderner Monumentalplastik sein werde;
nun erkannte man, daß Meunier seiner heroischen
Auffassung des Arbeiters nur die von Millet her-
rührende zeichnerische Monumentalität der Linie, nicht
die plastische des Raumes zu geben vermocht hatte,
daß es ihm nicht gelungen war, die auseinander-
strebenden Teile des Denkmals zur Einheit zusammen-
zuschließen. Meunier war bis zu seinem fünfzigsten
Lebensjahre Maler und vorwiegend malerische Ge-
sichtspunkte beherrschen sein plastisches Oeuvre.
Darum steht der architektonisch fühlende Metzner zu
ihm in bewußtem Gegensatz, wenn er auch den
prachtvollen Menschen mit dem glühenden Heilands-
herzen liebt und ihm folgt in dem hingebenden und
doch selbständigen Naturstudium.
Bleibt das dritte Prinzip der modernen Plastik,
das stilistische, das der deutsche Meister Adolf Hilde-
brand vertritt. Hildebrand ist der wissenschaftliche
Bildhauer, ein genialer Theoretiker, der das klassische
Buch vom »Problem der Form« geschrieben hat, der
große Erzieher der jungen Bildhauergeneration Deutsch-
lands. Seine Plastik hat keine seelischen und gedank-
lichen Hintergründe, — Hildebrand weist solche
Forderungen mit kühler Überlegenheit von sich —
ist vielmehr eine reine Kunst arithmetischer Verhält-
nisse und geometrischer Ordnungen. Auch Metzner
schätzt diese schönlinige, vom lautersten Kunstverstand
beherrschte Stilkunst, glaubt aber, daß Hildebrand,
der bewußt bei Phidias, Skopas, Praxiteles anknüpft,
nichts bietet, was man nicht vollendeter bei den
Griechen fände; wohl ist der Stil, meint er, das Ent-
scheidende in der Plastik, aber ihn aus seiner Zeit,
mit eigenen Mitteln zu schaffen, sei des modernen
Künstlers Recht und Pflicht.
Also weder das impressionistische, noch das
realistische, noch das stilische Prinzip erscheint Metzner
als das richtige, sobald es Selbst- und Endzweck ist;
er läßt sie aber alle gelten als Ausdrucksmittel im
Dienste einer höheren Idee. Diese Idee zu erkennen,
dazu verhilft uns die Konstatierung eines weiteren
Unterschiedes, der Metzner von den anderen Bild-
hauern trennt. Die einzelne Figur, ob sie nun eine
reizvolle Bewegung oder charakteristische Verhältnisse
festhält, erscheint ihm nicht als endgültiges, in sich
vollendetes Kunstwerk, sondern nur als vorbereitende
Studie zu einer umfassenden Schöpfung, als einzelnes
Glied eines höheren künstlerischen Organismus. Er
gleicht darin dem Dramatiker, der den einzelnen
Charakter niemals allein, sondern immer nur im
freundlichen oder feindlichen Zusammenspiel mit den
anderen Gestalten seiner Dichtung sieht, er empfindet
da wie ein Symphoniker, für den die aus der harmo-
nischen Struktur losgelöste einzelne Melodie nicht die
volle Bedeutung hat. Was ihm als Ziel vorschwebt,
ist das monumentale Gesamtkunstwerk aus Architektur
und Plastik, wobei die Plastik dem mütterlichen Boden
der Architektur als dem Wesen nach gleiche, nur
zarter organisierte Tochterblüte entwachsen soll. Unter
Architektur versteht Metzner hier nicht einen Zweck-
bau, auch nicht einen Luxusbau im herkömmlichen
Sinne, ebenso wie er dabei nicht an einen anderen
Architekten, sondern an sich selbst denkt. Seine
Architekturen, die ungezählte Blätter seiner Skizzen-
bücher füllen, sind gewaltige Tempel, Hallen, Grab-
denkmäler, eine feierliche Kunst reiner Formen, eine
Harmonie großer Verhältnisse, eine erhabene, von
jedem kleinen Zweck entbundene Komposition, ein
Kräftespiel statischer Beziehungen, die nackte Schön-
heit aufeinander getürmter Quadersteine. Wie seine
Architektur, so ist auch seine Plastik Symbol des