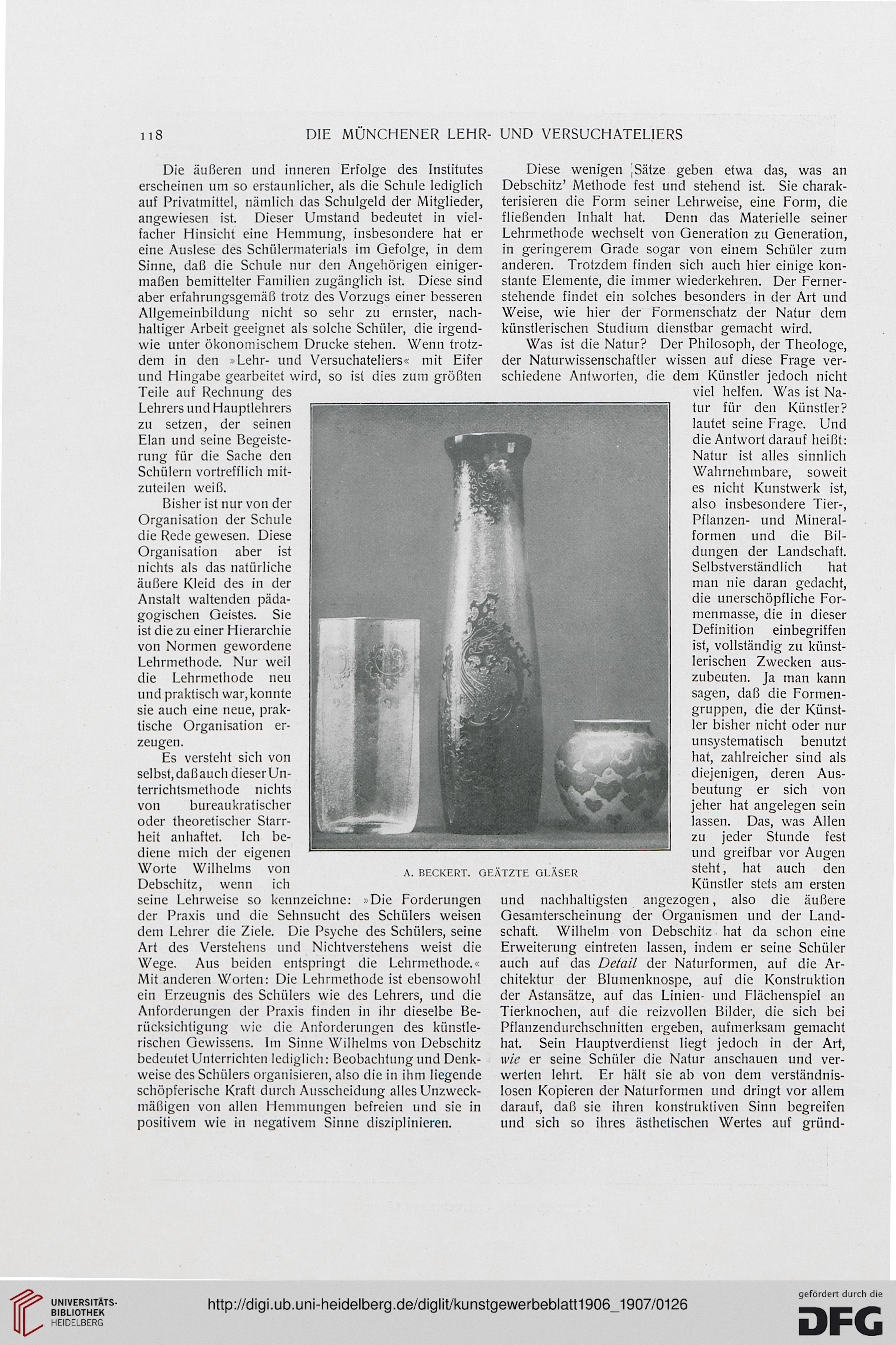u8
DIE MÜNCHENER LEHR- UND VERSUCHATELIERS
Die äußeren und inneren Erfolge des Institutes
erscheinen um so erstaunlicher, als die Schule lediglich
auf Privatmittel, nämlich das Schulgeld der Mitglieder,
angewiesen ist. Dieser Umstand bedeutet in viel-
facher Hinsicht eine Hemmung, insbesondere hat er
eine Auslese des Schülermaterials im Gefolge, in dem
Sinne, daß die Schule nur den Angehörigen einiger-
maßen bemittelter Familien zugänglich ist. Diese sind
aber erfahrungsgemäß trotz des Vorzugs einer besseren
Allgemeinbildung nicht so sehr zu ernster, nach-
halliger Arbeit geeignet als solche Schüler, die irgend-
wie unter ökonomischem Drucke stehen. Wenn trotz-
dem in den »Lehr- und Versuchateliers« mit Eifer
und Hingabe gearbeitet wird, so ist dies zum größten
Teile auf Rechnung des
Lehrers und Hauptlehrers
zu setzen, der seinen
Elan und seine Begeiste-
rung für die Sache den
Schülern vortrefflich mit-
zuteilen weiß.
Bisher ist nur von der
Organisation der Schule
die Rede gewesen. Diese
Organisation aber ist
nichts als das natürliche
äußere Kleid des in der
Anstalt waltenden päda-
gogischen Geistes. Sie
ist die zu einer Hierarchie
von Normen gewordene
Lehrmethode. Nur weil
die Lehrmethode neu
und praktisch war,konnte
sie auch eine neue, prak-
tische Organisation er-
zeugen.
Es versteht sich von
selbst,daßauch dieserUn-
terrichtsmethode nichts
von bureaukratischer
oder theoretischer Starr-
heit anhaftet. Ich be-
diene mich der eigenen
Worte Wilhelms von
Debschitz, wenn ich
seine Lehrweise so kennzeichne: »Die Forderungen
der Praxis und die Sehnsucht des Schülers weisen
dem Lehrer die Ziele. Die Psyche des Schülers, seine
Art des Versteheus und Nichtverstehens weist die
Wege. Aus beiden entspringt die Lehrmethode.«
Mit anderen Worten: Die Lehrmethode ist ebensowohl
ein Erzeugnis des Schülers wie des Lehrers, und die
Anforderungen der Praxis finden in ihr dieselbe Be-
rücksichtigung wie die Anforderungen des künstle-
rischen Gewissens. Im Sinne Wilhelms von Debschitz
bedeutet Unterrichten lediglich: Beobachtung und Denk-
weise des Schülers organisieren, also die in ihm liegende
schöpferische Kraft durch Ausscheidung alles Unzweck-
mäßigen von allen Hemmungen befreien und sie in
positivem wie kl negativem Sinne disziplinieren.
A. BECKERT. GEATZTE GLASER
Diese wenigen jSätze geben etwa das, was an
Debschitz' Methode fest und stehend ist. Sie charak-
terisieren die Form seiner Lehrweise, eine Form, die
fließenden Inhalt hat. Denn das Materielle seiner
Lehrmethode wechselt von Generation zu Generation,
in geringerem Grade sogar von einem Schüler zum
anderen. Trotzdem finden sich auch hier einige kon-
stante Elemente, die immer wiederkehren. Der Ferner-
stehende findet ein solches besonders in der Art und
Weise, wie hier der Formenschatz der Natur dem
künstlerischen Studium dienstbar gemacht wird.
Was ist die Natur? Der Philosoph, der Theologe,
der Naturwissenschaftler wissen auf diese Frage ver-
schiedene Antworten, die dem Künstler jedoch nicht
viel helfen. Was ist Na-
tur für den Künstler?
lautet seine Frage. Und
die Antwort darauf heißt:
Natur ist alles sinnlich
Wahrnehmbare, soweit
es nicht Kunstwerk ist,
also insbesondere Tier-,
Pflanzen- und Mineral-
formen und die Bil-
dungen der Landschaft.
Selbstverständlich hat
man nie daran gedacht,
die unerschöpfliche For-
menmasse, die in dieser
Definition einbegriffen
ist, vollständig zu künst-
lerischen Zwecken aus-
zubeuten. Ja man kann
sagen, daß die Formen-
gruppen, die der Künst-
ler bisher nicht oder nur
unsystematisch benutzt
hat, zahlreicher sind als
diejenigen, deren Aus-
beutung er sich von
jeher hat angelegen sein
lassen. Das, was Allen
zu jeder Stunde fest
und greifbar vor Augen
steht, hat auch den
Künstler stets am ersten
und nachhaltigsten angezogen, also die äußere
Gesamterscheinung der Organismen und der Land-
schaft. Wilhelm von Debschitz hat da schon eine
Erweiterung eintreten lassen, indem er seine Schüler
auch auf das Detail der Naturformen, auf die Ar-
chitektur der Blumenknospe, auf die Konstruktion
der Astansätze, auf das Linien- und Flächenspiel an
Tierknochen, auf die reizvollen
Pflanzendurchschnitten ergeben,
hat. Sein Hauptverdienst liegt
wie er seine Schüler die Natur
werten lehrt. Er hält sie ab von dem verständnis-
losen Kopieren der Naturformen und dringt vor allem
darauf, daß sie ihren konstruktiven Sinn begreifen
und sich so ihres ästhetischen Wertes auf gründ-
Bilder, die sich bei
aufmerksam gemacht
jedoch in der Art,
anschauen und ver-
DIE MÜNCHENER LEHR- UND VERSUCHATELIERS
Die äußeren und inneren Erfolge des Institutes
erscheinen um so erstaunlicher, als die Schule lediglich
auf Privatmittel, nämlich das Schulgeld der Mitglieder,
angewiesen ist. Dieser Umstand bedeutet in viel-
facher Hinsicht eine Hemmung, insbesondere hat er
eine Auslese des Schülermaterials im Gefolge, in dem
Sinne, daß die Schule nur den Angehörigen einiger-
maßen bemittelter Familien zugänglich ist. Diese sind
aber erfahrungsgemäß trotz des Vorzugs einer besseren
Allgemeinbildung nicht so sehr zu ernster, nach-
halliger Arbeit geeignet als solche Schüler, die irgend-
wie unter ökonomischem Drucke stehen. Wenn trotz-
dem in den »Lehr- und Versuchateliers« mit Eifer
und Hingabe gearbeitet wird, so ist dies zum größten
Teile auf Rechnung des
Lehrers und Hauptlehrers
zu setzen, der seinen
Elan und seine Begeiste-
rung für die Sache den
Schülern vortrefflich mit-
zuteilen weiß.
Bisher ist nur von der
Organisation der Schule
die Rede gewesen. Diese
Organisation aber ist
nichts als das natürliche
äußere Kleid des in der
Anstalt waltenden päda-
gogischen Geistes. Sie
ist die zu einer Hierarchie
von Normen gewordene
Lehrmethode. Nur weil
die Lehrmethode neu
und praktisch war,konnte
sie auch eine neue, prak-
tische Organisation er-
zeugen.
Es versteht sich von
selbst,daßauch dieserUn-
terrichtsmethode nichts
von bureaukratischer
oder theoretischer Starr-
heit anhaftet. Ich be-
diene mich der eigenen
Worte Wilhelms von
Debschitz, wenn ich
seine Lehrweise so kennzeichne: »Die Forderungen
der Praxis und die Sehnsucht des Schülers weisen
dem Lehrer die Ziele. Die Psyche des Schülers, seine
Art des Versteheus und Nichtverstehens weist die
Wege. Aus beiden entspringt die Lehrmethode.«
Mit anderen Worten: Die Lehrmethode ist ebensowohl
ein Erzeugnis des Schülers wie des Lehrers, und die
Anforderungen der Praxis finden in ihr dieselbe Be-
rücksichtigung wie die Anforderungen des künstle-
rischen Gewissens. Im Sinne Wilhelms von Debschitz
bedeutet Unterrichten lediglich: Beobachtung und Denk-
weise des Schülers organisieren, also die in ihm liegende
schöpferische Kraft durch Ausscheidung alles Unzweck-
mäßigen von allen Hemmungen befreien und sie in
positivem wie kl negativem Sinne disziplinieren.
A. BECKERT. GEATZTE GLASER
Diese wenigen jSätze geben etwa das, was an
Debschitz' Methode fest und stehend ist. Sie charak-
terisieren die Form seiner Lehrweise, eine Form, die
fließenden Inhalt hat. Denn das Materielle seiner
Lehrmethode wechselt von Generation zu Generation,
in geringerem Grade sogar von einem Schüler zum
anderen. Trotzdem finden sich auch hier einige kon-
stante Elemente, die immer wiederkehren. Der Ferner-
stehende findet ein solches besonders in der Art und
Weise, wie hier der Formenschatz der Natur dem
künstlerischen Studium dienstbar gemacht wird.
Was ist die Natur? Der Philosoph, der Theologe,
der Naturwissenschaftler wissen auf diese Frage ver-
schiedene Antworten, die dem Künstler jedoch nicht
viel helfen. Was ist Na-
tur für den Künstler?
lautet seine Frage. Und
die Antwort darauf heißt:
Natur ist alles sinnlich
Wahrnehmbare, soweit
es nicht Kunstwerk ist,
also insbesondere Tier-,
Pflanzen- und Mineral-
formen und die Bil-
dungen der Landschaft.
Selbstverständlich hat
man nie daran gedacht,
die unerschöpfliche For-
menmasse, die in dieser
Definition einbegriffen
ist, vollständig zu künst-
lerischen Zwecken aus-
zubeuten. Ja man kann
sagen, daß die Formen-
gruppen, die der Künst-
ler bisher nicht oder nur
unsystematisch benutzt
hat, zahlreicher sind als
diejenigen, deren Aus-
beutung er sich von
jeher hat angelegen sein
lassen. Das, was Allen
zu jeder Stunde fest
und greifbar vor Augen
steht, hat auch den
Künstler stets am ersten
und nachhaltigsten angezogen, also die äußere
Gesamterscheinung der Organismen und der Land-
schaft. Wilhelm von Debschitz hat da schon eine
Erweiterung eintreten lassen, indem er seine Schüler
auch auf das Detail der Naturformen, auf die Ar-
chitektur der Blumenknospe, auf die Konstruktion
der Astansätze, auf das Linien- und Flächenspiel an
Tierknochen, auf die reizvollen
Pflanzendurchschnitten ergeben,
hat. Sein Hauptverdienst liegt
wie er seine Schüler die Natur
werten lehrt. Er hält sie ab von dem verständnis-
losen Kopieren der Naturformen und dringt vor allem
darauf, daß sie ihren konstruktiven Sinn begreifen
und sich so ihres ästhetischen Wertes auf gründ-
Bilder, die sich bei
aufmerksam gemacht
jedoch in der Art,
anschauen und ver-