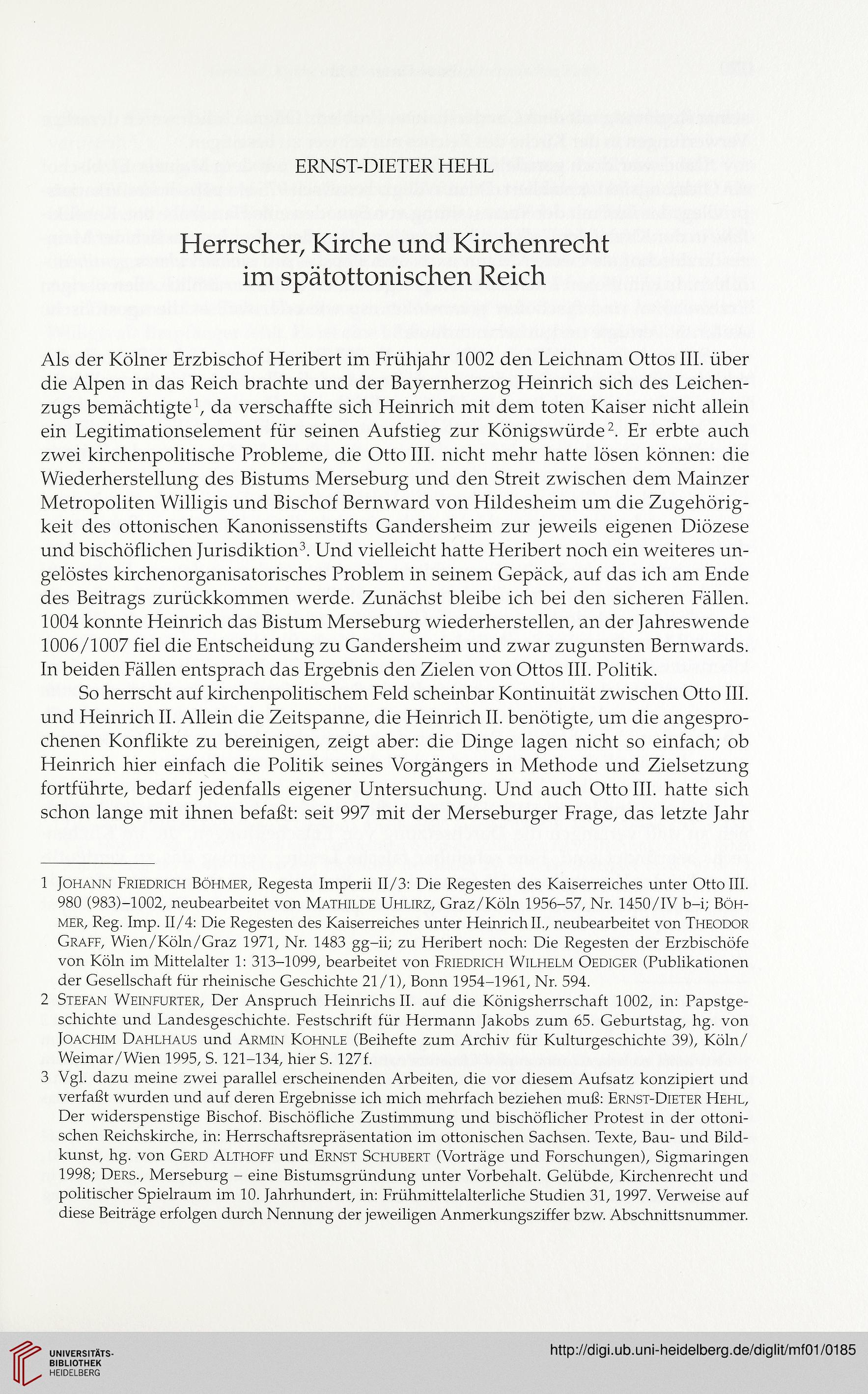ERNST-DIETER HEHL
Herrscher, Kirche und Kirchenrecht
im spätottonischen Reich
Als der Kölner Erzbischof Heribert im Frühjahr 1002 den Leichnam Ottos III. über
die Alpen in das Reich brachte und der Bayernherzog Heinrich sich des Leichen-
zugs bemächtigte da verschaffte sich Heinrich mit dem toten Kaiser nicht allein
ein Legitimationselement für seinen Aufstieg zur Königswürde T Er erbte auch
zwei kirchenpolitische Probleme, die Otto III. nicht mehr hatte lösen können: die
Wiederherstellung des Bistums Merseburg und den Streit zwischen dem Mainzer
Metropoliten Willigis und Bischof Bernward von Hildesheim um die Zugehörig-
keit des ottonischen Kanonissenstifts Gandersheim zur jeweils eigenen Diözese
und bischöflichen Jurisdiktion/ Und vielleicht hatte Heribert noch ein weiteres un-
gelöstes kirchenorganisatorisches Problem in seinem Gepäck, auf das ich am Ende
des Beitrags zurückkommen werde. Zunächst bleibe ich bei den sicheren Fällen.
1004 konnte Heinrich das Bistum Merseburg wiederherstellen, an der Jahreswende
1006/1007 fiel die Entscheidung zu Gandersheim und zwar zugunsten Bernwards.
In beiden Fällen entsprach das Ergebnis den Zielen von Ottos III. Politik.
So herrscht auf kirchenpolitischem Feld scheinbar Kontinuität zwischen Otto III.
und Heinrich II. Allein die Zeitspanne, die Heinrich II. benötigte, um die angespro-
chenen Konflikte zu bereinigen, zeigt aber: die Dinge lagen nicht so einfach; ob
Heinrich hier einfach die Politik seines Vorgängers in Methode und Zielsetzung
fortführte, bedarf jedenfalls eigener Untersuchung. Und auch Otto III. hatte sich
schon lange mit ihnen befaßt: seit 997 mit der Merseburger Frage, das letzte Jahr
1 JOHANN FRIEDRICH BÖHMER, Regesta Imperii 11/3: Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III.
980 (983)-1002, neubearbeitet von MATHILDE UHLiRZ, Graz/Köln 1956-57, Nr. 1450/IV b-i; BÖH-
MER, Reg. Imp. II/4: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich II., neubearbeitet von THEODOR
GRAFF, Wien/Köln/Graz 1971, Nr. 1483 gg-ii; zu Heribert noch: Die Regesten der Erzbischöfe
von Köln im Mittelalter 1: 313-1099, bearbeitet von FRIEDRICH WILHELM OEDIGER (Publikationen
der Gesellschaft für rheinische Geschichte 21/1), Bonn 1954-1961, Nr. 594.
2 STEFAN WEINFURTER, Der Anspruch Heinrichs II. auf die Königsherrschaft 1002, in: Papstge-
schichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag, hg. von
JOACHIM DAHLHAUS und ARMIN KOHNLE (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 39), Köln/
Weimar/Wien 1995, S. 121-134, hier S. 127f.
3 Vgl. dazu meine zwei parallel erscheinenden Arbeiten, die vor diesem Aufsatz konzipiert und
verfaßt wurden und auf deren Ergebnisse ich mich mehrfach beziehen muß: ERNST-DiBTER HEHL,
Der widerspenstige Bischof. BischöAiche Zustimmung und bischöflicher Protest in der ottoni-
schen Reichskirche, in: Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen. Texte, Bau- und Bild-
kunst, hg. von GERD ALTHOFF und ERNST SCHUBERT (Vorträge und Forschungen), Sigmaringen
1998; DERS., Merseburg - eine Bistumsgründung unter Vorbehalt. Gelübde, Kirchenrecht und
politischer Spielraum im 10. Jahrhundert, in: Frühmittelalterliche Studien 31, 1997. Verweise auf
diese Beiträge erfolgen durch Nennung der jeweiligen Anmerkungsziffer bzw. Abschnittsnummer.
Herrscher, Kirche und Kirchenrecht
im spätottonischen Reich
Als der Kölner Erzbischof Heribert im Frühjahr 1002 den Leichnam Ottos III. über
die Alpen in das Reich brachte und der Bayernherzog Heinrich sich des Leichen-
zugs bemächtigte da verschaffte sich Heinrich mit dem toten Kaiser nicht allein
ein Legitimationselement für seinen Aufstieg zur Königswürde T Er erbte auch
zwei kirchenpolitische Probleme, die Otto III. nicht mehr hatte lösen können: die
Wiederherstellung des Bistums Merseburg und den Streit zwischen dem Mainzer
Metropoliten Willigis und Bischof Bernward von Hildesheim um die Zugehörig-
keit des ottonischen Kanonissenstifts Gandersheim zur jeweils eigenen Diözese
und bischöflichen Jurisdiktion/ Und vielleicht hatte Heribert noch ein weiteres un-
gelöstes kirchenorganisatorisches Problem in seinem Gepäck, auf das ich am Ende
des Beitrags zurückkommen werde. Zunächst bleibe ich bei den sicheren Fällen.
1004 konnte Heinrich das Bistum Merseburg wiederherstellen, an der Jahreswende
1006/1007 fiel die Entscheidung zu Gandersheim und zwar zugunsten Bernwards.
In beiden Fällen entsprach das Ergebnis den Zielen von Ottos III. Politik.
So herrscht auf kirchenpolitischem Feld scheinbar Kontinuität zwischen Otto III.
und Heinrich II. Allein die Zeitspanne, die Heinrich II. benötigte, um die angespro-
chenen Konflikte zu bereinigen, zeigt aber: die Dinge lagen nicht so einfach; ob
Heinrich hier einfach die Politik seines Vorgängers in Methode und Zielsetzung
fortführte, bedarf jedenfalls eigener Untersuchung. Und auch Otto III. hatte sich
schon lange mit ihnen befaßt: seit 997 mit der Merseburger Frage, das letzte Jahr
1 JOHANN FRIEDRICH BÖHMER, Regesta Imperii 11/3: Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III.
980 (983)-1002, neubearbeitet von MATHILDE UHLiRZ, Graz/Köln 1956-57, Nr. 1450/IV b-i; BÖH-
MER, Reg. Imp. II/4: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich II., neubearbeitet von THEODOR
GRAFF, Wien/Köln/Graz 1971, Nr. 1483 gg-ii; zu Heribert noch: Die Regesten der Erzbischöfe
von Köln im Mittelalter 1: 313-1099, bearbeitet von FRIEDRICH WILHELM OEDIGER (Publikationen
der Gesellschaft für rheinische Geschichte 21/1), Bonn 1954-1961, Nr. 594.
2 STEFAN WEINFURTER, Der Anspruch Heinrichs II. auf die Königsherrschaft 1002, in: Papstge-
schichte und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag, hg. von
JOACHIM DAHLHAUS und ARMIN KOHNLE (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 39), Köln/
Weimar/Wien 1995, S. 121-134, hier S. 127f.
3 Vgl. dazu meine zwei parallel erscheinenden Arbeiten, die vor diesem Aufsatz konzipiert und
verfaßt wurden und auf deren Ergebnisse ich mich mehrfach beziehen muß: ERNST-DiBTER HEHL,
Der widerspenstige Bischof. BischöAiche Zustimmung und bischöflicher Protest in der ottoni-
schen Reichskirche, in: Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen. Texte, Bau- und Bild-
kunst, hg. von GERD ALTHOFF und ERNST SCHUBERT (Vorträge und Forschungen), Sigmaringen
1998; DERS., Merseburg - eine Bistumsgründung unter Vorbehalt. Gelübde, Kirchenrecht und
politischer Spielraum im 10. Jahrhundert, in: Frühmittelalterliche Studien 31, 1997. Verweise auf
diese Beiträge erfolgen durch Nennung der jeweiligen Anmerkungsziffer bzw. Abschnittsnummer.