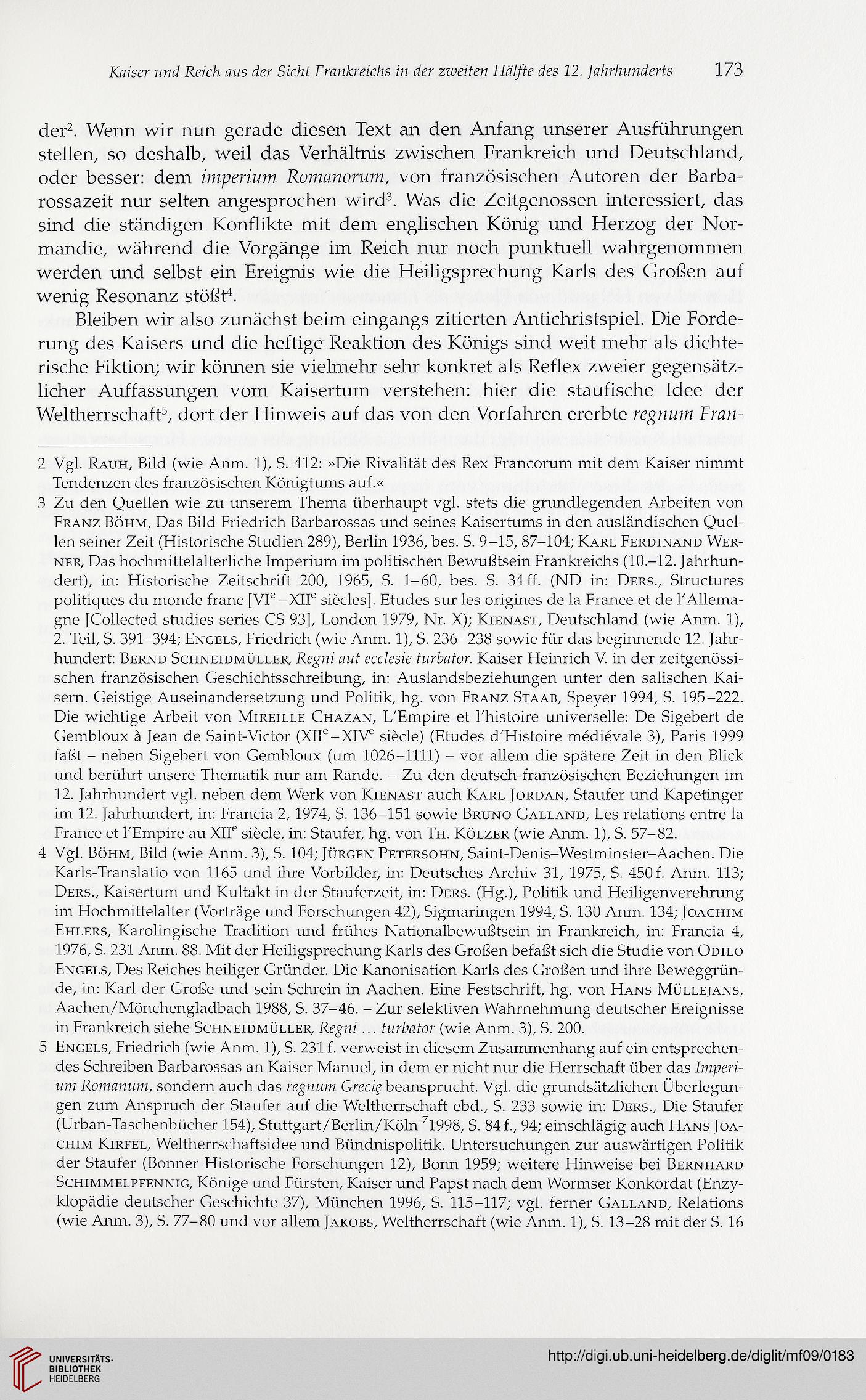Kaiser und Reich aus der Sicht Frankreichs in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 173
der2. Wenn wir nun gerade diesen Text an den Anfang unserer Ausführungen
stellen, so deshalb, weil das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland,
oder besser: dem imperium Romanorum, von französischen Autoren der Barba-
rossazeit nur selten angesprochen wird3. Was die Zeitgenossen interessiert, das
sind die ständigen Konflikte mit dem englischen König und Herzog der Nor-
mandie, während die Vorgänge im Reich nur noch punktuell wahrgenommen
werden und selbst ein Ereignis wie die Heiligsprechung Karls des Großen auf
wenig Resonanz stößt4.
Bleiben wir also zunächst beim eingangs zitierten Antichristspiel. Die Forde-
rung des Kaisers und die heftige Reaktion des Königs sind weit mehr als dichte-
rische Fiktion; wir können sie vielmehr sehr konkret als Reflex zweier gegensätz-
licher Auffassungen vom Kaisertum verstehen: hier die staufische Idee der
Weltherrschaft5 *, dort der Hinweis auf das von den Vorfahren ererbte regnum Fran-
2 Vgl. Rauh, Bild (wie Anm. 1), S. 412: »Die Rivalität des Rex Francorum mit dem Kaiser nimmt
Tendenzen des französischen Königtums auf.«
3 Zu den Quellen wie zu unserem Thema überhaupt vgl. stets die grundlegenden Arbeiten von
Franz Böhm, Das Bild Friedrich Barbarossas und seines Kaisertums in den ausländischen Quel-
len seiner Zeit (Flistorische Studien 289), Berlin 1936, bes. S. 9-15, 87-104; Karl Ferdinand Wer-
ner, Das hochmittelalterliche Imperium im politischen Bewußtsein Frankreichs (10.-12. Jahrhun-
dert), in: Historische Zeitschrift 200, 1965, S. 1-60, bes. S. 34 ff. (ND in: Ders., Structures
politiques du monde franc [VIe-XIIe siecles]. Etudes sur les origines de la France et de l'Allema-
gne [Collected studies series CS 93], London 1979, Nr. X); Kienast, Deutschland (wie Anm. 1),
2. Teil, S. 391-394; Engels, Friedrich (wie Anm. 1), S. 236-238 sowie für das beginnende 12. Jahr-
hundert: Bernd Schneidmüller, Regni aut ecclesie turbator. Kaiser Heinrich V. in der zeitgenössi-
schen französischen Geschichtsschreibung, in: Auslandsbeziehungen unter den salischen Kai-
sern. Geistige Auseinandersetzung und Politik, hg. von Franz Staab, Speyer 1994, S. 195-222.
Die wichtige Arbeit von Mireille Chazan, L'Empire et l'histoire universelle: De Sigebert de
Gembloux ä Jean de Saint-Victor (XIIe-XlV‘ siede) (Etudes d'Histoire medievale 3), Paris 1999
faßt - neben Sigebert von Gembloux (um 1026-1111) - vor allem die spätere Zeit in den Blick
und berührt unsere Thematik nur am Rande. - Zu den deutsch-französischen Beziehungen im
12. Jahrhundert vgl. neben dem Werk von Kienast auch Karl Jordan, Staufer und Kapetinger
im 12. Jahrhundert, in: Francia 2, 1974, S. 136-151 sowie Bruno Galland, Les relations entre la
France et TEmpire au XIIe siede, in: Staufer, hg. von Th. Kölzer (wie Anm. 1), S. 57-82.
4 Vgl. Böhm, Bild (wie Anm. 3), S. 104; Jürgen Petersohn, Saint-Denis-Westminster-Aachen. Die
Karls-Translatio von 1165 und ihre Vorbilder, in: Deutsches Archiv 31, 1975, S. 450 f. Anm. 113;
Ders., Kaisertum und Kultakt in der Stauferzeit, in: Ders. (Hg.), Politik und Heiligenverehrung
im Hochmittelalter (Vorträge und Forschungen 42), Sigmaringen 1994, S. 130 Anm. 134; Joachim
Ehlers, Karolingische Tradition und frühes Nationalbewußtsein in Frankreich, in: Francia 4,
1976, S. 231 Anm. 88. Mit der Heiligsprechung Karls des Großen befaßt sich die Studie von Odilo
Engels, Des Reiches heiliger Gründer. Die Kanonisation Karls des Großen und ihre Beweggrün-
de, in: Karl der Große und sein Schrein in Aachen. Eine Festschrift, hg. von Hans Müllejans,
Aachen/Mönchengladbach 1988, S. 37-46. - Zur selektiven Wahrnehmung deutscher Ereignisse
in Frankreich siehe Schneidmüller, Regni ... turbator (wie Anm. 3), S. 200.
5 Engels, Friedrich (wie Anm. 1), S. 231 f. verweist in diesem Zusammenhang auf ein entsprechen-
des Schreiben Barbarossas an Kaiser Manuel, in dem er nicht nur die Herrschaft über das Imperi-
um Romanum, sondern auch das regnum Greci§ beansprucht. Vgl. die grundsätzlichen Überlegun-
gen zum Anspruch der Staufer auf die Weltherrschaft ebd., S. 233 sowie in: Ders., Die Staufer
(Urban-Taschenbücher 154), Stuttgart/Berlin/Köln 71998, S. 84 f., 94; einschlägig auch Hans Joa-
chim Kirpel, Weltherrschaftsidee und Bündnispolitik. Untersuchungen zur auswärtigen Politik
der Staufer (Bonner Historische Forschungen 12), Bonn 1959; weitere Hinweise bei Bernhard
Schimmelpfennig, Könige und Fürsten, Kaiser und Papst nach dem Wormser Konkordat (Enzy-
klopädie deutscher Geschichte 37), München 1996, S. 115-117; vgl. ferner Galland, Relations
(wie Anm. 3), S. 77-80 und vor allem Jakobs, Weltherrschaft (wie Anm. 1), S. 13-28 mit der S. 16
der2. Wenn wir nun gerade diesen Text an den Anfang unserer Ausführungen
stellen, so deshalb, weil das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland,
oder besser: dem imperium Romanorum, von französischen Autoren der Barba-
rossazeit nur selten angesprochen wird3. Was die Zeitgenossen interessiert, das
sind die ständigen Konflikte mit dem englischen König und Herzog der Nor-
mandie, während die Vorgänge im Reich nur noch punktuell wahrgenommen
werden und selbst ein Ereignis wie die Heiligsprechung Karls des Großen auf
wenig Resonanz stößt4.
Bleiben wir also zunächst beim eingangs zitierten Antichristspiel. Die Forde-
rung des Kaisers und die heftige Reaktion des Königs sind weit mehr als dichte-
rische Fiktion; wir können sie vielmehr sehr konkret als Reflex zweier gegensätz-
licher Auffassungen vom Kaisertum verstehen: hier die staufische Idee der
Weltherrschaft5 *, dort der Hinweis auf das von den Vorfahren ererbte regnum Fran-
2 Vgl. Rauh, Bild (wie Anm. 1), S. 412: »Die Rivalität des Rex Francorum mit dem Kaiser nimmt
Tendenzen des französischen Königtums auf.«
3 Zu den Quellen wie zu unserem Thema überhaupt vgl. stets die grundlegenden Arbeiten von
Franz Böhm, Das Bild Friedrich Barbarossas und seines Kaisertums in den ausländischen Quel-
len seiner Zeit (Flistorische Studien 289), Berlin 1936, bes. S. 9-15, 87-104; Karl Ferdinand Wer-
ner, Das hochmittelalterliche Imperium im politischen Bewußtsein Frankreichs (10.-12. Jahrhun-
dert), in: Historische Zeitschrift 200, 1965, S. 1-60, bes. S. 34 ff. (ND in: Ders., Structures
politiques du monde franc [VIe-XIIe siecles]. Etudes sur les origines de la France et de l'Allema-
gne [Collected studies series CS 93], London 1979, Nr. X); Kienast, Deutschland (wie Anm. 1),
2. Teil, S. 391-394; Engels, Friedrich (wie Anm. 1), S. 236-238 sowie für das beginnende 12. Jahr-
hundert: Bernd Schneidmüller, Regni aut ecclesie turbator. Kaiser Heinrich V. in der zeitgenössi-
schen französischen Geschichtsschreibung, in: Auslandsbeziehungen unter den salischen Kai-
sern. Geistige Auseinandersetzung und Politik, hg. von Franz Staab, Speyer 1994, S. 195-222.
Die wichtige Arbeit von Mireille Chazan, L'Empire et l'histoire universelle: De Sigebert de
Gembloux ä Jean de Saint-Victor (XIIe-XlV‘ siede) (Etudes d'Histoire medievale 3), Paris 1999
faßt - neben Sigebert von Gembloux (um 1026-1111) - vor allem die spätere Zeit in den Blick
und berührt unsere Thematik nur am Rande. - Zu den deutsch-französischen Beziehungen im
12. Jahrhundert vgl. neben dem Werk von Kienast auch Karl Jordan, Staufer und Kapetinger
im 12. Jahrhundert, in: Francia 2, 1974, S. 136-151 sowie Bruno Galland, Les relations entre la
France et TEmpire au XIIe siede, in: Staufer, hg. von Th. Kölzer (wie Anm. 1), S. 57-82.
4 Vgl. Böhm, Bild (wie Anm. 3), S. 104; Jürgen Petersohn, Saint-Denis-Westminster-Aachen. Die
Karls-Translatio von 1165 und ihre Vorbilder, in: Deutsches Archiv 31, 1975, S. 450 f. Anm. 113;
Ders., Kaisertum und Kultakt in der Stauferzeit, in: Ders. (Hg.), Politik und Heiligenverehrung
im Hochmittelalter (Vorträge und Forschungen 42), Sigmaringen 1994, S. 130 Anm. 134; Joachim
Ehlers, Karolingische Tradition und frühes Nationalbewußtsein in Frankreich, in: Francia 4,
1976, S. 231 Anm. 88. Mit der Heiligsprechung Karls des Großen befaßt sich die Studie von Odilo
Engels, Des Reiches heiliger Gründer. Die Kanonisation Karls des Großen und ihre Beweggrün-
de, in: Karl der Große und sein Schrein in Aachen. Eine Festschrift, hg. von Hans Müllejans,
Aachen/Mönchengladbach 1988, S. 37-46. - Zur selektiven Wahrnehmung deutscher Ereignisse
in Frankreich siehe Schneidmüller, Regni ... turbator (wie Anm. 3), S. 200.
5 Engels, Friedrich (wie Anm. 1), S. 231 f. verweist in diesem Zusammenhang auf ein entsprechen-
des Schreiben Barbarossas an Kaiser Manuel, in dem er nicht nur die Herrschaft über das Imperi-
um Romanum, sondern auch das regnum Greci§ beansprucht. Vgl. die grundsätzlichen Überlegun-
gen zum Anspruch der Staufer auf die Weltherrschaft ebd., S. 233 sowie in: Ders., Die Staufer
(Urban-Taschenbücher 154), Stuttgart/Berlin/Köln 71998, S. 84 f., 94; einschlägig auch Hans Joa-
chim Kirpel, Weltherrschaftsidee und Bündnispolitik. Untersuchungen zur auswärtigen Politik
der Staufer (Bonner Historische Forschungen 12), Bonn 1959; weitere Hinweise bei Bernhard
Schimmelpfennig, Könige und Fürsten, Kaiser und Papst nach dem Wormser Konkordat (Enzy-
klopädie deutscher Geschichte 37), München 1996, S. 115-117; vgl. ferner Galland, Relations
(wie Anm. 3), S. 77-80 und vor allem Jakobs, Weltherrschaft (wie Anm. 1), S. 13-28 mit der S. 16