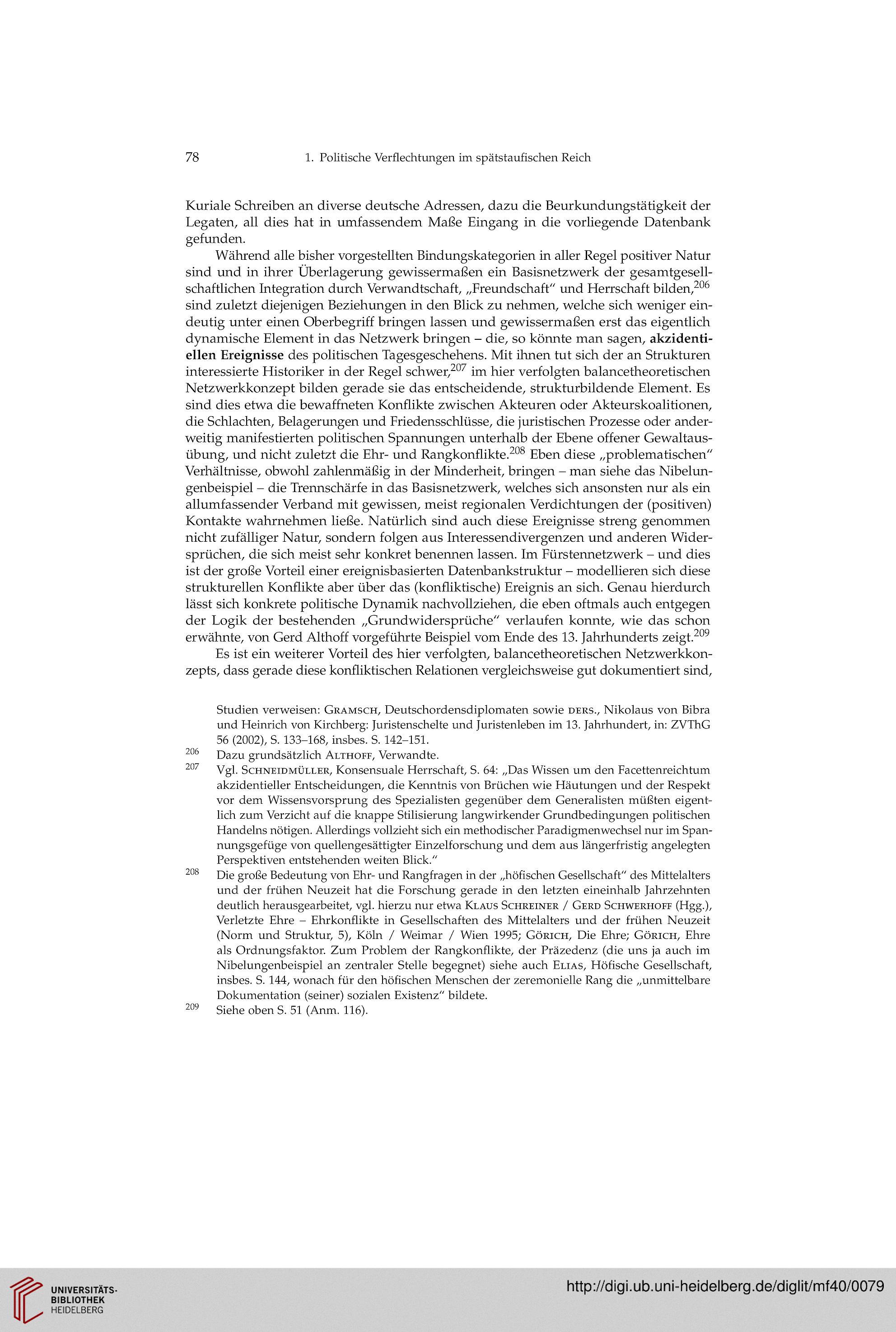78
1. Politische Verflechtungen im spätstaufischen Reich
Kuriale Schreiben an diverse deutsche Adressen, dazu die Beurkundungstätigkeit der
Legaten, all dies hat in umfassendem Maße Eingang in die vorliegende Datenbank
gefunden.
Während alle bisher vorgestellten Bindungskategorien in aller Regel positiver Natur
sind und in ihrer Überlagerung gewissermaßen ein Basisnetzwerk der gesamtgesell-
schaftlichen Integration durch Verwandtschaft, „Freundschaft" und Herrschaft bilden,^
sind zuletzt diejenigen Beziehungen in den Blick zu nehmen, welche sich weniger ein-
deutig unter einen Oberbegriff bringen lassen und gewissermaßen erst das eigentlich
dynamische Element in das Netzwerk bringen - die, so könnte man sagen, akzidenti-
ellen Ereignisse des politischen Tagesgeschehens. Mit ihnen tut sich der an Strukturen
interessierte Historiker in der Regel schwer/*^ im hier verfolgten balancetheoretischen
Netzwerkkonzept bilden gerade sie das entscheidende, strukturbildende Element. Es
sind dies etwa die bewaffneten Konflikte zwischen Akteuren oder Akteurskoalitionen,
die Schlachten, Belagerungen und Friedensschlüsse, die juristischen Prozesse oder ander-
weitig manifestierten politischen Spannungen unterhalb der Ebene offener Gewaltaus-
übung, und nicht zuletzt die Ehr- und Rangkonflikte.^ Eben diese „problematischen"
Verhältnisse, obwohl zahlenmäßig in der Minderheit, bringen - man siehe das Nibelun-
genbeispiel - die Trennschärfe in das Basisnetzwerk, welches sich ansonsten nur als ein
allumfassender Verband mit gewissen, meist regionalen Verdichtungen der (positiven)
Kontakte wahrnehmen ließe. Natürlich sind auch diese Ereignisse streng genommen
nicht zufälliger Natur, sondern folgen aus Interessendivergenzen und anderen Wider-
sprüchen, die sich meist sehr konkret benennen lassen. Im Fürstennetzwerk - und dies
ist der große Vorteil einer ereignisbasierten Datenbankstruktur - modellieren sich diese
strukturellen Konflikte aber über das (konfliktische) Ereignis an sich. Genau hierdurch
lässt sich konkrete politische Dynamik nachvollziehen, die eben oftmals auch entgegen
der Logik der bestehenden „Grundwidersprüche" verlaufen konnte, wie das schon
erwähnte, von Gerd Althoff vorgeführte Beispiel vom Ende des 13. Jahrhunderts zeigt.^
Es ist ein weiterer Vorteil des hier verfolgten, balancetheoretischen Netzwerkkon-
zepts, dass gerade diese konfliktischen Relationen vergleichsweise gut dokumentiert sind.
Studien verweisen: GRAMsen, Deutschordensdiplomaten sowie DERS., Nikolaus von Bibra
und Heinrich von Kirchberg: Juristenschelte und Juristenleben im 13. Jahrhundert, in: ZVThG
56 (2002), S. 133-168, insbes. S. 142-151.
Dazu grundsätzlich ALTHorr, Verwandte.
207 Vgl. ScHNEiDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft, S. 64: „Das Wissen um den Facettenreichtum
akzidentieller Entscheidungen, die Kenntnis von Brüchen wie Häutungen und der Respekt
vor dem Wissensvorsprung des Spezialisten gegenüber dem Generalisten müßten eigent-
lich zum Verzicht auf die knappe Stilisierung langwirkender Grundbedingungen politischen
Handelns nötigen. Allerdings vollzieht sich ein methodischer Paradigmenwechsel nur im Span-
nungsgefüge von quellengesättigter Einzelforschung und dem aus längerfristig angelegten
Perspektiven entstehenden weiten Blick."
208 Die große Bedeutung von Ehr- und Rangfragen in der „höfischen Gesellschaft" des Mittelalters
und der frühen Neuzeit hat die Forschung gerade in den letzten eineinhalb Jahrzehnten
deutlich herausgearbeitet, vgl. hierzu nur etwa KLAUS SCHREINER / GERD ScHWERHOEF (Hgg.),
Verletzte Ehre - Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit
(Norm und Struktur, 5), Köln / Weimar / Wien 1995; GöRiCH, Die Ehre; GöRiCH, Ehre
als Ordnungsfaktor. Zum Problem der Rangkonflikte, der Präzedenz (die uns ja auch im
Nibelungenbeispiel an zentraler Stelle begegnet) siehe auch ELIAS, Höfische Gesellschaft,
insbes. S. 144, wonach für den höfischen Menschen der zeremonielle Rang die „unmittelbare
Dokumentation (seiner) sozialen Existenz" bildete.
^ Siehe oben S. 51 (Anm. 116).
1. Politische Verflechtungen im spätstaufischen Reich
Kuriale Schreiben an diverse deutsche Adressen, dazu die Beurkundungstätigkeit der
Legaten, all dies hat in umfassendem Maße Eingang in die vorliegende Datenbank
gefunden.
Während alle bisher vorgestellten Bindungskategorien in aller Regel positiver Natur
sind und in ihrer Überlagerung gewissermaßen ein Basisnetzwerk der gesamtgesell-
schaftlichen Integration durch Verwandtschaft, „Freundschaft" und Herrschaft bilden,^
sind zuletzt diejenigen Beziehungen in den Blick zu nehmen, welche sich weniger ein-
deutig unter einen Oberbegriff bringen lassen und gewissermaßen erst das eigentlich
dynamische Element in das Netzwerk bringen - die, so könnte man sagen, akzidenti-
ellen Ereignisse des politischen Tagesgeschehens. Mit ihnen tut sich der an Strukturen
interessierte Historiker in der Regel schwer/*^ im hier verfolgten balancetheoretischen
Netzwerkkonzept bilden gerade sie das entscheidende, strukturbildende Element. Es
sind dies etwa die bewaffneten Konflikte zwischen Akteuren oder Akteurskoalitionen,
die Schlachten, Belagerungen und Friedensschlüsse, die juristischen Prozesse oder ander-
weitig manifestierten politischen Spannungen unterhalb der Ebene offener Gewaltaus-
übung, und nicht zuletzt die Ehr- und Rangkonflikte.^ Eben diese „problematischen"
Verhältnisse, obwohl zahlenmäßig in der Minderheit, bringen - man siehe das Nibelun-
genbeispiel - die Trennschärfe in das Basisnetzwerk, welches sich ansonsten nur als ein
allumfassender Verband mit gewissen, meist regionalen Verdichtungen der (positiven)
Kontakte wahrnehmen ließe. Natürlich sind auch diese Ereignisse streng genommen
nicht zufälliger Natur, sondern folgen aus Interessendivergenzen und anderen Wider-
sprüchen, die sich meist sehr konkret benennen lassen. Im Fürstennetzwerk - und dies
ist der große Vorteil einer ereignisbasierten Datenbankstruktur - modellieren sich diese
strukturellen Konflikte aber über das (konfliktische) Ereignis an sich. Genau hierdurch
lässt sich konkrete politische Dynamik nachvollziehen, die eben oftmals auch entgegen
der Logik der bestehenden „Grundwidersprüche" verlaufen konnte, wie das schon
erwähnte, von Gerd Althoff vorgeführte Beispiel vom Ende des 13. Jahrhunderts zeigt.^
Es ist ein weiterer Vorteil des hier verfolgten, balancetheoretischen Netzwerkkon-
zepts, dass gerade diese konfliktischen Relationen vergleichsweise gut dokumentiert sind.
Studien verweisen: GRAMsen, Deutschordensdiplomaten sowie DERS., Nikolaus von Bibra
und Heinrich von Kirchberg: Juristenschelte und Juristenleben im 13. Jahrhundert, in: ZVThG
56 (2002), S. 133-168, insbes. S. 142-151.
Dazu grundsätzlich ALTHorr, Verwandte.
207 Vgl. ScHNEiDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft, S. 64: „Das Wissen um den Facettenreichtum
akzidentieller Entscheidungen, die Kenntnis von Brüchen wie Häutungen und der Respekt
vor dem Wissensvorsprung des Spezialisten gegenüber dem Generalisten müßten eigent-
lich zum Verzicht auf die knappe Stilisierung langwirkender Grundbedingungen politischen
Handelns nötigen. Allerdings vollzieht sich ein methodischer Paradigmenwechsel nur im Span-
nungsgefüge von quellengesättigter Einzelforschung und dem aus längerfristig angelegten
Perspektiven entstehenden weiten Blick."
208 Die große Bedeutung von Ehr- und Rangfragen in der „höfischen Gesellschaft" des Mittelalters
und der frühen Neuzeit hat die Forschung gerade in den letzten eineinhalb Jahrzehnten
deutlich herausgearbeitet, vgl. hierzu nur etwa KLAUS SCHREINER / GERD ScHWERHOEF (Hgg.),
Verletzte Ehre - Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit
(Norm und Struktur, 5), Köln / Weimar / Wien 1995; GöRiCH, Die Ehre; GöRiCH, Ehre
als Ordnungsfaktor. Zum Problem der Rangkonflikte, der Präzedenz (die uns ja auch im
Nibelungenbeispiel an zentraler Stelle begegnet) siehe auch ELIAS, Höfische Gesellschaft,
insbes. S. 144, wonach für den höfischen Menschen der zeremonielle Rang die „unmittelbare
Dokumentation (seiner) sozialen Existenz" bildete.
^ Siehe oben S. 51 (Anm. 116).