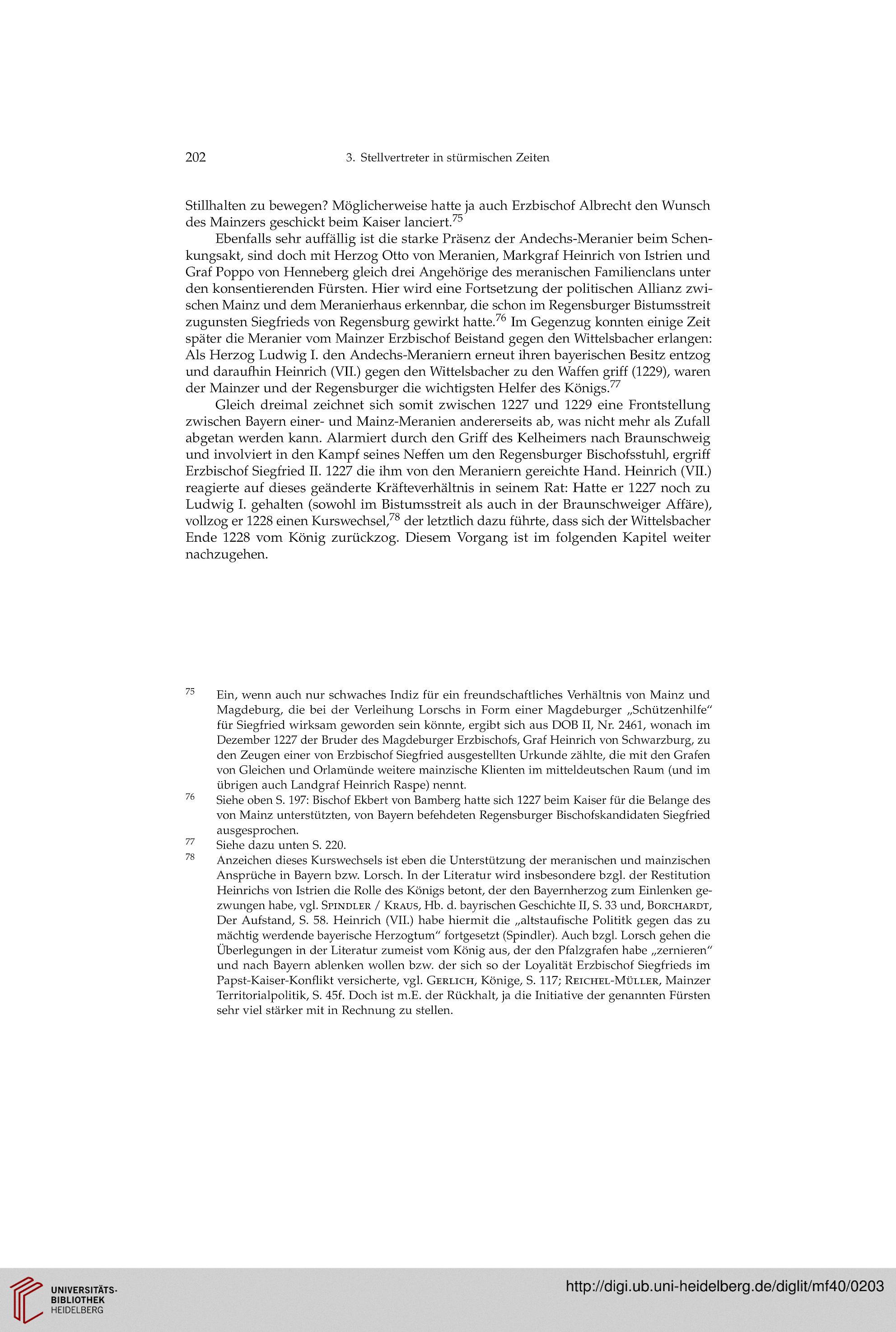202
3. Stellvertreter in stürmischen Zeiten
Stillhalten zu bewegen? Möglicherweise hatte ja auch Erzbischof Albrecht den Wunsch
des Mainzers geschickt beim Kaiser lanciert/^
Ebenfalls sehr auffällig ist die starke Präsenz der Andechs-Meranier beim Schen-
kungsakt, sind doch mit Herzog Otto von Meranien, Markgraf Heinrich von Istrien und
Graf Poppo von Henneberg gleich drei Angehörige des meranischen Familienclans unter
den konsentierenden Fürsten. Hier wird eine Fortsetzung der politischen Allianz zwi-
schen Mainz und dem Meranierhaus erkennbar, die schon im Regensburger Bistumsstreit
zugunsten Siegfrieds von Regensburg gewirkt hatte7^ Im Gegenzug konnten einige Zeit
später die Meranier vom Mainzer Erzbischof Beistand gegen den Wittelsbacher erlangen:
Als Herzog Ludwig I. den Andechs-Meraniern erneut ihren bayerischen Besitz entzog
und daraufhin Heinrich (VII.) gegen den Wittelsbacher zu den Waffen griff (1229), waren
der Mainzer und der Regensburger die wichtigsten Helfer des Königs/^
Gleich dreimal zeichnet sich somit zwischen 1227 und 1229 eine Frontstellung
zwischen Bayern einer- und Mainz-Meranien andererseits ab, was nicht mehr als Zufall
abgetan werden kann. Alarmiert durch den Griff des Kelheimers nach Braunschweig
und involviert in den Kampf seines Neffen um den Regensburger Bischofsstuhl, ergriff
Erzbischof Siegfried II. 1227 die ihm von den Meraniern gereichte Hand. Heinrich (VII.)
reagierte auf dieses geänderte Kräfteverhältnis in seinem Rat: Hatte er 1227 noch zu
Ludwig I. gehalten (sowohl im Bistumsstreit als auch in der Braunschweiger Affäre),
vollzog er 1228 einen Kurswechsel/^ der letztlich dazu führte, dass sich der Wittelsbacher
Ende 1228 vom König zurückzog. Diesem Vorgang ist im folgenden Kapitel weiter
nachzugehen.
Ein, wenn auch nur schwaches Indiz für ein freundschaftliches Verhältnis von Mainz und
Magdeburg, die bei der Verleihung Lorschs in Form einer Magdeburger „Schützenhilfe"
für Siegfried wirksam geworden sein könnte, ergibt sich aus DOB II, Nr. 2461, wonach im
Dezember 1227 der Bruder des Magdeburger Erzbischofs, Graf Heinrich von Schwarzburg, zu
den Zeugen einer von Erzbischof Siegfried ausgestellten Urkunde zählte, die mit den Grafen
von Gleichen und Orlamünde weitere mainzische Klienten im mitteldeutschen Raum (und im
übrigen auch Landgraf Heinrich Raspe) nennt.
Siehe oben S. 197: Bischof Ekbert von Bamberg hatte sich 1227 beim Kaiser für die Belange des
von Mainz unterstützten, von Bayern befehdeten Regensburger Bischofskandidaten Siegfried
ausgesprochen.
^ Siehe dazu unten S. 220.
^ Anzeichen dieses Kurswechsels ist eben die Unterstützung der meranischen und mainzischen
Ansprüche in Bayern bzw. Lorsch. In der Literatur wird insbesondere bzgl. der Restitution
Heinrichs von Istrien die Rolle des Königs betont, der den Bayernherzog zum Einlenken ge-
zwungen habe, vgl. SriNDLER / KRAUS, Hb. d. bayrischen Geschichte II, S. 33 und, BoRCHARDT,
Der Aufstand, S. 58. Heinrich (VII.) habe hiermit die „altstaufische Polititk gegen das zu
mächtig werdende bayerische Herzogtum" fortgesetzt (Spindler). Auch bzgl. Lorsch gehen die
Überlegungen in der Literatur zumeist vom König aus, der den Pfalzgrafen habe „zernieren"
und nach Bayern ablenken wollen bzw. der sich so der Loyalität Erzbischof Siegfrieds im
Papst-Kaiser-KonRikt versicherte, vgl. GERLiCH, Könige, S. 117; REICHEL-MÜLLER, Mainzer
Territorialpolitik, S. 45f. Doch ist m.E. der Rückhalt, ja die Initiative der genannten Fürsten
sehr viel stärker mit in Rechnung zu stellen.
3. Stellvertreter in stürmischen Zeiten
Stillhalten zu bewegen? Möglicherweise hatte ja auch Erzbischof Albrecht den Wunsch
des Mainzers geschickt beim Kaiser lanciert/^
Ebenfalls sehr auffällig ist die starke Präsenz der Andechs-Meranier beim Schen-
kungsakt, sind doch mit Herzog Otto von Meranien, Markgraf Heinrich von Istrien und
Graf Poppo von Henneberg gleich drei Angehörige des meranischen Familienclans unter
den konsentierenden Fürsten. Hier wird eine Fortsetzung der politischen Allianz zwi-
schen Mainz und dem Meranierhaus erkennbar, die schon im Regensburger Bistumsstreit
zugunsten Siegfrieds von Regensburg gewirkt hatte7^ Im Gegenzug konnten einige Zeit
später die Meranier vom Mainzer Erzbischof Beistand gegen den Wittelsbacher erlangen:
Als Herzog Ludwig I. den Andechs-Meraniern erneut ihren bayerischen Besitz entzog
und daraufhin Heinrich (VII.) gegen den Wittelsbacher zu den Waffen griff (1229), waren
der Mainzer und der Regensburger die wichtigsten Helfer des Königs/^
Gleich dreimal zeichnet sich somit zwischen 1227 und 1229 eine Frontstellung
zwischen Bayern einer- und Mainz-Meranien andererseits ab, was nicht mehr als Zufall
abgetan werden kann. Alarmiert durch den Griff des Kelheimers nach Braunschweig
und involviert in den Kampf seines Neffen um den Regensburger Bischofsstuhl, ergriff
Erzbischof Siegfried II. 1227 die ihm von den Meraniern gereichte Hand. Heinrich (VII.)
reagierte auf dieses geänderte Kräfteverhältnis in seinem Rat: Hatte er 1227 noch zu
Ludwig I. gehalten (sowohl im Bistumsstreit als auch in der Braunschweiger Affäre),
vollzog er 1228 einen Kurswechsel/^ der letztlich dazu führte, dass sich der Wittelsbacher
Ende 1228 vom König zurückzog. Diesem Vorgang ist im folgenden Kapitel weiter
nachzugehen.
Ein, wenn auch nur schwaches Indiz für ein freundschaftliches Verhältnis von Mainz und
Magdeburg, die bei der Verleihung Lorschs in Form einer Magdeburger „Schützenhilfe"
für Siegfried wirksam geworden sein könnte, ergibt sich aus DOB II, Nr. 2461, wonach im
Dezember 1227 der Bruder des Magdeburger Erzbischofs, Graf Heinrich von Schwarzburg, zu
den Zeugen einer von Erzbischof Siegfried ausgestellten Urkunde zählte, die mit den Grafen
von Gleichen und Orlamünde weitere mainzische Klienten im mitteldeutschen Raum (und im
übrigen auch Landgraf Heinrich Raspe) nennt.
Siehe oben S. 197: Bischof Ekbert von Bamberg hatte sich 1227 beim Kaiser für die Belange des
von Mainz unterstützten, von Bayern befehdeten Regensburger Bischofskandidaten Siegfried
ausgesprochen.
^ Siehe dazu unten S. 220.
^ Anzeichen dieses Kurswechsels ist eben die Unterstützung der meranischen und mainzischen
Ansprüche in Bayern bzw. Lorsch. In der Literatur wird insbesondere bzgl. der Restitution
Heinrichs von Istrien die Rolle des Königs betont, der den Bayernherzog zum Einlenken ge-
zwungen habe, vgl. SriNDLER / KRAUS, Hb. d. bayrischen Geschichte II, S. 33 und, BoRCHARDT,
Der Aufstand, S. 58. Heinrich (VII.) habe hiermit die „altstaufische Polititk gegen das zu
mächtig werdende bayerische Herzogtum" fortgesetzt (Spindler). Auch bzgl. Lorsch gehen die
Überlegungen in der Literatur zumeist vom König aus, der den Pfalzgrafen habe „zernieren"
und nach Bayern ablenken wollen bzw. der sich so der Loyalität Erzbischof Siegfrieds im
Papst-Kaiser-KonRikt versicherte, vgl. GERLiCH, Könige, S. 117; REICHEL-MÜLLER, Mainzer
Territorialpolitik, S. 45f. Doch ist m.E. der Rückhalt, ja die Initiative der genannten Fürsten
sehr viel stärker mit in Rechnung zu stellen.