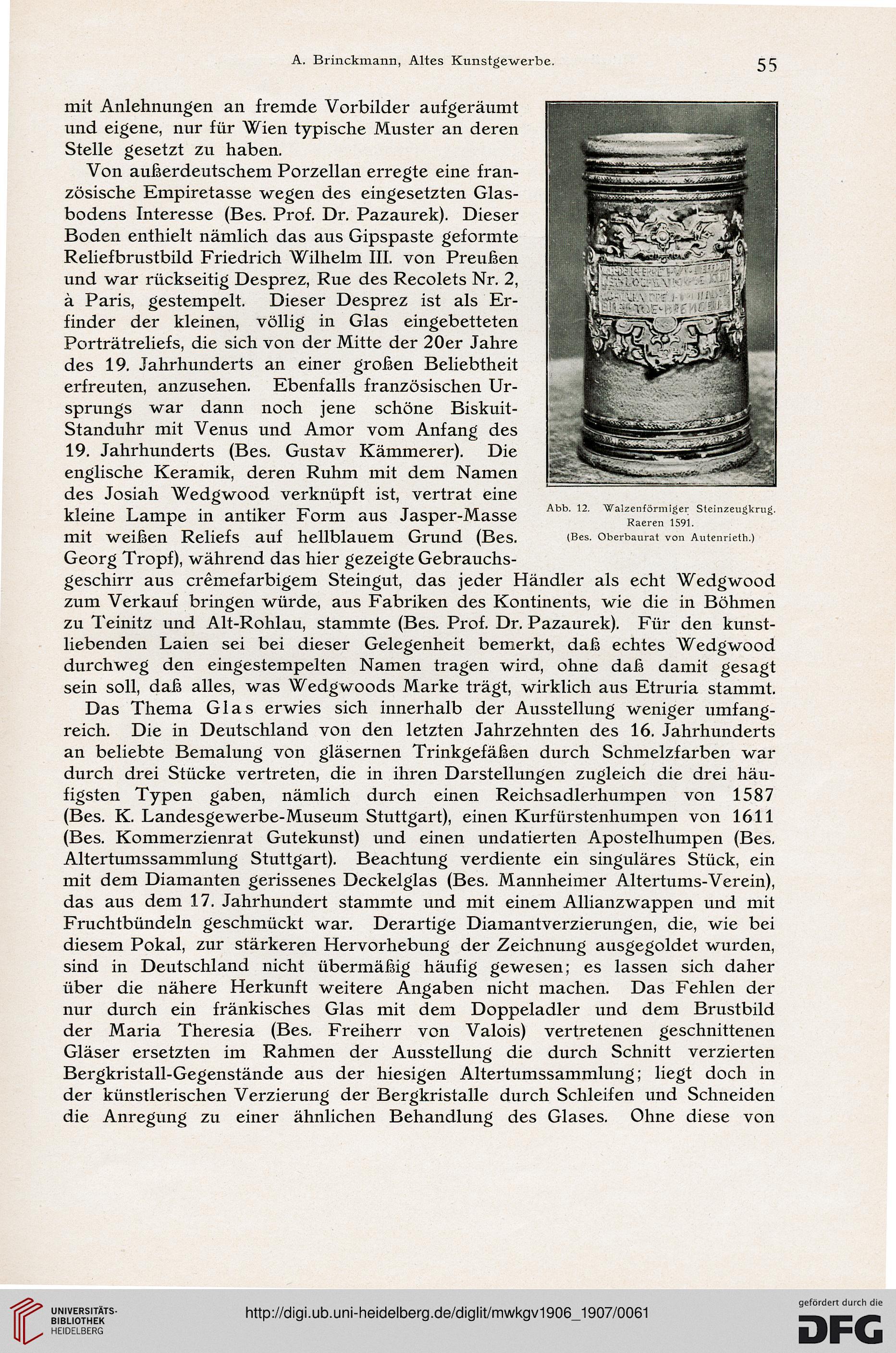A. Brinckmann, Altes Kunstgewerbe.
55
mit Anlehnungen an fremde Vorbilder aufgeräumt
und eigene, nur für Wien typische Muster an deren
Stelle gesetzt zu haben.
Von außerdeutschem Porzellan erregte eine fran-
zösische Empiretasse wegen des eingesetzten Glas-
bodens Interesse (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Dieser
Boden enthielt nämlich das aus Gipspaste geformte
Reliefbrustbild Friedrich Wilhelm III. von Preußen
und war rückseitig Desprez, Rue des Recolets Nr. 2,
ä Paris, gestempelt. Dieser Desprez ist als Er-
finder der kleinen, völlig in Glas eingebetteten
Porträtreliefs, die sich von der Mitte der 20er Jahre
des 19. Jahrhunderts an einer großen Beliebtheit
erfreuten, anzusehen. Ebenfalls französischen Ur-
sprungs war dann noch jene schöne Biskuit-
Standuhr mit Venus und Amor vom Anfang des
19. Jahrhunderts (Bes. Gustav Kämmerer). Die
englische Keramik, deren Ruhm mit dem Namen
des Josiah Wedgwood verknüpft ist, vertrat eine
kleine Lampe in antiker Form aus Jasper-Masse
mit weißen Reliefs auf hellblauem Grund (Bes.
Georg Tropf), während das hier gezeigte Gebrauchs-
geschirr aus cremefarbigem Steingut, das jeder Händler als echt Wedgwood
zum Verkauf bringen würde, aus Fabriken des Kontinents, wie die in Böhmen
zu Teinitz und Alt-Rohlau, stammte (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Für den kunst-
liebenden Laien sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß echtes Wedgwood
durchweg den eingestempelten Namen tragen wird, ohne daß damit gesagt
sein soll, daß alles, was Wedgwoods Marke trägt, wirklich aus Etruria stammt.
Das Thema Glas erwies sich innerhalb der Ausstellung weniger umfang-
reich. Die in Deutschland von den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
an beliebte Bemalung von gläsernen Trinkgefäßen durch Schmelzfarben war
durch drei Stücke vertreten, die in ihren Darstellungen zugleich die drei häu-
figsten Typen gaben, nämlich durch einen Reichsadlerhumpen von 1587
(Bes. K. Landesgewerbe-Museum Stuttgart), einen Kurfürstenhumpen von 1611
(Bes. Kommerzienrat Gutekunst) und einen undatierten Apostelhumpen (Bes.
Altertumssammlung Stuttgart). Beachtung verdiente ein singuläres Stück, ein
mit dem Diamanten gerissenes Deckelglas (Bes. Mannheimer Altertums-Verein),
das aus dem 17. Jahrhundert stammte und mit einem Allianzwappen und mit
Fruchtbündeln geschmückt war. Derartige Diamantverzierungen, die, wie bei
diesem Pokal, zur stärkeren Hervorhebung der Zeichnung ausgegoldet wurden,
sind in Deutschland nicht übermäßig häufig gewesen; es lassen sich daher
über die nähere Herkunft weitere Angaben nicht machen. Das Fehlen der
nur durch ein fränkisches Glas mit dem Doppeladler und dem Brustbild
der Maria Theresia (Bes. Freiherr von Valois) vertretenen geschnittenen
Gläser ersetzten im Rahmen der Ausstellung die durch Schnitt verzierten
Bergkristall-Gegenstände aus der hiesigen Altertumssammlung; liegt doch in
der künstlerischen Verzierung der Bergkristalle durch Schleifen und Schneiden
die Anregung zu einer ähnlichen Behandlung des Glases. Ohne diese von
Abb. 12. "Walzenförmiger Stcinzeugkrug.
Raeren 1591.
(Bes. Oberbaurat von Autenrieth.)
55
mit Anlehnungen an fremde Vorbilder aufgeräumt
und eigene, nur für Wien typische Muster an deren
Stelle gesetzt zu haben.
Von außerdeutschem Porzellan erregte eine fran-
zösische Empiretasse wegen des eingesetzten Glas-
bodens Interesse (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Dieser
Boden enthielt nämlich das aus Gipspaste geformte
Reliefbrustbild Friedrich Wilhelm III. von Preußen
und war rückseitig Desprez, Rue des Recolets Nr. 2,
ä Paris, gestempelt. Dieser Desprez ist als Er-
finder der kleinen, völlig in Glas eingebetteten
Porträtreliefs, die sich von der Mitte der 20er Jahre
des 19. Jahrhunderts an einer großen Beliebtheit
erfreuten, anzusehen. Ebenfalls französischen Ur-
sprungs war dann noch jene schöne Biskuit-
Standuhr mit Venus und Amor vom Anfang des
19. Jahrhunderts (Bes. Gustav Kämmerer). Die
englische Keramik, deren Ruhm mit dem Namen
des Josiah Wedgwood verknüpft ist, vertrat eine
kleine Lampe in antiker Form aus Jasper-Masse
mit weißen Reliefs auf hellblauem Grund (Bes.
Georg Tropf), während das hier gezeigte Gebrauchs-
geschirr aus cremefarbigem Steingut, das jeder Händler als echt Wedgwood
zum Verkauf bringen würde, aus Fabriken des Kontinents, wie die in Böhmen
zu Teinitz und Alt-Rohlau, stammte (Bes. Prof. Dr. Pazaurek). Für den kunst-
liebenden Laien sei bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß echtes Wedgwood
durchweg den eingestempelten Namen tragen wird, ohne daß damit gesagt
sein soll, daß alles, was Wedgwoods Marke trägt, wirklich aus Etruria stammt.
Das Thema Glas erwies sich innerhalb der Ausstellung weniger umfang-
reich. Die in Deutschland von den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
an beliebte Bemalung von gläsernen Trinkgefäßen durch Schmelzfarben war
durch drei Stücke vertreten, die in ihren Darstellungen zugleich die drei häu-
figsten Typen gaben, nämlich durch einen Reichsadlerhumpen von 1587
(Bes. K. Landesgewerbe-Museum Stuttgart), einen Kurfürstenhumpen von 1611
(Bes. Kommerzienrat Gutekunst) und einen undatierten Apostelhumpen (Bes.
Altertumssammlung Stuttgart). Beachtung verdiente ein singuläres Stück, ein
mit dem Diamanten gerissenes Deckelglas (Bes. Mannheimer Altertums-Verein),
das aus dem 17. Jahrhundert stammte und mit einem Allianzwappen und mit
Fruchtbündeln geschmückt war. Derartige Diamantverzierungen, die, wie bei
diesem Pokal, zur stärkeren Hervorhebung der Zeichnung ausgegoldet wurden,
sind in Deutschland nicht übermäßig häufig gewesen; es lassen sich daher
über die nähere Herkunft weitere Angaben nicht machen. Das Fehlen der
nur durch ein fränkisches Glas mit dem Doppeladler und dem Brustbild
der Maria Theresia (Bes. Freiherr von Valois) vertretenen geschnittenen
Gläser ersetzten im Rahmen der Ausstellung die durch Schnitt verzierten
Bergkristall-Gegenstände aus der hiesigen Altertumssammlung; liegt doch in
der künstlerischen Verzierung der Bergkristalle durch Schleifen und Schneiden
die Anregung zu einer ähnlichen Behandlung des Glases. Ohne diese von
Abb. 12. "Walzenförmiger Stcinzeugkrug.
Raeren 1591.
(Bes. Oberbaurat von Autenrieth.)