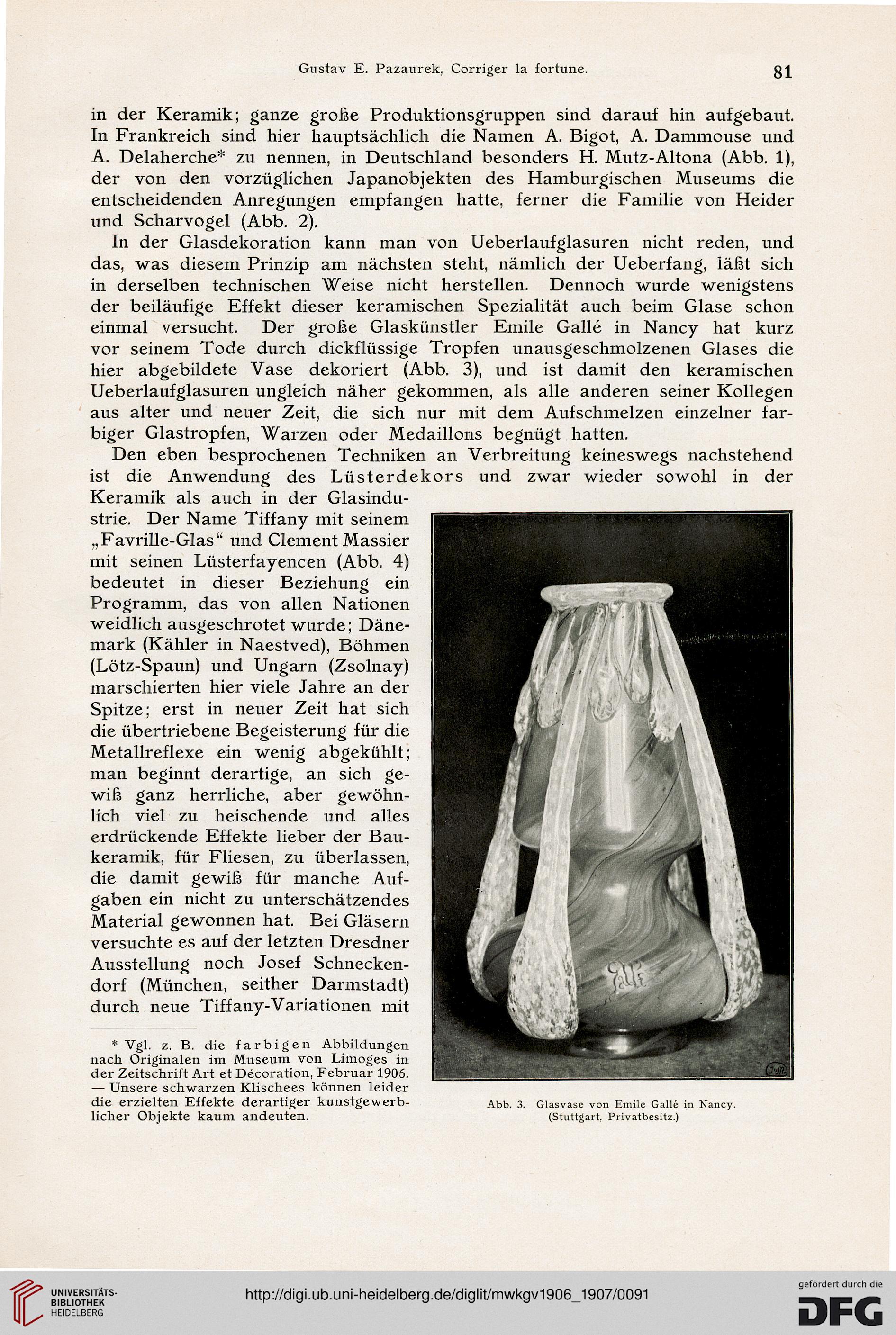Gustav E. Pazaurek, Corriger la fortune.
81
in der Keramik; ganze große Produktionsgruppen sind darauf hin aufgebaut.
In Frankreich sind hier hauptsächlich die Namen A. Bigot, A. Dammouse und
A. Delaherche* zu nennen, in Deutschland besonders H. Mutz-Altona (Abb. 1),
der von den vorzüglichen Japanobjekten des Hamburgischen Museums die
entscheidenden Anregungen empfangen hatte, ferner die Familie von Heider
und Scharvogel (Abb. 2).
In der Glasdekoration kann man von Ueberlaufglasuren nicht reden, und
das, was diesem Prinzip am nächsten steht, nämlich der Ueberfang, läßt sich
in derselben technischen Weise nicht herstellen. Dennoch wurde wenigstens
der beiläufige Effekt dieser keramischen Spezialität auch beim Glase schon
einmal versucht. Der große Glaskünstler Emile Galle in Nancy hat kurz
vor seinem Tode durch dickflüssige Tropfen unausgeschmolzenen Glases die
hier abgebildete Vase dekoriert (Abb. 3), und ist damit den keramischen
Ueberlaufglasuren ungleich näher gekommen, als alle anderen seiner Kollegen
aus alter und neuer Zeit, die sich nur mit dem Aufschmelzen einzelner far-
biger Glastropfen, Warzen oder Medaillons begnügt hatten.
Den eben besprochenen Techniken an Verbreitung keineswegs nachstehend
ist die Anwendung des Lüsterdekors und zwar wieder sowohl in der
Keramik als auch in der Glasindu-
strie. Der Name Tiffany mit seinem
..Favrille-Glas'' und Clement Massier
mit seinen Lüsterfayencen (Abb. 4)
bedeutet in dieser Beziehung ein
Programm, das von allen Nationen
weidlich ausgeschrotet wurde; Däne-
mark (Kähler in Naestved), Böhmen
(Lötz-Spaun) und Ungarn (Zsolnay)
marschierten hier viele Jahre an der
Spitze; erst in neuer Zeit hat sich
die übertriebene Begeisterung für die
Metallreflexe ein wenig abgekühlt;
man beginnt derartige, an sich ge-
wiß ganz herrliche, aber gewöhn-
lich viel zu heischende und alles
erdrückende Effekte lieber der Bau-
keramik, für Fliesen, zu überlassen,
die damit gewiß für manche Auf-
gaben ein nicht zu unterschätzendes
Material gewonnen hat. Bei Gläsern
versuchte es auf der letzten Dresdner
Ausstellung noch Josef Schnecken-
dorf (München, seither Darmstadt)
durch neue Tiffany-Variationen mit
* Vgl. z. B. die farbigen Abbildungen
nach Originalen im Museum von Limoges in
der Zeitschrift Art et Decoration, Februar 1906.
— Unsere schwarzen Klischees können leider
die erzielten Effekte derartiger kunstgewerb- Abb. 3. Glas vase von Emile Galle in Nancy,
lieber Objekte kaum andeuten. (Stuttgart. Privatbesitz.)
81
in der Keramik; ganze große Produktionsgruppen sind darauf hin aufgebaut.
In Frankreich sind hier hauptsächlich die Namen A. Bigot, A. Dammouse und
A. Delaherche* zu nennen, in Deutschland besonders H. Mutz-Altona (Abb. 1),
der von den vorzüglichen Japanobjekten des Hamburgischen Museums die
entscheidenden Anregungen empfangen hatte, ferner die Familie von Heider
und Scharvogel (Abb. 2).
In der Glasdekoration kann man von Ueberlaufglasuren nicht reden, und
das, was diesem Prinzip am nächsten steht, nämlich der Ueberfang, läßt sich
in derselben technischen Weise nicht herstellen. Dennoch wurde wenigstens
der beiläufige Effekt dieser keramischen Spezialität auch beim Glase schon
einmal versucht. Der große Glaskünstler Emile Galle in Nancy hat kurz
vor seinem Tode durch dickflüssige Tropfen unausgeschmolzenen Glases die
hier abgebildete Vase dekoriert (Abb. 3), und ist damit den keramischen
Ueberlaufglasuren ungleich näher gekommen, als alle anderen seiner Kollegen
aus alter und neuer Zeit, die sich nur mit dem Aufschmelzen einzelner far-
biger Glastropfen, Warzen oder Medaillons begnügt hatten.
Den eben besprochenen Techniken an Verbreitung keineswegs nachstehend
ist die Anwendung des Lüsterdekors und zwar wieder sowohl in der
Keramik als auch in der Glasindu-
strie. Der Name Tiffany mit seinem
..Favrille-Glas'' und Clement Massier
mit seinen Lüsterfayencen (Abb. 4)
bedeutet in dieser Beziehung ein
Programm, das von allen Nationen
weidlich ausgeschrotet wurde; Däne-
mark (Kähler in Naestved), Böhmen
(Lötz-Spaun) und Ungarn (Zsolnay)
marschierten hier viele Jahre an der
Spitze; erst in neuer Zeit hat sich
die übertriebene Begeisterung für die
Metallreflexe ein wenig abgekühlt;
man beginnt derartige, an sich ge-
wiß ganz herrliche, aber gewöhn-
lich viel zu heischende und alles
erdrückende Effekte lieber der Bau-
keramik, für Fliesen, zu überlassen,
die damit gewiß für manche Auf-
gaben ein nicht zu unterschätzendes
Material gewonnen hat. Bei Gläsern
versuchte es auf der letzten Dresdner
Ausstellung noch Josef Schnecken-
dorf (München, seither Darmstadt)
durch neue Tiffany-Variationen mit
* Vgl. z. B. die farbigen Abbildungen
nach Originalen im Museum von Limoges in
der Zeitschrift Art et Decoration, Februar 1906.
— Unsere schwarzen Klischees können leider
die erzielten Effekte derartiger kunstgewerb- Abb. 3. Glas vase von Emile Galle in Nancy,
lieber Objekte kaum andeuten. (Stuttgart. Privatbesitz.)