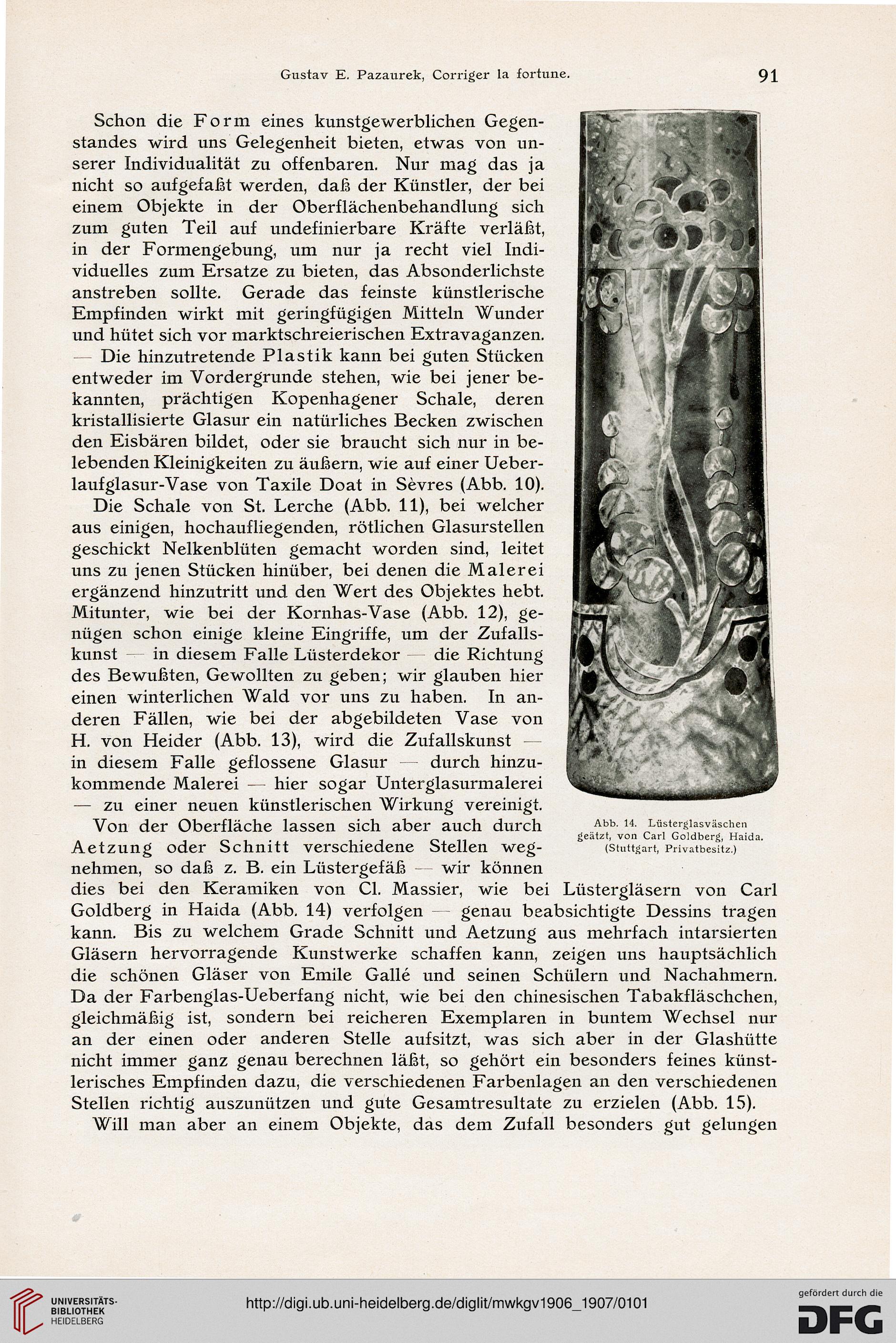Gustav E. Pazaurek, Corriger la fortune.
91
Schon die Form eines kunstgewerblichen Gegen-
standes wird uns Gelegenheit bieten, etwas von un-
serer Individualität zu offenbaren. Nur mag das ja
nicht so aufgefaßt werden, daß der Künstler, der bei
einem Objekte in der Oberflächenbehandlung sich
zum guten Teil auf undefinierbare Kräfte verläßt,
in der Formengebung, um nur ja recht viel Indi-
viduelles zum Ersätze zu bieten, das Absonderlichste
anstreben sollte. Gerade das feinste künstlerische
Empfinden wirkt mit geringfügigen Mitteln Wunder
und hütet sich vor marktschreierischen Extravaganzen.
Die hinzutretende Plastik kann bei guten Stücken
entweder im Vordergrunde stehen, wie bei jener be-
kannten, prächtigen Kopenhagener Schale, deren
kristallisierte Glasur ein natürliches Becken zwischen
den Eisbären bildet, oder sie braucht sich nur in be-
lebenden Kleinigkeiten zu äußern, wie auf einer Ueber-
laufglasur-Vase von Taxile Doat in Sevres (Abb. 10).
Die Schale von St. Lerche (Abb. 11), bei welcher
aus einigen, hochaufliegenden, rötlichen Glasurstellen
geschickt Nelkenblüten gemacht worden sind, leitet
uns zu jenen Stücken hinüber, bei denen die Malerei
ergänzend hinzutritt und den Wert des Objektes hebt.
Mitunter, wie bei der Kornhas-Vase (Abb. 12), ge-
nügen schon einige kleine Eingriffe, um der Zufalls-
kunst in diesem Falle Lüsterdekor die Richtung
des Bewußten, Gewollten zu geben; wir glauben hier
einen winterlichen Wald vor uns zu haben. In an-
deren Fällen, wie bei der abgebildeten Vase von
H. von Heider (Abb. 13), wird die Zufallskunst
in diesem Falle geflossene Glasur durch hinzu-
kommende Malerei - hier sogar Unterglasurmalerei
— zu einer neuen künstlerischen Wirkung vereinigt.
Von der Oberfläche lassen sich aber auch durch
Aetzung oder Schnitt verschiedene Stellen weg-
nehmen, so daß z. B. ein Lüstergefäß wir können
dies bei den Keramiken von Cl. Massier, wie bei Lüstergläsern von Carl
Goldberg in Haida (Abb. 14) verfolgen genau beabsichtigte Dessins tragen
kann. Bis zu welchem Grade Schnitt und Aetzung aus mehrfach intarsierten
Gläsern hervorragende Kunstwerke schaffen kann, zeigen uns hauptsächlich
die schönen Gläser von Emile Galle und seinen Schülern und Nachahmern.
Da der Farbenglas-Ueberfang nicht, wie bei den chinesischen Tabakfläschchen,
gleichmäßig ist, sondern bei reicheren Exemplaren in buntem Wechsel nur
an der einen oder anderen Stelle aufsitzt, was sich aber in der Glashütte
nicht immer ganz genau berechnen läßt, so gehört ein besonders feines künst-
lerisches Empfinden dazu, die verschiedenen Farbenlagen an den verschiedenen
Stellen richtig auszunützen und gute Gesamtresultate zu erzielen (Abb. 15).
Will man aber an einem Objekte, das dem Zufall besonders gut gelungen
Abb. 14. Lüsterglasväschen
geätzt, von Carl Goldberg, Haida.
(Stuttgart, Privatbesitz.)
91
Schon die Form eines kunstgewerblichen Gegen-
standes wird uns Gelegenheit bieten, etwas von un-
serer Individualität zu offenbaren. Nur mag das ja
nicht so aufgefaßt werden, daß der Künstler, der bei
einem Objekte in der Oberflächenbehandlung sich
zum guten Teil auf undefinierbare Kräfte verläßt,
in der Formengebung, um nur ja recht viel Indi-
viduelles zum Ersätze zu bieten, das Absonderlichste
anstreben sollte. Gerade das feinste künstlerische
Empfinden wirkt mit geringfügigen Mitteln Wunder
und hütet sich vor marktschreierischen Extravaganzen.
Die hinzutretende Plastik kann bei guten Stücken
entweder im Vordergrunde stehen, wie bei jener be-
kannten, prächtigen Kopenhagener Schale, deren
kristallisierte Glasur ein natürliches Becken zwischen
den Eisbären bildet, oder sie braucht sich nur in be-
lebenden Kleinigkeiten zu äußern, wie auf einer Ueber-
laufglasur-Vase von Taxile Doat in Sevres (Abb. 10).
Die Schale von St. Lerche (Abb. 11), bei welcher
aus einigen, hochaufliegenden, rötlichen Glasurstellen
geschickt Nelkenblüten gemacht worden sind, leitet
uns zu jenen Stücken hinüber, bei denen die Malerei
ergänzend hinzutritt und den Wert des Objektes hebt.
Mitunter, wie bei der Kornhas-Vase (Abb. 12), ge-
nügen schon einige kleine Eingriffe, um der Zufalls-
kunst in diesem Falle Lüsterdekor die Richtung
des Bewußten, Gewollten zu geben; wir glauben hier
einen winterlichen Wald vor uns zu haben. In an-
deren Fällen, wie bei der abgebildeten Vase von
H. von Heider (Abb. 13), wird die Zufallskunst
in diesem Falle geflossene Glasur durch hinzu-
kommende Malerei - hier sogar Unterglasurmalerei
— zu einer neuen künstlerischen Wirkung vereinigt.
Von der Oberfläche lassen sich aber auch durch
Aetzung oder Schnitt verschiedene Stellen weg-
nehmen, so daß z. B. ein Lüstergefäß wir können
dies bei den Keramiken von Cl. Massier, wie bei Lüstergläsern von Carl
Goldberg in Haida (Abb. 14) verfolgen genau beabsichtigte Dessins tragen
kann. Bis zu welchem Grade Schnitt und Aetzung aus mehrfach intarsierten
Gläsern hervorragende Kunstwerke schaffen kann, zeigen uns hauptsächlich
die schönen Gläser von Emile Galle und seinen Schülern und Nachahmern.
Da der Farbenglas-Ueberfang nicht, wie bei den chinesischen Tabakfläschchen,
gleichmäßig ist, sondern bei reicheren Exemplaren in buntem Wechsel nur
an der einen oder anderen Stelle aufsitzt, was sich aber in der Glashütte
nicht immer ganz genau berechnen läßt, so gehört ein besonders feines künst-
lerisches Empfinden dazu, die verschiedenen Farbenlagen an den verschiedenen
Stellen richtig auszunützen und gute Gesamtresultate zu erzielen (Abb. 15).
Will man aber an einem Objekte, das dem Zufall besonders gut gelungen
Abb. 14. Lüsterglasväschen
geätzt, von Carl Goldberg, Haida.
(Stuttgart, Privatbesitz.)