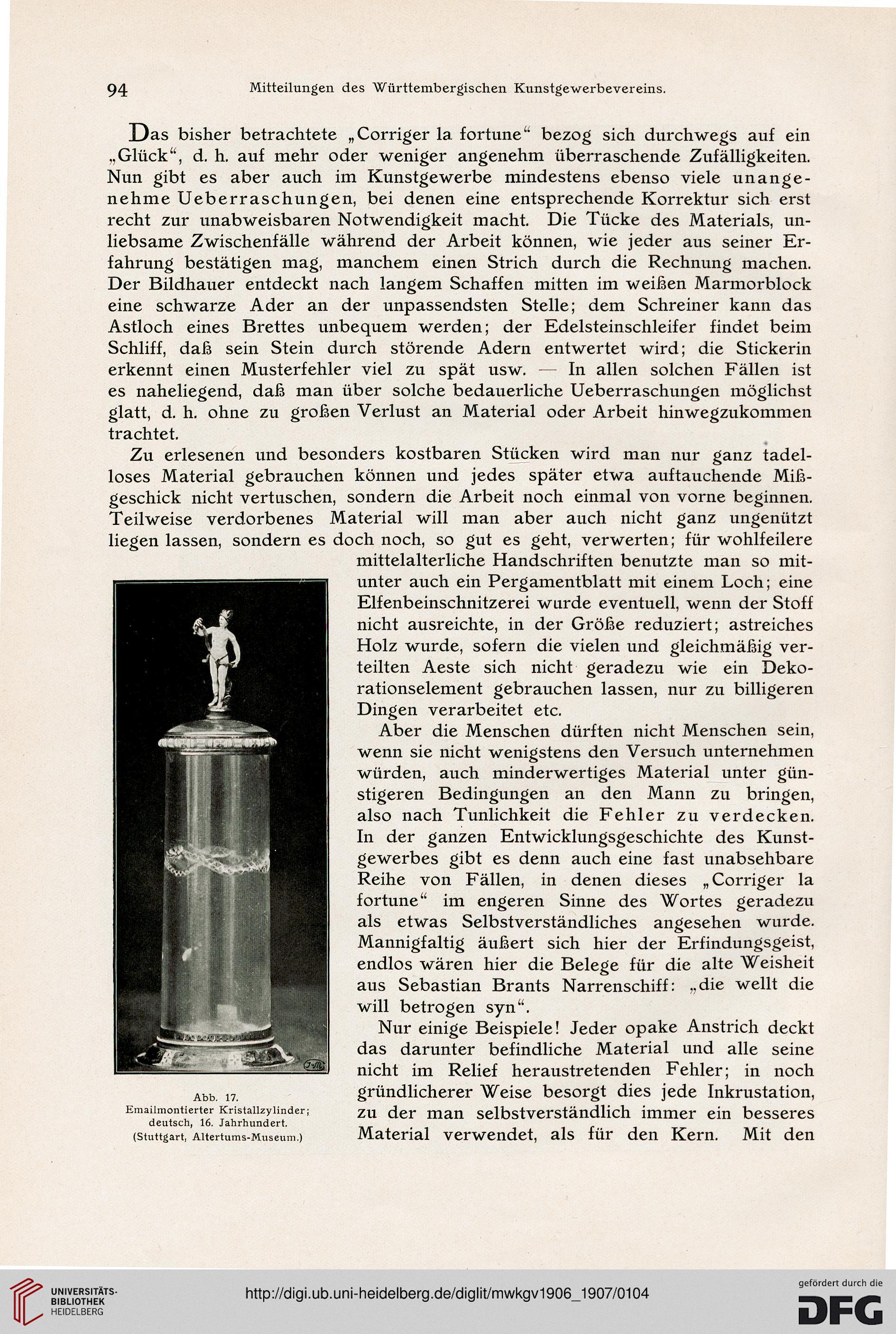94
Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.
Das bisher betrachtete „Corriger la fortune" bezog sich durchwegs auf ein
..Glück", d. h. auf mehr oder weniger angenehm überraschende Zufälligkeiten.
Nun gibt es aber auch im Kunstgewerbe mindestens ebenso viele unange-
nehme Ueberraschungen, bei denen eine entsprechende Korrektur sich erst
recht zur unabweisbaren Notwendigkeit macht. Die Tücke des Materials, un-
liebsame Zwischenfälle während der Arbeit können, wie jeder aus seiner Er-
fahrung bestätigen mag, manchem einen Strich durch die Rechnung machen.
Der Bildhauer entdeckt nach langem Schaffen mitten im weißen Marmorblock
eine schwarze Ader an der unpassendsten Stelle; dem Schreiner kann das
Astloch eines Brettes unbequem werden; der Edelsteinschleifer findet beim
Schliff, daß sein Stein durch störende Adern entwertet wird; die Stickerin
erkennt einen Musterfehler viel zu spät usw. - In allen solchen Fällen ist
es naheliegend, daß man über solche bedauerliche Ueberraschungen möglichst
glatt, d. h. ohne zu großen Verlust an Material oder Arbeit hinwegzukommen
trachtet.
Zu erlesenen und besonders kostbaren Stücken wird man nur ganz tadel-
loses Material gebrauchen können und jedes später etwa auftauchende Miß-
geschick nicht vertuschen, sondern die Arbeit noch einmal von vorne beginnen.
Teilweise verdorbenes Material will man aber auch nicht ganz ungenützt
liegen lassen, sondern es doch noch, so gut es geht, verwerten; für wohlfeilere
mittelalterliche Handschriften benutzte man so mit-
unter auch ein Pergamentblatt mit einem Loch; eine
Elfenbeinschnitzerei wurde eventuell, wenn der Stoff
nicht ausreichte, in der Größe reduziert; astreiches
Holz wurde, sofern die vielen und gleichmäßig ver-
teilten Aeste sich nicht geradezu wie ein Deko-
rationselement gebrauchen lassen, nur zu billigeren
Dingen verarbeitet etc.
Aber die Menschen dürften nicht Menschen sein,
wenn sie nicht wenigstens den Versuch unternehmen
würden, auch minderwertiges Material unter gün-
stigeren Bedingungen an den Mann zu bringen,
also nach Tunlichkeit die Fehler zu verdecken.
In der ganzen Entwicklungsgeschichte des Kunst-
gewerbes gibt es denn auch eine fast unabsehbare
Reihe von Fällen, in denen dieses „Corriger la
fortune" im engeren Sinne des Wortes geradezu
als etwas Selbstverständliches angesehen wurde.
Mannigfaltig äußert sich hier der Erfindungsgeist,
endlos wären hier die Belege für die alte Weisheit
aus Sebastian Brants Narrenschiff: ..die wellt die
will betrogen syn".
Nur einige Beispiele! Jeder opake Anstrich deckt
das darunter befindliche Material und alle seine
nicht im Relief heraustretenden Fehler; in noch
Abb i7 gründlicherer Weise besorgt dies jede Inkrustation,
Emaiimontierter Kristaiizyiinder; zu der man selbstverständlich immer ein besseres
deutsch, 16. Jahrhundert.
(Stuttgart, Aitertums-Museum.) Material verwendet, als für den Kern. Mit den
Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.
Das bisher betrachtete „Corriger la fortune" bezog sich durchwegs auf ein
..Glück", d. h. auf mehr oder weniger angenehm überraschende Zufälligkeiten.
Nun gibt es aber auch im Kunstgewerbe mindestens ebenso viele unange-
nehme Ueberraschungen, bei denen eine entsprechende Korrektur sich erst
recht zur unabweisbaren Notwendigkeit macht. Die Tücke des Materials, un-
liebsame Zwischenfälle während der Arbeit können, wie jeder aus seiner Er-
fahrung bestätigen mag, manchem einen Strich durch die Rechnung machen.
Der Bildhauer entdeckt nach langem Schaffen mitten im weißen Marmorblock
eine schwarze Ader an der unpassendsten Stelle; dem Schreiner kann das
Astloch eines Brettes unbequem werden; der Edelsteinschleifer findet beim
Schliff, daß sein Stein durch störende Adern entwertet wird; die Stickerin
erkennt einen Musterfehler viel zu spät usw. - In allen solchen Fällen ist
es naheliegend, daß man über solche bedauerliche Ueberraschungen möglichst
glatt, d. h. ohne zu großen Verlust an Material oder Arbeit hinwegzukommen
trachtet.
Zu erlesenen und besonders kostbaren Stücken wird man nur ganz tadel-
loses Material gebrauchen können und jedes später etwa auftauchende Miß-
geschick nicht vertuschen, sondern die Arbeit noch einmal von vorne beginnen.
Teilweise verdorbenes Material will man aber auch nicht ganz ungenützt
liegen lassen, sondern es doch noch, so gut es geht, verwerten; für wohlfeilere
mittelalterliche Handschriften benutzte man so mit-
unter auch ein Pergamentblatt mit einem Loch; eine
Elfenbeinschnitzerei wurde eventuell, wenn der Stoff
nicht ausreichte, in der Größe reduziert; astreiches
Holz wurde, sofern die vielen und gleichmäßig ver-
teilten Aeste sich nicht geradezu wie ein Deko-
rationselement gebrauchen lassen, nur zu billigeren
Dingen verarbeitet etc.
Aber die Menschen dürften nicht Menschen sein,
wenn sie nicht wenigstens den Versuch unternehmen
würden, auch minderwertiges Material unter gün-
stigeren Bedingungen an den Mann zu bringen,
also nach Tunlichkeit die Fehler zu verdecken.
In der ganzen Entwicklungsgeschichte des Kunst-
gewerbes gibt es denn auch eine fast unabsehbare
Reihe von Fällen, in denen dieses „Corriger la
fortune" im engeren Sinne des Wortes geradezu
als etwas Selbstverständliches angesehen wurde.
Mannigfaltig äußert sich hier der Erfindungsgeist,
endlos wären hier die Belege für die alte Weisheit
aus Sebastian Brants Narrenschiff: ..die wellt die
will betrogen syn".
Nur einige Beispiele! Jeder opake Anstrich deckt
das darunter befindliche Material und alle seine
nicht im Relief heraustretenden Fehler; in noch
Abb i7 gründlicherer Weise besorgt dies jede Inkrustation,
Emaiimontierter Kristaiizyiinder; zu der man selbstverständlich immer ein besseres
deutsch, 16. Jahrhundert.
(Stuttgart, Aitertums-Museum.) Material verwendet, als für den Kern. Mit den