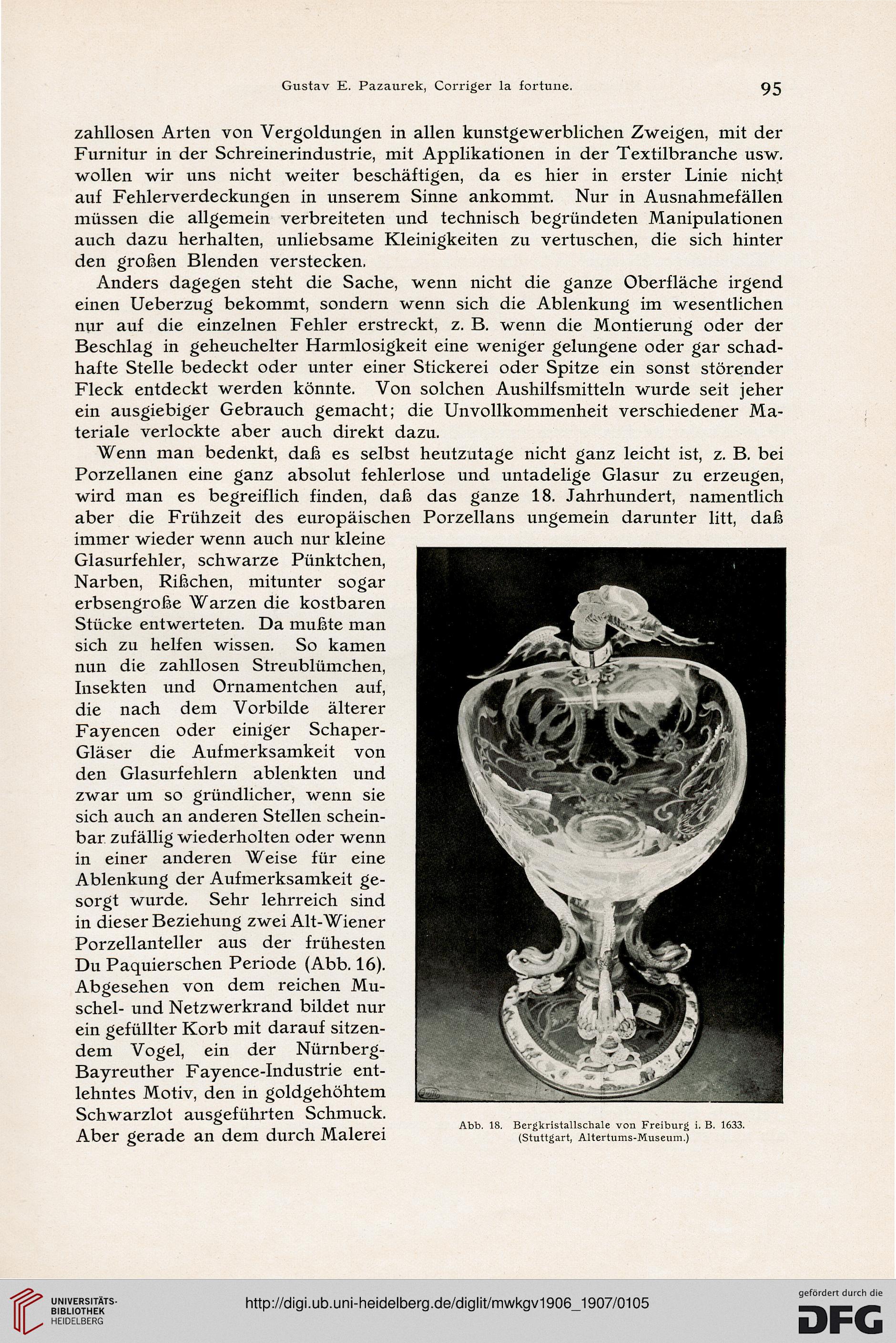Gustav E. Pazaurek, Corriger la fortune.
95
zahllosen Arten von Vergoldungen in allen kunstgewerblichen Zweigen, mit der
Furnitur in der Schreinerindustrie, mit Applikationen in der Textilbranche usw.
wollen wir uns nicht weiter beschäftigen, da es hier in erster Linie nicht
auf Fehlerverdeckungen in unserem Sinne ankommt. Nur in Ausnahmefällen
müssen die allgemein verbreiteten und technisch begründeten Manipulationen
auch dazu herhalten, unliebsame Kleinigkeiten zu vertuschen, die sich hinter
den großen Blenden verstecken.
Anders dagegen steht die Sache, wenn nicht die ganze Oberfläche irgend
einen Ueberzug bekommt, sondern wenn sich die Ablenkung im wesentlichen
nur auf die einzelnen Fehler erstreckt, z. B. wenn die Montierung oder der
Beschlag in geheuchelter Harmlosigkeit eine weniger gelungene oder gar schad-
hafte Stelle bedeckt oder unter einer Stickerei oder Spitze ein sonst störender
Fleck entdeckt werden könnte. Von solchen Aushilfsmitteln wurde seit jeher
ein ausgiebiger Gebrauch gemacht; die Unvollkommenheit verschiedener Ma-
teriale verlockte aber auch direkt dazu.
Wenn man bedenkt, daß es selbst heutzutage nicht ganz leicht ist, z. B. bei
Porzellanen eine ganz absolut fehlerlose und untadelige Glasur zu erzeugen,
wird man es begreiflich finden, daß das ganze 18. Jahrhundert, namentlich
aber die Frühzeit des europäischen Porzellans ungemein darunter litt, daß
immer wieder wenn auch nur kleine
Glasurfehler, schwarze Pünktchen,
Narben, Rißchen, mitunter sogar
erbsengroße Warzen die kostbaren
Stücke entwerteten. Da mußte man
sich zu helfen wissen. So kamen
nun die zahllosen Streublümchen,
Insekten und Ornamentchen auf,
die nach dem Vorbilde älterer
Fayencen oder einiger Schaper-
Gläser die Aufmerksamkeit von
den Glasurfehlern ablenkten und
zwar um so gründlicher, wenn sie
sich auch an anderen Stellen schein-
bar zufällig wiederholten oder wenn
in einer anderen Weise für eine
Ablenkung der Aufmerksamkeit ge-
sorgt wurde. Sehr lehrreich sind
in dieser Beziehung zwei Alt-Wiener
Porzellanteller aus der frühesten
Du Paquierschen Periode (Abb. 16).
Abgesehen von dem reichen Mu-
schel- und Netzwerkrand bildet nur
ein gefüllter Korb mit darauf sitzen-
dem Vogel, ein der Nürnberg-
Bayreuther Fayence-Industrie ent-
lehntes Motiv, den in goldgehöhtem
Schwarzlot ausgeführten Schmuck.
ö . . Abb. 18. Bergkristallschale von Freiburg i. B. 1633.
Aber gerade an dem durch Malerei (Stuttgart, Aitertums-Museum.)
95
zahllosen Arten von Vergoldungen in allen kunstgewerblichen Zweigen, mit der
Furnitur in der Schreinerindustrie, mit Applikationen in der Textilbranche usw.
wollen wir uns nicht weiter beschäftigen, da es hier in erster Linie nicht
auf Fehlerverdeckungen in unserem Sinne ankommt. Nur in Ausnahmefällen
müssen die allgemein verbreiteten und technisch begründeten Manipulationen
auch dazu herhalten, unliebsame Kleinigkeiten zu vertuschen, die sich hinter
den großen Blenden verstecken.
Anders dagegen steht die Sache, wenn nicht die ganze Oberfläche irgend
einen Ueberzug bekommt, sondern wenn sich die Ablenkung im wesentlichen
nur auf die einzelnen Fehler erstreckt, z. B. wenn die Montierung oder der
Beschlag in geheuchelter Harmlosigkeit eine weniger gelungene oder gar schad-
hafte Stelle bedeckt oder unter einer Stickerei oder Spitze ein sonst störender
Fleck entdeckt werden könnte. Von solchen Aushilfsmitteln wurde seit jeher
ein ausgiebiger Gebrauch gemacht; die Unvollkommenheit verschiedener Ma-
teriale verlockte aber auch direkt dazu.
Wenn man bedenkt, daß es selbst heutzutage nicht ganz leicht ist, z. B. bei
Porzellanen eine ganz absolut fehlerlose und untadelige Glasur zu erzeugen,
wird man es begreiflich finden, daß das ganze 18. Jahrhundert, namentlich
aber die Frühzeit des europäischen Porzellans ungemein darunter litt, daß
immer wieder wenn auch nur kleine
Glasurfehler, schwarze Pünktchen,
Narben, Rißchen, mitunter sogar
erbsengroße Warzen die kostbaren
Stücke entwerteten. Da mußte man
sich zu helfen wissen. So kamen
nun die zahllosen Streublümchen,
Insekten und Ornamentchen auf,
die nach dem Vorbilde älterer
Fayencen oder einiger Schaper-
Gläser die Aufmerksamkeit von
den Glasurfehlern ablenkten und
zwar um so gründlicher, wenn sie
sich auch an anderen Stellen schein-
bar zufällig wiederholten oder wenn
in einer anderen Weise für eine
Ablenkung der Aufmerksamkeit ge-
sorgt wurde. Sehr lehrreich sind
in dieser Beziehung zwei Alt-Wiener
Porzellanteller aus der frühesten
Du Paquierschen Periode (Abb. 16).
Abgesehen von dem reichen Mu-
schel- und Netzwerkrand bildet nur
ein gefüllter Korb mit darauf sitzen-
dem Vogel, ein der Nürnberg-
Bayreuther Fayence-Industrie ent-
lehntes Motiv, den in goldgehöhtem
Schwarzlot ausgeführten Schmuck.
ö . . Abb. 18. Bergkristallschale von Freiburg i. B. 1633.
Aber gerade an dem durch Malerei (Stuttgart, Aitertums-Museum.)