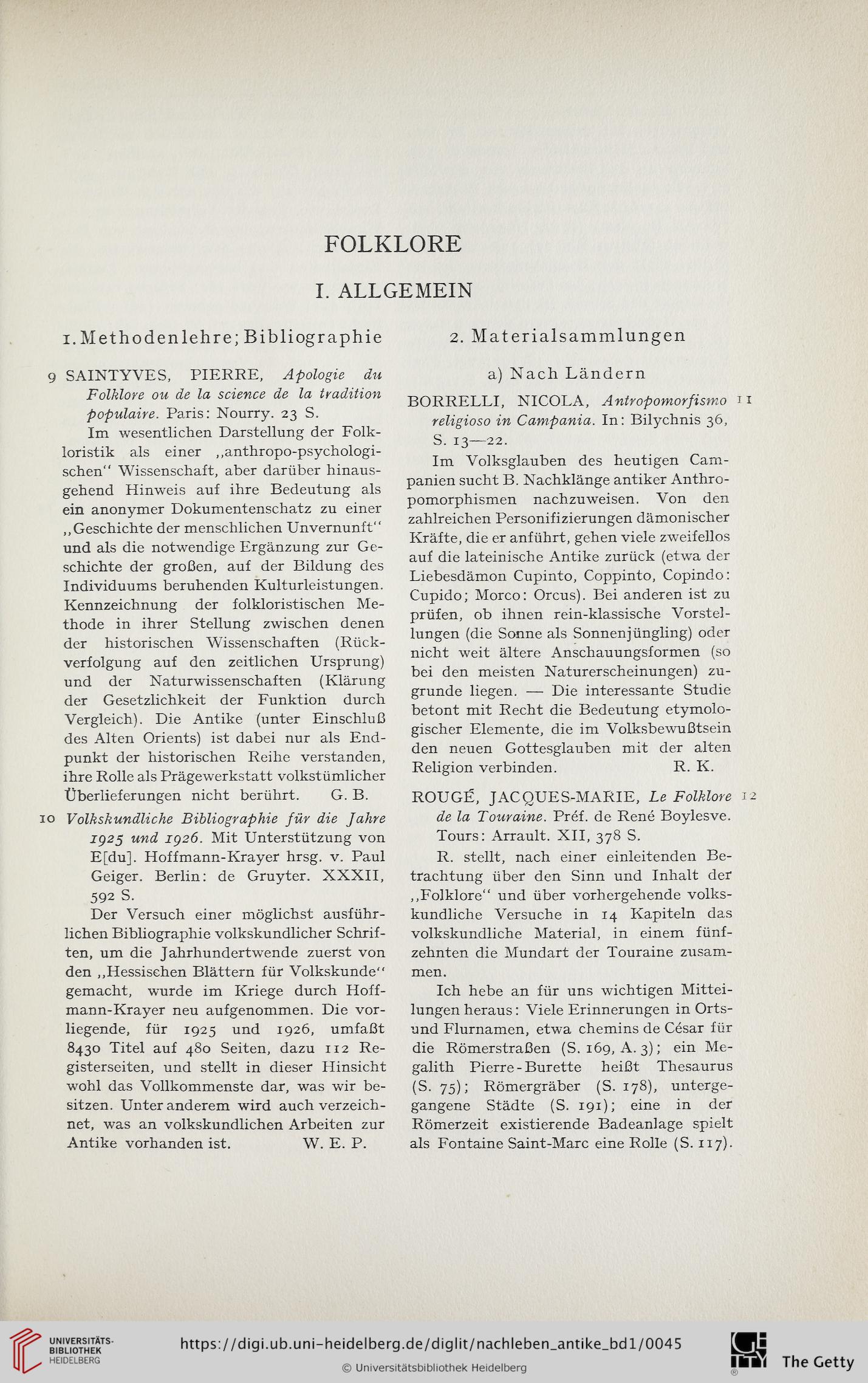FOLKLORE
I. ALLGEMEIN
i.Methodenlehre; Bibliographie
9 SAINTYVES, PIERRE, Apologie du
Folklore ou de la Science de la tradition
populaire. Paris: Nourry. 23 S.
Im wesentlichen Darstellung der Folk-
loristik als einer „anthropo-psychologi-
schen“ Wissenschaft, aber darüber hinaus-
gehend Hinweis auf ihre Bedeutung als
ein anonymer Dokumentenschatz zu einer
„Geschichte der menschlichen Unvernunft“
und als die notwendige Ergänzung zur Ge-
schichte der großen, auf der Bildung des
Individuums beruhenden Kulturleistungen.
Kennzeichnung der folkloristischen Me-
thode in ihrer Stellung zwischen denen
der historischen Wissenschaften (Rück-
verfolgung auf den zeitlichen Ursprung)
und der Naturwissenschaften (Klärung
der Gesetzlichkeit der Funktion durch
Vergleich). Die Antike (unter Einschluß
des Alten Orients) ist dabei nur als End-
punkt der historischen Reihe verstanden,
ihre Rolle als Prägewerkstatt volkstümlicher
Überlieferungen nicht berührt. G. B.
10 Volkskundliche Bibliographie für die Jahre
1925 und 1926. Mit Unterstützung von
E[du]. Hoffmann-Krayer hrsg. v. Paul
Geiger. Berlin: de Gruyter. XXXII,
592 S.
Der Versuch einer möglichst ausführ-
lichen Bibliographie volkskundlicher Schrif-
ten, um die Jahrhundertwende zuerst von
den „Hessischen Blättern für Volkskunde“
gemacht, wurde im Kriege durch Hoff-
mann-Krayer neu aufgenommen. Die vor-
liegende, für 1925 und 1926, umfaßt
8430 Titel auf 480 Seiten, dazu 112 Re-
gisterseiten, und stellt in dieser Hinsicht
wohl das Vollkommenste dar, was wir be-
sitzen. Unteranderem wird auch verzeich-
net, was an volkskundlichen Arbeiten zur
Antike vorhanden ist. W. E. P.
2. Materialsammlungen
a) Nach Ländern
BORRELLI, NICOLA, Antropomorfismo n
religioso in Campania. In: Bilychnis 36,
S. 13—22.
Im Volksglauben des heutigen Cam-
panien sucht B. Nachklänge antiker Anthro-
pomorphismen nachzuweisen. Von den
zahlreichen Personifizierungen dämonischer
Kräfte, die er anführt, gehen viele zweifellos
auf die lateinische Antike zurück (etwa der
Liebesdämon Cupinto, Coppinto, Copindo:
Cupido; Morco: Orcus). Bei anderen ist zu
prüfen, ob ihnen rein-klassische Vorstel-
lungen (die Sonne als Sonnenjüngling) oder
nicht weit ältere Anschauungsformen (so
bei den meisten Naturerscheinungen) zu-
grunde liegen. — Die interessante Studie
betont mit Recht die Bedeutung etymolo-
gischer Elemente, die im Volksbewußtsein
den neuen Gottesglauben mit der alten
Religion verbinden. R. K.
ROUGE, JACQUES-MARIE, Le Folklore 12
de la Touraine. Pref. de Rene Boylesve.
Tours: Arrault. XII, 378 S.
R. stellt, nach einer einleitenden Be-
trachtung über den Sinn und Inhalt der
„Folklore" und über vorhergehende volks-
kundliche Versuche in 14 Kapiteln das
volkskundliche Material, in einem fünf-
zehnten die Mundart der Touraine zusam-
men.
Ich hebe an für uns wichtigen Mittei-
lungen heraus: Viele Erinnerungen in Orts-
und Flurnamen, etwa chemins de Cesar für
die Römerstraßen (S. 169, A. 3); ein Me-
galith Pierre - Bürette heißt Thesaurus
(S. 75); Römergräber (S. 178), unterge-
gangene Städte (S. 191); eine in der
Römerzeit existierende Badeanlage spielt
als Fontaine Saint-Marc eine Rolle (S. 117).
I. ALLGEMEIN
i.Methodenlehre; Bibliographie
9 SAINTYVES, PIERRE, Apologie du
Folklore ou de la Science de la tradition
populaire. Paris: Nourry. 23 S.
Im wesentlichen Darstellung der Folk-
loristik als einer „anthropo-psychologi-
schen“ Wissenschaft, aber darüber hinaus-
gehend Hinweis auf ihre Bedeutung als
ein anonymer Dokumentenschatz zu einer
„Geschichte der menschlichen Unvernunft“
und als die notwendige Ergänzung zur Ge-
schichte der großen, auf der Bildung des
Individuums beruhenden Kulturleistungen.
Kennzeichnung der folkloristischen Me-
thode in ihrer Stellung zwischen denen
der historischen Wissenschaften (Rück-
verfolgung auf den zeitlichen Ursprung)
und der Naturwissenschaften (Klärung
der Gesetzlichkeit der Funktion durch
Vergleich). Die Antike (unter Einschluß
des Alten Orients) ist dabei nur als End-
punkt der historischen Reihe verstanden,
ihre Rolle als Prägewerkstatt volkstümlicher
Überlieferungen nicht berührt. G. B.
10 Volkskundliche Bibliographie für die Jahre
1925 und 1926. Mit Unterstützung von
E[du]. Hoffmann-Krayer hrsg. v. Paul
Geiger. Berlin: de Gruyter. XXXII,
592 S.
Der Versuch einer möglichst ausführ-
lichen Bibliographie volkskundlicher Schrif-
ten, um die Jahrhundertwende zuerst von
den „Hessischen Blättern für Volkskunde“
gemacht, wurde im Kriege durch Hoff-
mann-Krayer neu aufgenommen. Die vor-
liegende, für 1925 und 1926, umfaßt
8430 Titel auf 480 Seiten, dazu 112 Re-
gisterseiten, und stellt in dieser Hinsicht
wohl das Vollkommenste dar, was wir be-
sitzen. Unteranderem wird auch verzeich-
net, was an volkskundlichen Arbeiten zur
Antike vorhanden ist. W. E. P.
2. Materialsammlungen
a) Nach Ländern
BORRELLI, NICOLA, Antropomorfismo n
religioso in Campania. In: Bilychnis 36,
S. 13—22.
Im Volksglauben des heutigen Cam-
panien sucht B. Nachklänge antiker Anthro-
pomorphismen nachzuweisen. Von den
zahlreichen Personifizierungen dämonischer
Kräfte, die er anführt, gehen viele zweifellos
auf die lateinische Antike zurück (etwa der
Liebesdämon Cupinto, Coppinto, Copindo:
Cupido; Morco: Orcus). Bei anderen ist zu
prüfen, ob ihnen rein-klassische Vorstel-
lungen (die Sonne als Sonnenjüngling) oder
nicht weit ältere Anschauungsformen (so
bei den meisten Naturerscheinungen) zu-
grunde liegen. — Die interessante Studie
betont mit Recht die Bedeutung etymolo-
gischer Elemente, die im Volksbewußtsein
den neuen Gottesglauben mit der alten
Religion verbinden. R. K.
ROUGE, JACQUES-MARIE, Le Folklore 12
de la Touraine. Pref. de Rene Boylesve.
Tours: Arrault. XII, 378 S.
R. stellt, nach einer einleitenden Be-
trachtung über den Sinn und Inhalt der
„Folklore" und über vorhergehende volks-
kundliche Versuche in 14 Kapiteln das
volkskundliche Material, in einem fünf-
zehnten die Mundart der Touraine zusam-
men.
Ich hebe an für uns wichtigen Mittei-
lungen heraus: Viele Erinnerungen in Orts-
und Flurnamen, etwa chemins de Cesar für
die Römerstraßen (S. 169, A. 3); ein Me-
galith Pierre - Bürette heißt Thesaurus
(S. 75); Römergräber (S. 178), unterge-
gangene Städte (S. 191); eine in der
Römerzeit existierende Badeanlage spielt
als Fontaine Saint-Marc eine Rolle (S. 117).