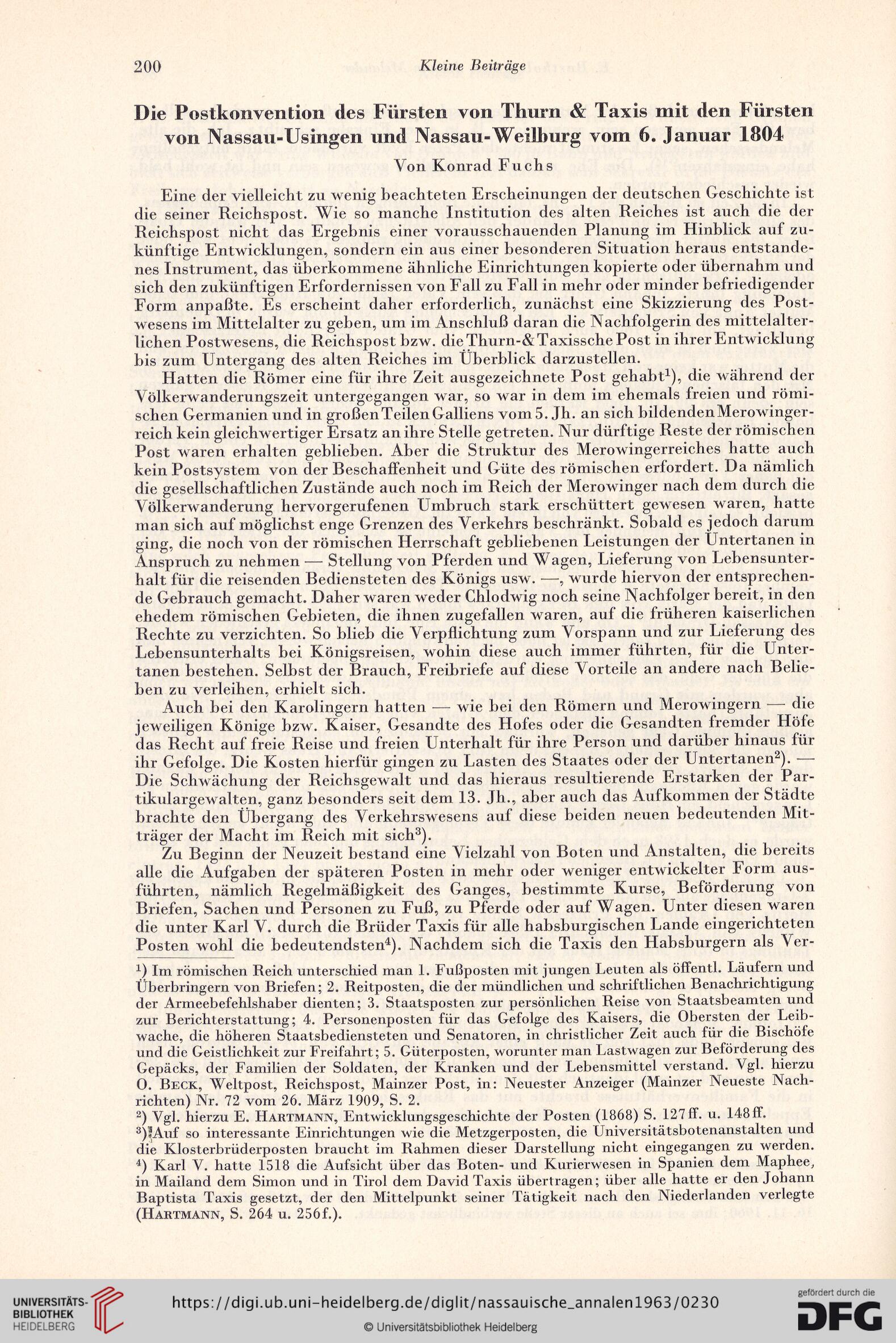200
Kleine Beiträgt
Die Postkonvention des Fürsten von Thurn & Taxis mit den Fürsten
von Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg vom 6. Januar 1804
Von Konrad Fuchs
Eine der vielleicht zu wenig beachteten Erscheinungen der deutschen Geschichte ist
die seiner Reichspost. Wie so manche Institution des alten Reiches ist auch die der
Reichspost nicht das Ergebnis einer vorausschauenden Planung im Hinblick auf zu-
künftige Entwicklungen, sondern ein aus einer besonderen Situation heraus entstande-
nes Instrument, das überkommene ähnliche Einrichtungen kopierte oder übernahm und
sich den zukünftigen Erfordernissen von Fall zu Fall in mehr oder minder befriedigender
Form anpaßte. Es erscheint daher erforderlich, zunächst eine Skizzierung des Post-
wesens im Mittelalter zu geben, um im Anschluß daran die Nachfolgerin des mittelalter-
lichen Postwesens, die Reichspost bzw. die Thurn-&Taxissche Post in ihrer Entwicklung
bis zum Untergang des alten Reiches im Überblick darzustellen.
Hatten die Römer eine für ihre Zeit ausgezeichnete Post gehabt1), die während der
Völkerwanderungszeit untergegangen war, so war in dem im ehemals freien und römi-
schen Germanien und in großenTeilen Galliens vom 5. Jh. an sich bildendenMerowinger-
reich kein gleichwertiger Ersatz an ihre Stelle getreten. Nur dürftige Reste der römischen
Post waren erhalten geblieben. Aber die Struktur des Merowingerreiches hatte auch
kein Postsystem von der Beschaffenheit und Güte des römischen erfordert. Da nämlich
die gesellschaftlichen Zustände auch noch im Reich der Merowinger nach dem durch die
Völkerwanderung hervorgerufenen Umbruch stark erschüttert gewesen waren, hatte
man sich auf möglichst enge Grenzen des Verkehrs beschränkt. Sobald es jedoch darum
ging, die noch von der römischen Herrschaft gebliebenen Leistungen der Untertanen in
Anspruch zu nehmen — Stellung von Pferden und Wagen, Lieferung von Lebensunter-
halt für die reisenden Bediensteten des Königs usw. —, wurde hiervon der entsprechen-
de Gebrauch gemacht. Daher waren weder Chlodwig noch seine Nachfolger bereit, in den
ehedem römischen Gebieten, die ihnen zugefallen waren, auf die früheren kaiserlichen
Rechte zu verzichten. So blieb die Verpflichtung zum Vorspann und zur Lieferung des
Lebensunterhalts bei Königsreisen, wohin diese auch immer führten, für die Unter-
tanen bestehen. Selbst der Brauch, Freibriefe auf diese Vorteile an andere nach Belie-
ben zu verleihen, erhielt sich.
Auch bei den Karolingern hatten — wie bei den Römern und Merowingern — die
jeweiligen Könige bzw. Kaiser, Gesandte des Hofes oder die Gesandten fremder Höfe
das Recht auf freie Reise und freien Unterhalt für ihre Person und darüber hinaus für
ihr Gefolge. Die Kosten hierfür gingen zu Lasten des Staates oder der Untertanen2). —
Die Schwächung der Reichsgewalt und das hieraus resultierende Erstarken der Par-
tikidargewalten, ganz besonders seit dem 13. Jh., aber auch das Aufkommen der Städte
brachte den Übergang des Verkehrswesens auf diese beiden neuen bedeutenden Mit-
träger der Macht im Reich mit sich3).
Zu Beginn der Neuzeit bestand eine Vielzahl von Boten und Anstalten, die bereits
alle die Aufgaben der späteren Posten in mehr oder weniger entwickelter Form aus-
führten, nämlich Regelmäßigkeit des Ganges, bestimmte Kurse, Beförderung von
Briefen, Sachen und Personen zu Fuß, zu Pferde oder auf Wagen. Unter diesen waren
die unter Karl V. durch die Brüder Taxis für alle habsburgischen Lande eingerichteten
Posten wohl die bedeutendsten4). Nachdem sich die Taxis den Habsburgern als Ver-
*) Im römischen Reich unterschied man 1. Fußposten mit jungen Leuten als öffentl. Läufern und
Überbringern von Briefen; 2. Reitposten, die der mündlichen und schriftlichen Benachrichtigung
der Armeebefehlshaber dienten; 3. Staatsposten zur persönlichen Reise von Staatsbeamten und
zur Berichterstattung; 4. Personenposten für das Gefolge des Kaisers, die Obersten der Leib-
wache, die höheren Staatsbediensteten und Senatoren, in christlicher Zeit auch für die Bischöfe
und die Geistlichkeit zur Freifahrt; 5. Güterposten, worunter man Lastwagen zur Beförderung des
Gepäcks, der Familien der Soldaten, der Kranken und der Lebensmittel verstand. Vgl. hierzu
O. Beck, Weltpost, Reichspost, Mainzer Post, in: Neuester Anzeiger (Mainzer Neueste Nach-
richten) Nr. 72 vom 26. März 1909, S. 2.
2) Vgl. hierzu E. Hartmann, Entwicklungsgeschichte der Posten (1868) S. 127ff. u. 148ff.
3) JAuf so interessante Einrichtungen wie die Metzgerposten, die Universitätsbotenanstalten und
die Klosterbrüderposten braucht im Rahmen dieser Darstellung nicht eingegangen zu werden.
4) Karl V. hatte 1518 die Aufsicht über das Boten- und Kurierwesen in Spanien dem Maphee,
in Mailand dem Simon und in Tirol dem David Taxis übertragen; über alle hatte er den Johann
Baptista Taxis gesetzt, der den Mittelpunkt seiner Tätigkeit nach den Niederlanden verlegte
(Hartmann, S. 264 u. 256f.).
Kleine Beiträgt
Die Postkonvention des Fürsten von Thurn & Taxis mit den Fürsten
von Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg vom 6. Januar 1804
Von Konrad Fuchs
Eine der vielleicht zu wenig beachteten Erscheinungen der deutschen Geschichte ist
die seiner Reichspost. Wie so manche Institution des alten Reiches ist auch die der
Reichspost nicht das Ergebnis einer vorausschauenden Planung im Hinblick auf zu-
künftige Entwicklungen, sondern ein aus einer besonderen Situation heraus entstande-
nes Instrument, das überkommene ähnliche Einrichtungen kopierte oder übernahm und
sich den zukünftigen Erfordernissen von Fall zu Fall in mehr oder minder befriedigender
Form anpaßte. Es erscheint daher erforderlich, zunächst eine Skizzierung des Post-
wesens im Mittelalter zu geben, um im Anschluß daran die Nachfolgerin des mittelalter-
lichen Postwesens, die Reichspost bzw. die Thurn-&Taxissche Post in ihrer Entwicklung
bis zum Untergang des alten Reiches im Überblick darzustellen.
Hatten die Römer eine für ihre Zeit ausgezeichnete Post gehabt1), die während der
Völkerwanderungszeit untergegangen war, so war in dem im ehemals freien und römi-
schen Germanien und in großenTeilen Galliens vom 5. Jh. an sich bildendenMerowinger-
reich kein gleichwertiger Ersatz an ihre Stelle getreten. Nur dürftige Reste der römischen
Post waren erhalten geblieben. Aber die Struktur des Merowingerreiches hatte auch
kein Postsystem von der Beschaffenheit und Güte des römischen erfordert. Da nämlich
die gesellschaftlichen Zustände auch noch im Reich der Merowinger nach dem durch die
Völkerwanderung hervorgerufenen Umbruch stark erschüttert gewesen waren, hatte
man sich auf möglichst enge Grenzen des Verkehrs beschränkt. Sobald es jedoch darum
ging, die noch von der römischen Herrschaft gebliebenen Leistungen der Untertanen in
Anspruch zu nehmen — Stellung von Pferden und Wagen, Lieferung von Lebensunter-
halt für die reisenden Bediensteten des Königs usw. —, wurde hiervon der entsprechen-
de Gebrauch gemacht. Daher waren weder Chlodwig noch seine Nachfolger bereit, in den
ehedem römischen Gebieten, die ihnen zugefallen waren, auf die früheren kaiserlichen
Rechte zu verzichten. So blieb die Verpflichtung zum Vorspann und zur Lieferung des
Lebensunterhalts bei Königsreisen, wohin diese auch immer führten, für die Unter-
tanen bestehen. Selbst der Brauch, Freibriefe auf diese Vorteile an andere nach Belie-
ben zu verleihen, erhielt sich.
Auch bei den Karolingern hatten — wie bei den Römern und Merowingern — die
jeweiligen Könige bzw. Kaiser, Gesandte des Hofes oder die Gesandten fremder Höfe
das Recht auf freie Reise und freien Unterhalt für ihre Person und darüber hinaus für
ihr Gefolge. Die Kosten hierfür gingen zu Lasten des Staates oder der Untertanen2). —
Die Schwächung der Reichsgewalt und das hieraus resultierende Erstarken der Par-
tikidargewalten, ganz besonders seit dem 13. Jh., aber auch das Aufkommen der Städte
brachte den Übergang des Verkehrswesens auf diese beiden neuen bedeutenden Mit-
träger der Macht im Reich mit sich3).
Zu Beginn der Neuzeit bestand eine Vielzahl von Boten und Anstalten, die bereits
alle die Aufgaben der späteren Posten in mehr oder weniger entwickelter Form aus-
führten, nämlich Regelmäßigkeit des Ganges, bestimmte Kurse, Beförderung von
Briefen, Sachen und Personen zu Fuß, zu Pferde oder auf Wagen. Unter diesen waren
die unter Karl V. durch die Brüder Taxis für alle habsburgischen Lande eingerichteten
Posten wohl die bedeutendsten4). Nachdem sich die Taxis den Habsburgern als Ver-
*) Im römischen Reich unterschied man 1. Fußposten mit jungen Leuten als öffentl. Läufern und
Überbringern von Briefen; 2. Reitposten, die der mündlichen und schriftlichen Benachrichtigung
der Armeebefehlshaber dienten; 3. Staatsposten zur persönlichen Reise von Staatsbeamten und
zur Berichterstattung; 4. Personenposten für das Gefolge des Kaisers, die Obersten der Leib-
wache, die höheren Staatsbediensteten und Senatoren, in christlicher Zeit auch für die Bischöfe
und die Geistlichkeit zur Freifahrt; 5. Güterposten, worunter man Lastwagen zur Beförderung des
Gepäcks, der Familien der Soldaten, der Kranken und der Lebensmittel verstand. Vgl. hierzu
O. Beck, Weltpost, Reichspost, Mainzer Post, in: Neuester Anzeiger (Mainzer Neueste Nach-
richten) Nr. 72 vom 26. März 1909, S. 2.
2) Vgl. hierzu E. Hartmann, Entwicklungsgeschichte der Posten (1868) S. 127ff. u. 148ff.
3) JAuf so interessante Einrichtungen wie die Metzgerposten, die Universitätsbotenanstalten und
die Klosterbrüderposten braucht im Rahmen dieser Darstellung nicht eingegangen zu werden.
4) Karl V. hatte 1518 die Aufsicht über das Boten- und Kurierwesen in Spanien dem Maphee,
in Mailand dem Simon und in Tirol dem David Taxis übertragen; über alle hatte er den Johann
Baptista Taxis gesetzt, der den Mittelpunkt seiner Tätigkeit nach den Niederlanden verlegte
(Hartmann, S. 264 u. 256f.).