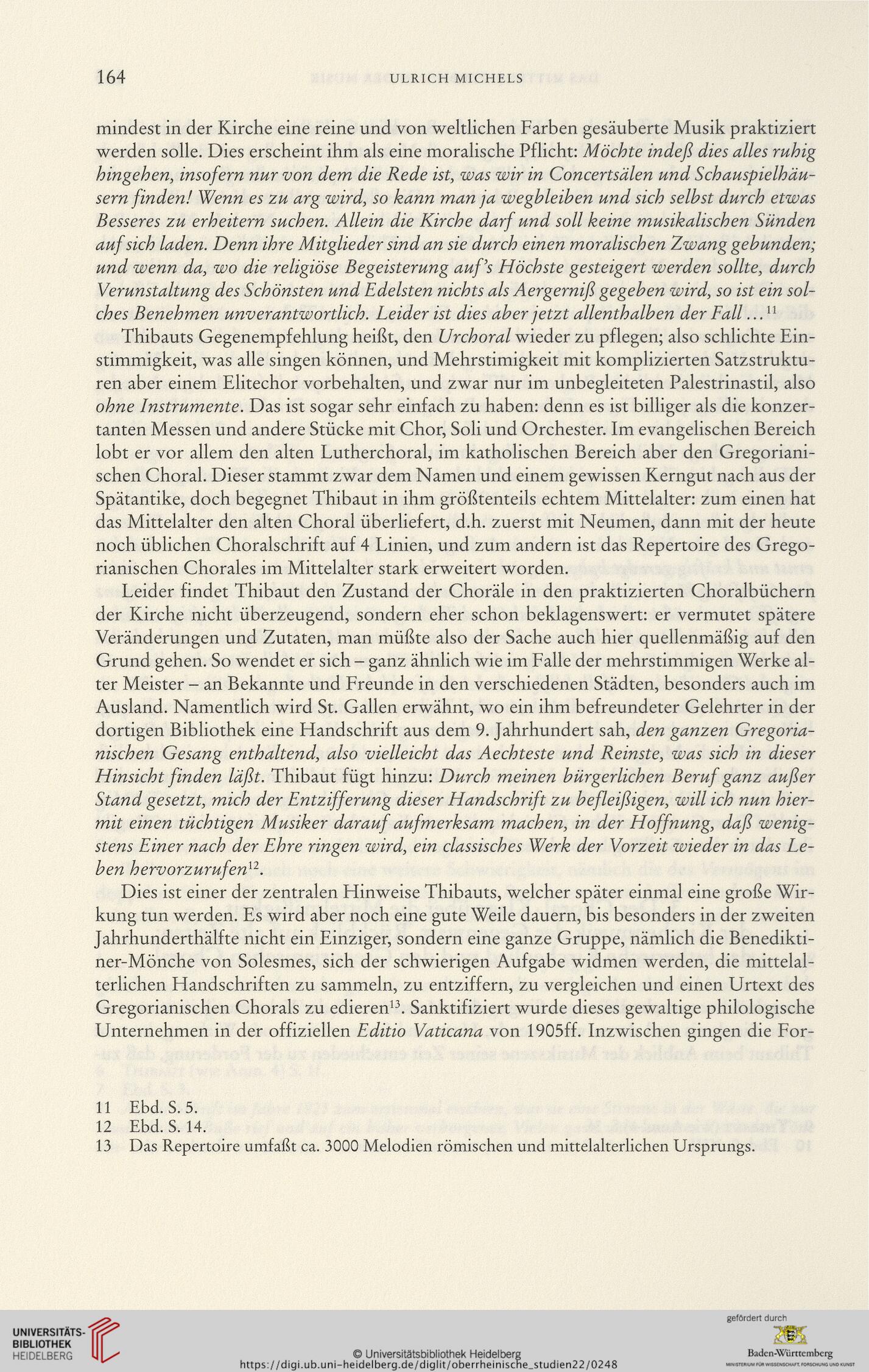164
ULRICH MICHELS
mindest in der Kirche eine reine und von weltlichen Farben gesäuberte Musik praktiziert
werden solle. Dies erscheint ihm als eine moralische Pflicht: Möchte indeß dies alles ruhig
hingehen, insofern nur von dem die Rede ist, was wir in Concertsälen und Schauspielhäu-
sern finden! Wenn es zu arg wird, so kann man ja wegbleiben und sich selbst durch etwas
Besseres zu erheitern suchen. Allein die Kirche darf und soll keine musikalischen Sünden
auf sich laden. Denn ihre Mitglieder sind an sie durch einen moralischen Zwang gebunden;
und wenn da, wo die religiöse Begeisterung auf’s Höchste gesteigert werden sollte, durch
Verunstaltung des Schönsten und Edelsten nichts als Aergerniß gegeben wird, so ist ein sol-
ches Benehmen unverantwortlich. Leider ist dies aber jetzt allenthalben der Fall...11 12
Thibauts Gegenempfehlung heißt, den Urchoral wieder zu pflegen; also schlichte Ein-
stimmigkeit, was alle singen können, und Mehrstimigkeit mit komplizierten Satzstruktu-
ren aber einem Elitechor vorbehalten, und zwar nur im unbegleiteten Palestrinastil, also
ohne Instrumente. Das ist sogar sehr einfach zu haben: denn es ist billiger als die konzer-
tanten Messen und andere Stücke mit Chor, Soli und Orchester. Im evangelischen Bereich
lobt er vor allem den alten Lutherchoral, im katholischen Bereich aber den Gregoriani-
schen Choral. Dieser stammt zwar dem Namen und einem gewissen Kerngut nach aus der
Spätantike, doch begegnet Thibaut in ihm größtenteils echtem Mittelalter: zum einen hat
das Mittelalter den alten Choral überliefert, d.h. zuerst mit Neumen, dann mit der heute
noch üblichen Choralschrift auf 4 Linien, und zum andern ist das Repertoire des Grego-
rianischen Chorales im Mittelalter stark erweitert worden.
Leider findet Thibaut den Zustand der Choräle in den praktizierten Choralbüchern
der Kirche nicht überzeugend, sondern eher schon beklagenswert: er vermutet spätere
Veränderungen und Zutaten, man müßte also der Sache auch hier quellenmäßig auf den
Grund gehen. So wendet er sich - ganz ähnlich wie im Falle der mehrstimmigen Werke al-
ter Meister - an Bekannte und Freunde in den verschiedenen Städten, besonders auch im
Ausland. Namentlich wird St. Gallen erwähnt, wo ein ihm befreundeter Gelehrter in der
dortigen Bibliothek eine Handschrift aus dem 9. Jahrhundert sah, den ganzen Gregoria-
nischen Gesang enthaltend, also vielleicht das Aechteste und Reinste, was sich in dieser
Hinsicht finden läßt. Thibaut fügt hinzu: Durch meinen bürgerlichen Beruf ganz außer
Stand gesetzt, mich der Entzifferung dieser Handschrift zu befleißigen, will ich nun hier-
mit einen tüchtigen Musiker darauf aufmerksam machen, in der Hoffnung, daß wenig-
stens Einer nach der Ehre ringen wird, ein classisches Werk der Vorzeit wieder in das he-
ben hervorzurufenn.
Dies ist einer der zentralen Hinweise Thibauts, welcher später einmal eine große Wir-
kung tun werden. Es wird aber noch eine gute Weile dauern, bis besonders in der zweiten
Jahrhunderthälfte nicht ein Einziger, sondern eine ganze Gruppe, nämlich die Benedikti-
ner-Mönche von Solesmes, sich der schwierigen Aufgabe widmen werden, die mittelal-
terlichen Handschriften zu sammeln, zu entziffern, zu vergleichen und einen Urtext des
Gregorianischen Chorals zu edieren13. Sanktifiziert wurde dieses gewaltige philologische
Unternehmen in der offiziellen Editio Vaticana von 1905ff. Inzwischen gingen die For-
11 Ebd. S. 5.
12 Ebd. S. 14.
13 Das Repertoire umfaßt ca. 3000 Melodien römischen und mittelalterlichen Ursprungs.
ULRICH MICHELS
mindest in der Kirche eine reine und von weltlichen Farben gesäuberte Musik praktiziert
werden solle. Dies erscheint ihm als eine moralische Pflicht: Möchte indeß dies alles ruhig
hingehen, insofern nur von dem die Rede ist, was wir in Concertsälen und Schauspielhäu-
sern finden! Wenn es zu arg wird, so kann man ja wegbleiben und sich selbst durch etwas
Besseres zu erheitern suchen. Allein die Kirche darf und soll keine musikalischen Sünden
auf sich laden. Denn ihre Mitglieder sind an sie durch einen moralischen Zwang gebunden;
und wenn da, wo die religiöse Begeisterung auf’s Höchste gesteigert werden sollte, durch
Verunstaltung des Schönsten und Edelsten nichts als Aergerniß gegeben wird, so ist ein sol-
ches Benehmen unverantwortlich. Leider ist dies aber jetzt allenthalben der Fall...11 12
Thibauts Gegenempfehlung heißt, den Urchoral wieder zu pflegen; also schlichte Ein-
stimmigkeit, was alle singen können, und Mehrstimigkeit mit komplizierten Satzstruktu-
ren aber einem Elitechor vorbehalten, und zwar nur im unbegleiteten Palestrinastil, also
ohne Instrumente. Das ist sogar sehr einfach zu haben: denn es ist billiger als die konzer-
tanten Messen und andere Stücke mit Chor, Soli und Orchester. Im evangelischen Bereich
lobt er vor allem den alten Lutherchoral, im katholischen Bereich aber den Gregoriani-
schen Choral. Dieser stammt zwar dem Namen und einem gewissen Kerngut nach aus der
Spätantike, doch begegnet Thibaut in ihm größtenteils echtem Mittelalter: zum einen hat
das Mittelalter den alten Choral überliefert, d.h. zuerst mit Neumen, dann mit der heute
noch üblichen Choralschrift auf 4 Linien, und zum andern ist das Repertoire des Grego-
rianischen Chorales im Mittelalter stark erweitert worden.
Leider findet Thibaut den Zustand der Choräle in den praktizierten Choralbüchern
der Kirche nicht überzeugend, sondern eher schon beklagenswert: er vermutet spätere
Veränderungen und Zutaten, man müßte also der Sache auch hier quellenmäßig auf den
Grund gehen. So wendet er sich - ganz ähnlich wie im Falle der mehrstimmigen Werke al-
ter Meister - an Bekannte und Freunde in den verschiedenen Städten, besonders auch im
Ausland. Namentlich wird St. Gallen erwähnt, wo ein ihm befreundeter Gelehrter in der
dortigen Bibliothek eine Handschrift aus dem 9. Jahrhundert sah, den ganzen Gregoria-
nischen Gesang enthaltend, also vielleicht das Aechteste und Reinste, was sich in dieser
Hinsicht finden läßt. Thibaut fügt hinzu: Durch meinen bürgerlichen Beruf ganz außer
Stand gesetzt, mich der Entzifferung dieser Handschrift zu befleißigen, will ich nun hier-
mit einen tüchtigen Musiker darauf aufmerksam machen, in der Hoffnung, daß wenig-
stens Einer nach der Ehre ringen wird, ein classisches Werk der Vorzeit wieder in das he-
ben hervorzurufenn.
Dies ist einer der zentralen Hinweise Thibauts, welcher später einmal eine große Wir-
kung tun werden. Es wird aber noch eine gute Weile dauern, bis besonders in der zweiten
Jahrhunderthälfte nicht ein Einziger, sondern eine ganze Gruppe, nämlich die Benedikti-
ner-Mönche von Solesmes, sich der schwierigen Aufgabe widmen werden, die mittelal-
terlichen Handschriften zu sammeln, zu entziffern, zu vergleichen und einen Urtext des
Gregorianischen Chorals zu edieren13. Sanktifiziert wurde dieses gewaltige philologische
Unternehmen in der offiziellen Editio Vaticana von 1905ff. Inzwischen gingen die For-
11 Ebd. S. 5.
12 Ebd. S. 14.
13 Das Repertoire umfaßt ca. 3000 Melodien römischen und mittelalterlichen Ursprungs.