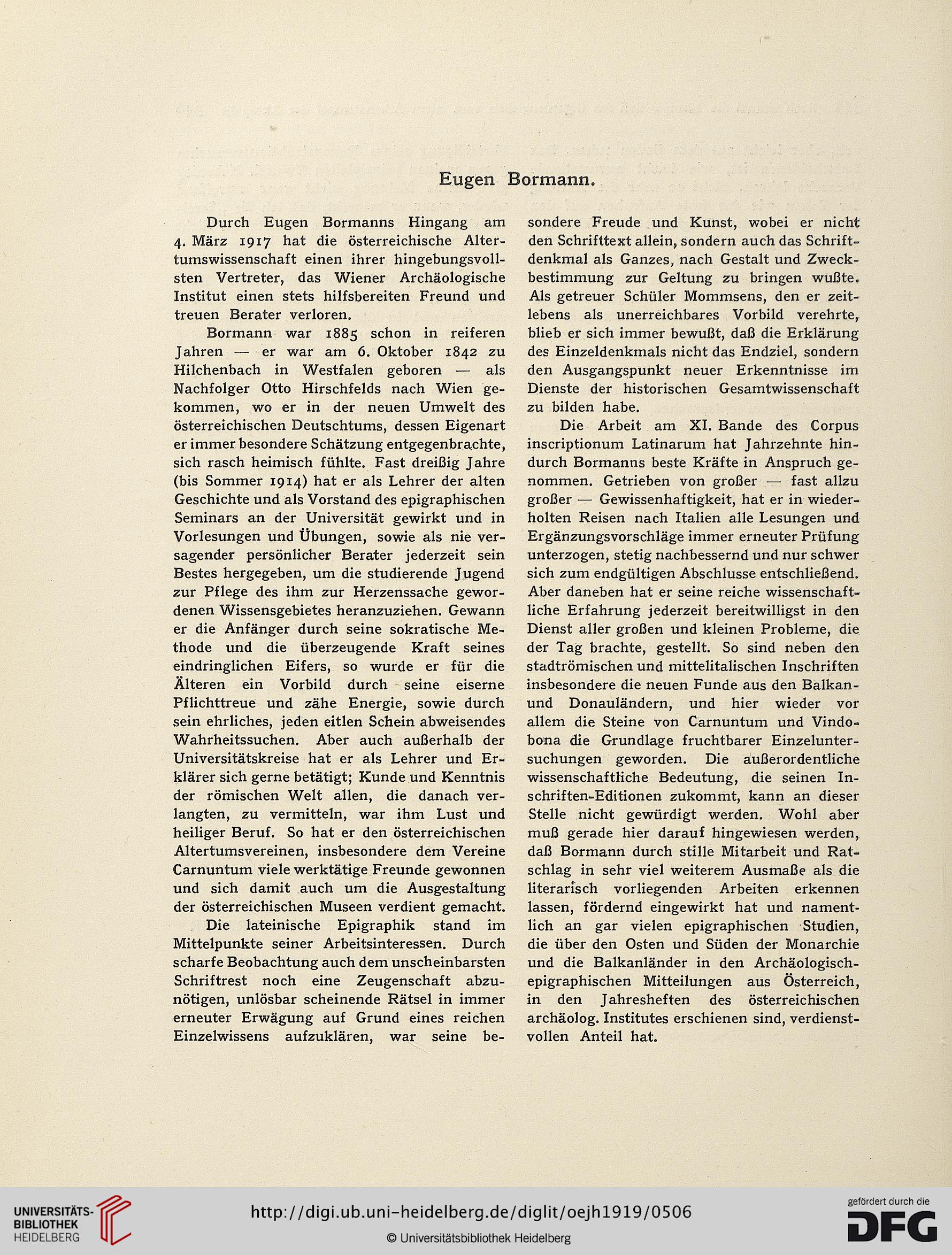Eugen Bormann.
Durch Eugen Bormanns Hingang am
4. März 1917 hat die österreichische Alter-
tumswissenschaft einen ihrer hingebungsvoll-
sten Vertreter, das Wiener Archäologische
Institut einen stets hilfsbereiten Freund und
treuen Berater verloren.
Bormann war 1885 schon in reiferen
Jahren — er war am 6. Oktober 1842 zu
Hilchenbach in Westfalen geboren — als
Nachfolger Otto Hirschfelds nach Wien ge-
kommen, wo er in der neuen Umwelt des
österreichischen Deutschtums, dessen Eigenart
er immer besondere Schätzung entgegenbrachte,
sich rasch heimisch fühlte. Fast dreißig Jahre
(bis Sommer 1914) hat er als Lehrer der alten
Geschichte und als Vorstand des epigraphischen
Seminars an der Universität gewirkt und in
Vorlesungen und Übungen, sowie als nie ver-
sagender persönlicher Berater jederzeit sein
Bestes hergegeben, um die studierende Jugend
zur Pflege des ihm zur Herzenssache gewor-
denen Wissensgebietes heranzuziehen. Gewann
er die Anfänger durch seine sokratische Me-
thode und die überzeugende Kraft seines
eindringlichen Eifers, so wurde er für die
Älteren ein Vorbild durch seine eiserne
Pflichttreue und zähe Energie, sowie durch
sein ehrliches, jeden eitlen Schein abweisendes
Wahrheitssuchen. Aber auch außerhalb der
Universitätskreise hat er als Lehrer und Er-
klärer sich gerne betätigt; Kunde und Kenntnis
der römischen Welt allen, die danach ver-
langten, zu vermitteln, war ihm Lust und
heiliger Beruf. So hat er den österreichischen
Altertumsvereinen, insbesondere dem Vereine
Carnuntum viele werktätige Freunde gewonnen
und sich damit auch um die Ausgestaltung
der österreichischen Museen verdient gemacht.
Die lateinische Epigraphik stand im
Mittelpunkte seiner Arbeitsinteressen. Durch
scharfe Beobachtung auch dem unscheinbarsten
Schriftrest noch eine Zeugenschaft abzu-
nötigen, unlösbar scheinende Rätsel in immer
erneuter Erwägung auf Grund eines reichen
Einzelwissens aufzuklären, war seine be-
sondere Freude und Kunst, wobei er nicht
den Schrifttext allein, sondern auch das Schrift-
denkmal als Ganzes, nach Gestalt und Zweck-
bestimmung zur Geltung zu bringen wußte.
Als getreuer Schüler Mommsens, den er zeit-
lebens als unerreichbares Vorbild verehrte,
blieb er sich immer bewußt, daß die Erklärung
des Einzeldenkmals nicht das Endziel, sondern
den Ausgangspunkt neuer Erkenntnisse im
Dienste der historischen Gesamtwissenschaft
zu bilden habe.
Die Arbeit am XI. Bande des Corpus
inscriptionum Latinarum hat Jahrzehnte hin-
durch Bormanns beste Kräfte in Anspruch ge-
nommen. Getrieben von großer — fast allzu
großer — Gewissenhaftigkeit, hat er in wieder-
holten Reisen nach Italien alle Lesungen und
Ergänzungsvorschläge immer erneuter Prüfung
unterzogen, stetig nachbessernd und nur schwer
sich zum endgültigen Abschlüsse entschließend.
Aber daneben hat er seine reiche wissenschaft-
liche Erfahrung jederzeit bereitwilligst in den
Dienst aller großen und kleinen Probleme, die
der Tag brachte, gestellt. So sind neben den
stadtrömischen und mittelitalischen Inschriften
insbesondere die neuen Funde aus den Balkan-
und Donauländern, und hier wieder vor
allem die Steine von Carnuntum und Vindo-
bona die Grundlage fruchtbarer Einzelunter-
suchungen geworden. Die außerordentliche
wissenschaftliche Bedeutung, die seinen In-
schriften-Editionen zukommt, kann an dieser
Stelle nicht gewürdigt werden. Wohl aber
muß gerade hier darauf hingewiesen werden,
daß Bormann durch stille Mitarbeit und Rat-
schlag in sehr viel weiterem Ausmaße als die
literarisch vorliegenden Arbeiten erkennen
lassen, fördernd eingewirkt hat und nament-
lich an gar vielen epigraphischen Studien,
die über den Osten und Süden der Monarchie
und die Balkanländer in den Archäologisch-
epigraphischen Mitteilungen aus Österreich,
in den Jahresheften des österreichischen
archäolog. Institutes erschienen sind, verdienst-
vollen Anteil hat.
Durch Eugen Bormanns Hingang am
4. März 1917 hat die österreichische Alter-
tumswissenschaft einen ihrer hingebungsvoll-
sten Vertreter, das Wiener Archäologische
Institut einen stets hilfsbereiten Freund und
treuen Berater verloren.
Bormann war 1885 schon in reiferen
Jahren — er war am 6. Oktober 1842 zu
Hilchenbach in Westfalen geboren — als
Nachfolger Otto Hirschfelds nach Wien ge-
kommen, wo er in der neuen Umwelt des
österreichischen Deutschtums, dessen Eigenart
er immer besondere Schätzung entgegenbrachte,
sich rasch heimisch fühlte. Fast dreißig Jahre
(bis Sommer 1914) hat er als Lehrer der alten
Geschichte und als Vorstand des epigraphischen
Seminars an der Universität gewirkt und in
Vorlesungen und Übungen, sowie als nie ver-
sagender persönlicher Berater jederzeit sein
Bestes hergegeben, um die studierende Jugend
zur Pflege des ihm zur Herzenssache gewor-
denen Wissensgebietes heranzuziehen. Gewann
er die Anfänger durch seine sokratische Me-
thode und die überzeugende Kraft seines
eindringlichen Eifers, so wurde er für die
Älteren ein Vorbild durch seine eiserne
Pflichttreue und zähe Energie, sowie durch
sein ehrliches, jeden eitlen Schein abweisendes
Wahrheitssuchen. Aber auch außerhalb der
Universitätskreise hat er als Lehrer und Er-
klärer sich gerne betätigt; Kunde und Kenntnis
der römischen Welt allen, die danach ver-
langten, zu vermitteln, war ihm Lust und
heiliger Beruf. So hat er den österreichischen
Altertumsvereinen, insbesondere dem Vereine
Carnuntum viele werktätige Freunde gewonnen
und sich damit auch um die Ausgestaltung
der österreichischen Museen verdient gemacht.
Die lateinische Epigraphik stand im
Mittelpunkte seiner Arbeitsinteressen. Durch
scharfe Beobachtung auch dem unscheinbarsten
Schriftrest noch eine Zeugenschaft abzu-
nötigen, unlösbar scheinende Rätsel in immer
erneuter Erwägung auf Grund eines reichen
Einzelwissens aufzuklären, war seine be-
sondere Freude und Kunst, wobei er nicht
den Schrifttext allein, sondern auch das Schrift-
denkmal als Ganzes, nach Gestalt und Zweck-
bestimmung zur Geltung zu bringen wußte.
Als getreuer Schüler Mommsens, den er zeit-
lebens als unerreichbares Vorbild verehrte,
blieb er sich immer bewußt, daß die Erklärung
des Einzeldenkmals nicht das Endziel, sondern
den Ausgangspunkt neuer Erkenntnisse im
Dienste der historischen Gesamtwissenschaft
zu bilden habe.
Die Arbeit am XI. Bande des Corpus
inscriptionum Latinarum hat Jahrzehnte hin-
durch Bormanns beste Kräfte in Anspruch ge-
nommen. Getrieben von großer — fast allzu
großer — Gewissenhaftigkeit, hat er in wieder-
holten Reisen nach Italien alle Lesungen und
Ergänzungsvorschläge immer erneuter Prüfung
unterzogen, stetig nachbessernd und nur schwer
sich zum endgültigen Abschlüsse entschließend.
Aber daneben hat er seine reiche wissenschaft-
liche Erfahrung jederzeit bereitwilligst in den
Dienst aller großen und kleinen Probleme, die
der Tag brachte, gestellt. So sind neben den
stadtrömischen und mittelitalischen Inschriften
insbesondere die neuen Funde aus den Balkan-
und Donauländern, und hier wieder vor
allem die Steine von Carnuntum und Vindo-
bona die Grundlage fruchtbarer Einzelunter-
suchungen geworden. Die außerordentliche
wissenschaftliche Bedeutung, die seinen In-
schriften-Editionen zukommt, kann an dieser
Stelle nicht gewürdigt werden. Wohl aber
muß gerade hier darauf hingewiesen werden,
daß Bormann durch stille Mitarbeit und Rat-
schlag in sehr viel weiterem Ausmaße als die
literarisch vorliegenden Arbeiten erkennen
lassen, fördernd eingewirkt hat und nament-
lich an gar vielen epigraphischen Studien,
die über den Osten und Süden der Monarchie
und die Balkanländer in den Archäologisch-
epigraphischen Mitteilungen aus Österreich,
in den Jahresheften des österreichischen
archäolog. Institutes erschienen sind, verdienst-
vollen Anteil hat.